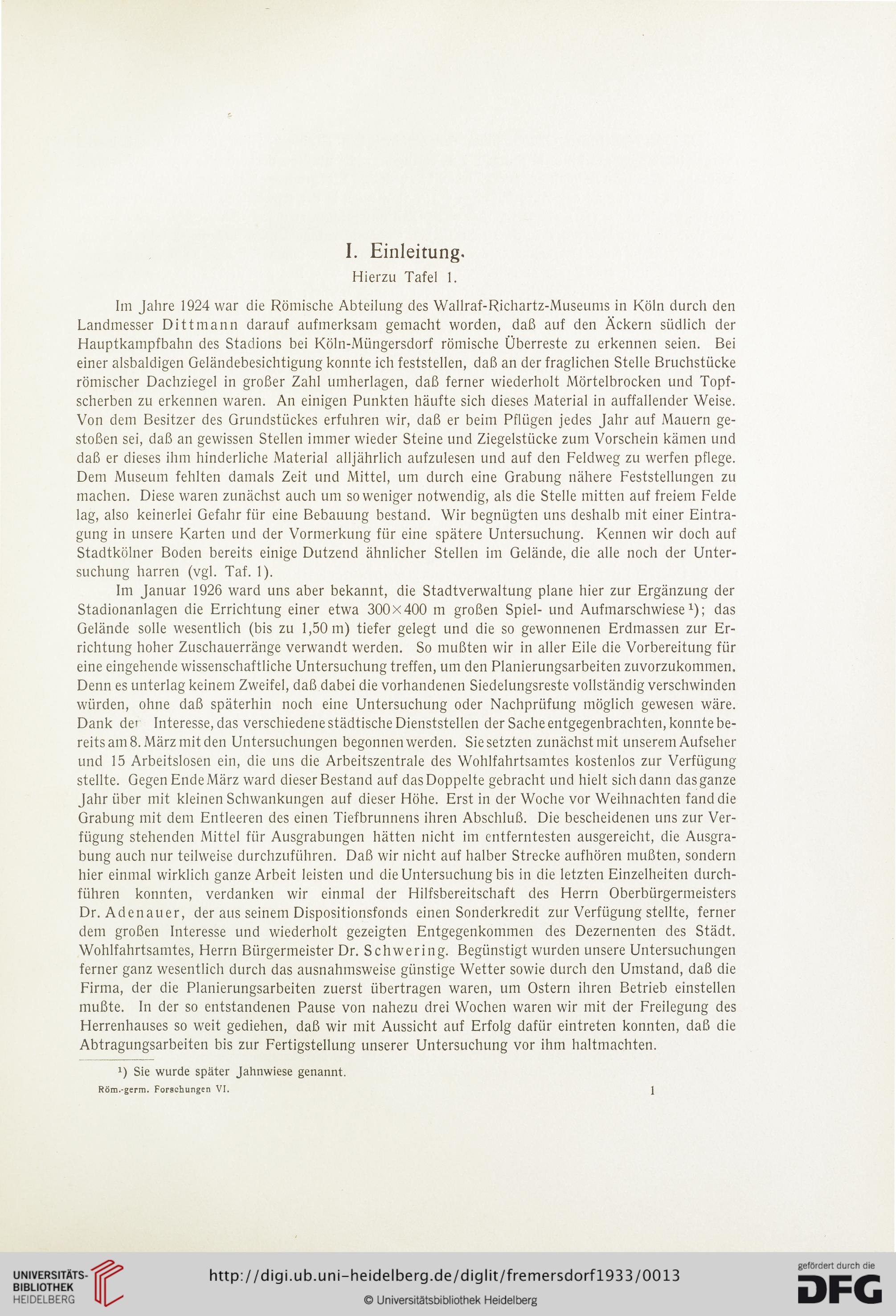I. Einleitung.
Hierzu Tafel 1.
Im Jahre 1924 war die Römische Abteilung des Wallraf-Richartz-Museums in Köln durch den
Landmesser Dittmann darauf aufmerksam gemacht worden, daß auf den Äckern südlich der
Hauptkampfbahn des Stadions bei Köln-Müngersdorf römische Überreste zu erkennen seien. Bei
einer alsbaldigen Geländebesichtigung konnte ich feststellen, daß an der fraglichen Stelle Bruchstücke
römischer Dachziegel in großer Zahl umherlagen, daß ferner wiederholt Mörtelbrocken und Topf-
scherben zu erkennen waren. An einigen Punkten häufte sich dieses Material in auffallender Weise.
Von dem Besitzer des Grundstückes erfuhren wir, daß er beim Pflügen jedes Jahr auf Mauern ge-
stoßen sei, daß an gewissen Stellen immer wieder Steine und Ziegelstücke zum Vorschein kämen und
daß er dieses ihm hinderliche Material alljährlich aufzulesen und auf den Feldweg zu werfen pflege.
Dem Museum fehlten damals Zeit und Mittel, um durch eine Grabung nähere Feststellungen zu
machen. Diese waren zunächst auch um so weniger notwendig, als die Stelle mitten auf freiem Felde
lag, also keinerlei Gefahr für eine Bebauung bestand. Wir begnügten uns deshalb mit einer Eintra-
gung in unsere Karten und der Vormerkung für eine spätere Untersuchung. Kennen wir doch auf
Stadtkölner Boden bereits einige Dutzend ähnlicher Stellen im Gelände, die alle noch der Unter-
suchung harren (vgl. Taf. 1).
Im Januar 1926 ward uns aber bekannt, die Stadtverwaltung plane hier zur Ergänzung der
Stadionanlagen die Errichtung einer etwa 300x400 m großen Spiel- und Aufmarschwiese1); das
Gelände solle wesentlich (bis zu 1,50 m) tiefer gelegt und die so gewonnenen Erdmassen zur Er-
richtung hoher Zuschauerränge verwandt werden. So mußten wir in aller Eile die Vorbereitung für
eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung treffen, um den Planierungsarbeiten zuvorzukommen.
Denn es unterlag keinem Zweifel, daß dabei die vorhandenen Siedelungsreste vollständig verschwinden
würden, ohne daß späterhin noch eine Untersuchung oder Nachprüfung möglich gewesen wäre.
Dank de» Interesse, das verschiedene städtische Dienststellen der Sache entgegenbrachten, konnte be-
reits am 8. März mit den Untersuchungen begonnen werden. Sie setzten zunächst mit unserem Aufseher
und 15 Arbeitslosen ein, die uns die Arbeitszentrale des Wohlfahrtsamtes kostenlos zur Verfügung
stellte. Gegen Ende März ward dieser Bestand auf das Doppelte gebracht und hielt sich dann das ganze
Jahr über mit kleinen Schwankungen auf dieser Höhe. Erst in der Woche vor Weihnachten fand die
Grabung mit dem Entleeren des einen Tiefbrunnens ihren Abschluß. Die bescheidenen uns zur Ver-
fügung stehenden Mittel für Ausgrabungen hätten nicht im entferntesten ausgereicht, die Ausgra-
bung auch nur teilweise durchzuführen. Daß wir nicht auf halber Strecke aufhören mußten, sondern
hier einmal wirklich ganze Arbeit leisten und die Untersuchung bis in die letzten Einzelheiten durch-
führen konnten, verdanken wir einmal der Hilfsbereitschaft des Herrn Oberbürgermeisters
Dr. Adenauer, der aus seinem Dispositionsfonds einen Sonderkredit zur Verfügung stellte, ferner
dem großen Interesse und wiederholt gezeigten Entgegenkommen des Dezernenten des Städt.
Wohlfahrtsamtes, Herrn Bürgermeister Dr. Schwering. Begünstigt wurden unsere Untersuchungen
ferner ganz wesentlich durch das ausnahmsweise günstige Wetter sowie durch den Umstand, daß die
Firma, der die Planierungsarbeiten zuerst übertragen waren, um Ostern ihren Betrieb einstellen
mußte. In der so entstandenen Pause von nahezu drei Wochen waren wir mit der Freilegung des
Herrenhauses so weit gediehen, daß wir mit Aussicht auf Erfolg dafür eintreten konnten, daß die
Abtragungsarbeiten bis zur Fertigstellung unserer Untersuchung vor ihm haltmachten.
D Sie wurde später Jahnwiese genannt.
Röm.-germ. Forschungen VI.
1
Hierzu Tafel 1.
Im Jahre 1924 war die Römische Abteilung des Wallraf-Richartz-Museums in Köln durch den
Landmesser Dittmann darauf aufmerksam gemacht worden, daß auf den Äckern südlich der
Hauptkampfbahn des Stadions bei Köln-Müngersdorf römische Überreste zu erkennen seien. Bei
einer alsbaldigen Geländebesichtigung konnte ich feststellen, daß an der fraglichen Stelle Bruchstücke
römischer Dachziegel in großer Zahl umherlagen, daß ferner wiederholt Mörtelbrocken und Topf-
scherben zu erkennen waren. An einigen Punkten häufte sich dieses Material in auffallender Weise.
Von dem Besitzer des Grundstückes erfuhren wir, daß er beim Pflügen jedes Jahr auf Mauern ge-
stoßen sei, daß an gewissen Stellen immer wieder Steine und Ziegelstücke zum Vorschein kämen und
daß er dieses ihm hinderliche Material alljährlich aufzulesen und auf den Feldweg zu werfen pflege.
Dem Museum fehlten damals Zeit und Mittel, um durch eine Grabung nähere Feststellungen zu
machen. Diese waren zunächst auch um so weniger notwendig, als die Stelle mitten auf freiem Felde
lag, also keinerlei Gefahr für eine Bebauung bestand. Wir begnügten uns deshalb mit einer Eintra-
gung in unsere Karten und der Vormerkung für eine spätere Untersuchung. Kennen wir doch auf
Stadtkölner Boden bereits einige Dutzend ähnlicher Stellen im Gelände, die alle noch der Unter-
suchung harren (vgl. Taf. 1).
Im Januar 1926 ward uns aber bekannt, die Stadtverwaltung plane hier zur Ergänzung der
Stadionanlagen die Errichtung einer etwa 300x400 m großen Spiel- und Aufmarschwiese1); das
Gelände solle wesentlich (bis zu 1,50 m) tiefer gelegt und die so gewonnenen Erdmassen zur Er-
richtung hoher Zuschauerränge verwandt werden. So mußten wir in aller Eile die Vorbereitung für
eine eingehende wissenschaftliche Untersuchung treffen, um den Planierungsarbeiten zuvorzukommen.
Denn es unterlag keinem Zweifel, daß dabei die vorhandenen Siedelungsreste vollständig verschwinden
würden, ohne daß späterhin noch eine Untersuchung oder Nachprüfung möglich gewesen wäre.
Dank de» Interesse, das verschiedene städtische Dienststellen der Sache entgegenbrachten, konnte be-
reits am 8. März mit den Untersuchungen begonnen werden. Sie setzten zunächst mit unserem Aufseher
und 15 Arbeitslosen ein, die uns die Arbeitszentrale des Wohlfahrtsamtes kostenlos zur Verfügung
stellte. Gegen Ende März ward dieser Bestand auf das Doppelte gebracht und hielt sich dann das ganze
Jahr über mit kleinen Schwankungen auf dieser Höhe. Erst in der Woche vor Weihnachten fand die
Grabung mit dem Entleeren des einen Tiefbrunnens ihren Abschluß. Die bescheidenen uns zur Ver-
fügung stehenden Mittel für Ausgrabungen hätten nicht im entferntesten ausgereicht, die Ausgra-
bung auch nur teilweise durchzuführen. Daß wir nicht auf halber Strecke aufhören mußten, sondern
hier einmal wirklich ganze Arbeit leisten und die Untersuchung bis in die letzten Einzelheiten durch-
führen konnten, verdanken wir einmal der Hilfsbereitschaft des Herrn Oberbürgermeisters
Dr. Adenauer, der aus seinem Dispositionsfonds einen Sonderkredit zur Verfügung stellte, ferner
dem großen Interesse und wiederholt gezeigten Entgegenkommen des Dezernenten des Städt.
Wohlfahrtsamtes, Herrn Bürgermeister Dr. Schwering. Begünstigt wurden unsere Untersuchungen
ferner ganz wesentlich durch das ausnahmsweise günstige Wetter sowie durch den Umstand, daß die
Firma, der die Planierungsarbeiten zuerst übertragen waren, um Ostern ihren Betrieb einstellen
mußte. In der so entstandenen Pause von nahezu drei Wochen waren wir mit der Freilegung des
Herrenhauses so weit gediehen, daß wir mit Aussicht auf Erfolg dafür eintreten konnten, daß die
Abtragungsarbeiten bis zur Fertigstellung unserer Untersuchung vor ihm haltmachten.
D Sie wurde später Jahnwiese genannt.
Röm.-germ. Forschungen VI.
1