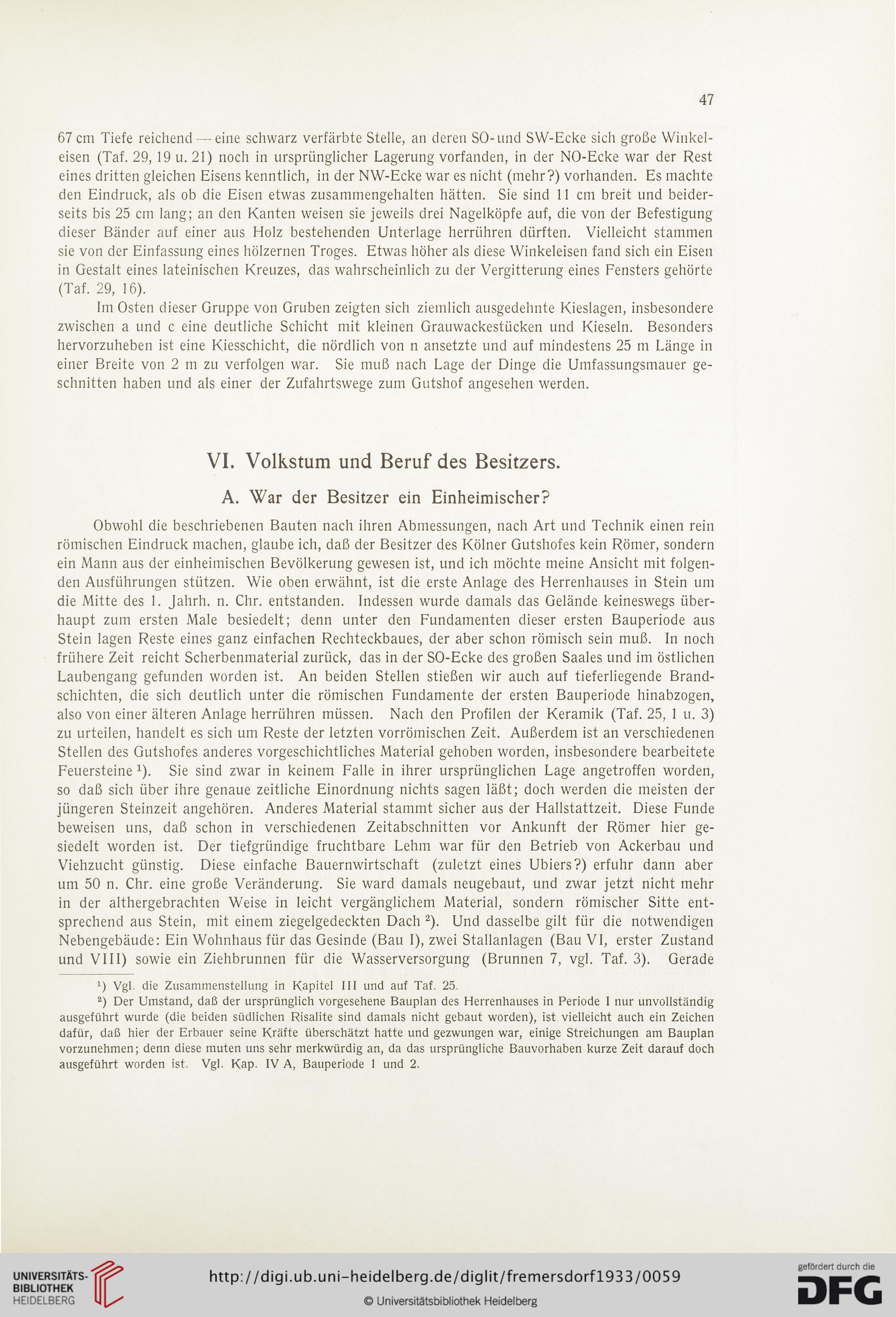47
67 cm Tiefe reichend — eine schwarz verfärbte Stelle, an deren SO-und SW-Ecke sich große Winkel-
eisen (Taf. 29,19 u. 21) noch in ursprünglicher Lagerung vorfanden, in der NO-Ecke war der Rest
eines dritten gleichen Eisens kenntlich, in der NW-Ecke war es nicht (mehr?) vorhanden. Es machte
den Eindruck, als ob die Eisen etwas zusammengehalten hätten. Sie sind 11 cm breit und beider-
seits bis 25 cm lang; an den Kanten weisen sie jeweils drei Nagelköpfe auf, die von der Befestigung
dieser Bänder auf einer aus Holz bestehenden Unterlage herrühren dürften. Vielleicht stammen
sie von der Einfassung eines hölzernen Troges. Etwas höher als diese Winkeleisen fand sich ein Eisen
in Gestalt eines lateinischen Kreuzes, das wahrscheinlich zu der Vergitterung eines Fensters gehörte
(Taf. 29, 16).
Im Osten dieser Gruppe von Gruben zeigten sich ziemlich ausgedehnte Kieslagen, insbesondere
zwischen a und c eine deutliche Schicht mit kleinen Grauwackestücken und Kieseln. Besonders
hervorzuheben ist eine Kiesschicht, die nördlich von n ansetzte und auf mindestens 25 m Länge in
einer Breite von 2 m zu verfolgen war. Sie muß nach Lage der Dinge die Umfassungsmauer ge-
schnitten haben und als einer der Zufahrtswege zum Gutshof angesehen werden.
VI. Volkstum und Beruf des Besitzers.
A. War der Besitzer ein Einheimischer?
Obwohl die beschriebenen Bauten nach ihren Abmessungen, nach Art und Technik einen rein
römischen Eindruck machen, glaube ich, daß der Besitzer des Kölner Gutshofes kein Römer, sondern
ein Mann aus der einheimischen Bevölkerung gewesen ist, und ich möchte meine Ansicht mit folgen-
den Ausführungen stützen. Wie oben erwähnt, ist die erste Anlage des Herrenhauses in Stein um
die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. entstanden. Indessen wurde damals das Gelände keineswegs über-
haupt zum ersten Male besiedelt; denn unter den Fundamenten dieser ersten Bauperiode aus
Stein lagen Reste eines ganz einfachen Rechteckbaues, der aber schon römisch sein muß. In noch
frühere Zeit reicht Scherbenmaterial zurück, das in der SO-Ecke des großen Saales und im östlichen
Laubengang gefunden worden ist. An beiden Stellen stießen wir auch auf tieferliegende Brand-
schichten, die sich deutlich unter die römischen Fundamente der ersten Bauperiode hinabzogen,
also von einer älteren Anlage herrühren müssen. Nach den Profilen der Keramik (Taf. 25, 1 u. 3)
zu urteilen, handelt es sich um Reste der letzten vorrömischen Zeit. Außerdem ist an verschiedenen
Stellen des Gutshofes anderes vorgeschichtliches Material gehoben worden, insbesondere bearbeitete
Feuersteine J). Sie sind zwar in keinem Falle in ihrer ursprünglichen Lage angetroffen worden,
so daß sich über ihre genaue zeitliche Einordnung nichts sagen läßt; doch werden die meisten der
jüngeren Steinzeit angehören. Anderes Material stammt sicher aus der Hallstattzeit. Diese Funde
beweisen uns, daß schon in verschiedenen Zeitabschnitten vor Ankunft der Römer hier ge-
siedelt worden ist. Der tiefgründige fruchtbare Lehm war für den Betrieb von Ackerbau und
Viehzucht günstig. Diese einfache Bauernwirtschaft (zuletzt eines Ubiers?) erfuhr dann aber
um 50 n. Chr. eine große Veränderung. Sie ward damals neugebaut, und zwar jetzt nicht mehr
in der althergebrachten Weise in leicht vergänglichem Material, sondern römischer Sitte ent-
sprechend aus Stein, mit einem ziegelgedeckten Dach 1 2). Und dasselbe gilt für die notwendigen
Nebengebäude: Ein Wohnhaus für das Gesinde (Bau I), zwei Stallanlagen (Bau VI, erster Zustand
und VIII) sowie ein Ziehbrunnen für die Wasserversorgung (Brunnen 7, vgl. Taf. 3). Gerade
1) Vgl. die Zusammenstellung in Kapitel III und auf Taf. 25.
2) Der Umstand, daß der ursprünglich vorgesehene Bauplan des Herrenhauses in Periode I nur unvollständig
ausgeführt wurde (die beiden südlichen Risalite sind damals nicht gebaut worden), ist vielleicht auch ein Zeichen
dafür, daß hier der Erbauer seine Kräfte überschätzt hatte und gezwungen war, einige Streichungen am Bauplan
vorzunehmen; denn diese muten uns sehr merkwürdig an, da das ursprüngliche Bauvorhaben kurze Zeit darauf doch
ausgeführt worden ist. Vgl. Kap. IV A, Bauperiode 1 und 2.
67 cm Tiefe reichend — eine schwarz verfärbte Stelle, an deren SO-und SW-Ecke sich große Winkel-
eisen (Taf. 29,19 u. 21) noch in ursprünglicher Lagerung vorfanden, in der NO-Ecke war der Rest
eines dritten gleichen Eisens kenntlich, in der NW-Ecke war es nicht (mehr?) vorhanden. Es machte
den Eindruck, als ob die Eisen etwas zusammengehalten hätten. Sie sind 11 cm breit und beider-
seits bis 25 cm lang; an den Kanten weisen sie jeweils drei Nagelköpfe auf, die von der Befestigung
dieser Bänder auf einer aus Holz bestehenden Unterlage herrühren dürften. Vielleicht stammen
sie von der Einfassung eines hölzernen Troges. Etwas höher als diese Winkeleisen fand sich ein Eisen
in Gestalt eines lateinischen Kreuzes, das wahrscheinlich zu der Vergitterung eines Fensters gehörte
(Taf. 29, 16).
Im Osten dieser Gruppe von Gruben zeigten sich ziemlich ausgedehnte Kieslagen, insbesondere
zwischen a und c eine deutliche Schicht mit kleinen Grauwackestücken und Kieseln. Besonders
hervorzuheben ist eine Kiesschicht, die nördlich von n ansetzte und auf mindestens 25 m Länge in
einer Breite von 2 m zu verfolgen war. Sie muß nach Lage der Dinge die Umfassungsmauer ge-
schnitten haben und als einer der Zufahrtswege zum Gutshof angesehen werden.
VI. Volkstum und Beruf des Besitzers.
A. War der Besitzer ein Einheimischer?
Obwohl die beschriebenen Bauten nach ihren Abmessungen, nach Art und Technik einen rein
römischen Eindruck machen, glaube ich, daß der Besitzer des Kölner Gutshofes kein Römer, sondern
ein Mann aus der einheimischen Bevölkerung gewesen ist, und ich möchte meine Ansicht mit folgen-
den Ausführungen stützen. Wie oben erwähnt, ist die erste Anlage des Herrenhauses in Stein um
die Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. entstanden. Indessen wurde damals das Gelände keineswegs über-
haupt zum ersten Male besiedelt; denn unter den Fundamenten dieser ersten Bauperiode aus
Stein lagen Reste eines ganz einfachen Rechteckbaues, der aber schon römisch sein muß. In noch
frühere Zeit reicht Scherbenmaterial zurück, das in der SO-Ecke des großen Saales und im östlichen
Laubengang gefunden worden ist. An beiden Stellen stießen wir auch auf tieferliegende Brand-
schichten, die sich deutlich unter die römischen Fundamente der ersten Bauperiode hinabzogen,
also von einer älteren Anlage herrühren müssen. Nach den Profilen der Keramik (Taf. 25, 1 u. 3)
zu urteilen, handelt es sich um Reste der letzten vorrömischen Zeit. Außerdem ist an verschiedenen
Stellen des Gutshofes anderes vorgeschichtliches Material gehoben worden, insbesondere bearbeitete
Feuersteine J). Sie sind zwar in keinem Falle in ihrer ursprünglichen Lage angetroffen worden,
so daß sich über ihre genaue zeitliche Einordnung nichts sagen läßt; doch werden die meisten der
jüngeren Steinzeit angehören. Anderes Material stammt sicher aus der Hallstattzeit. Diese Funde
beweisen uns, daß schon in verschiedenen Zeitabschnitten vor Ankunft der Römer hier ge-
siedelt worden ist. Der tiefgründige fruchtbare Lehm war für den Betrieb von Ackerbau und
Viehzucht günstig. Diese einfache Bauernwirtschaft (zuletzt eines Ubiers?) erfuhr dann aber
um 50 n. Chr. eine große Veränderung. Sie ward damals neugebaut, und zwar jetzt nicht mehr
in der althergebrachten Weise in leicht vergänglichem Material, sondern römischer Sitte ent-
sprechend aus Stein, mit einem ziegelgedeckten Dach 1 2). Und dasselbe gilt für die notwendigen
Nebengebäude: Ein Wohnhaus für das Gesinde (Bau I), zwei Stallanlagen (Bau VI, erster Zustand
und VIII) sowie ein Ziehbrunnen für die Wasserversorgung (Brunnen 7, vgl. Taf. 3). Gerade
1) Vgl. die Zusammenstellung in Kapitel III und auf Taf. 25.
2) Der Umstand, daß der ursprünglich vorgesehene Bauplan des Herrenhauses in Periode I nur unvollständig
ausgeführt wurde (die beiden südlichen Risalite sind damals nicht gebaut worden), ist vielleicht auch ein Zeichen
dafür, daß hier der Erbauer seine Kräfte überschätzt hatte und gezwungen war, einige Streichungen am Bauplan
vorzunehmen; denn diese muten uns sehr merkwürdig an, da das ursprüngliche Bauvorhaben kurze Zeit darauf doch
ausgeführt worden ist. Vgl. Kap. IV A, Bauperiode 1 und 2.