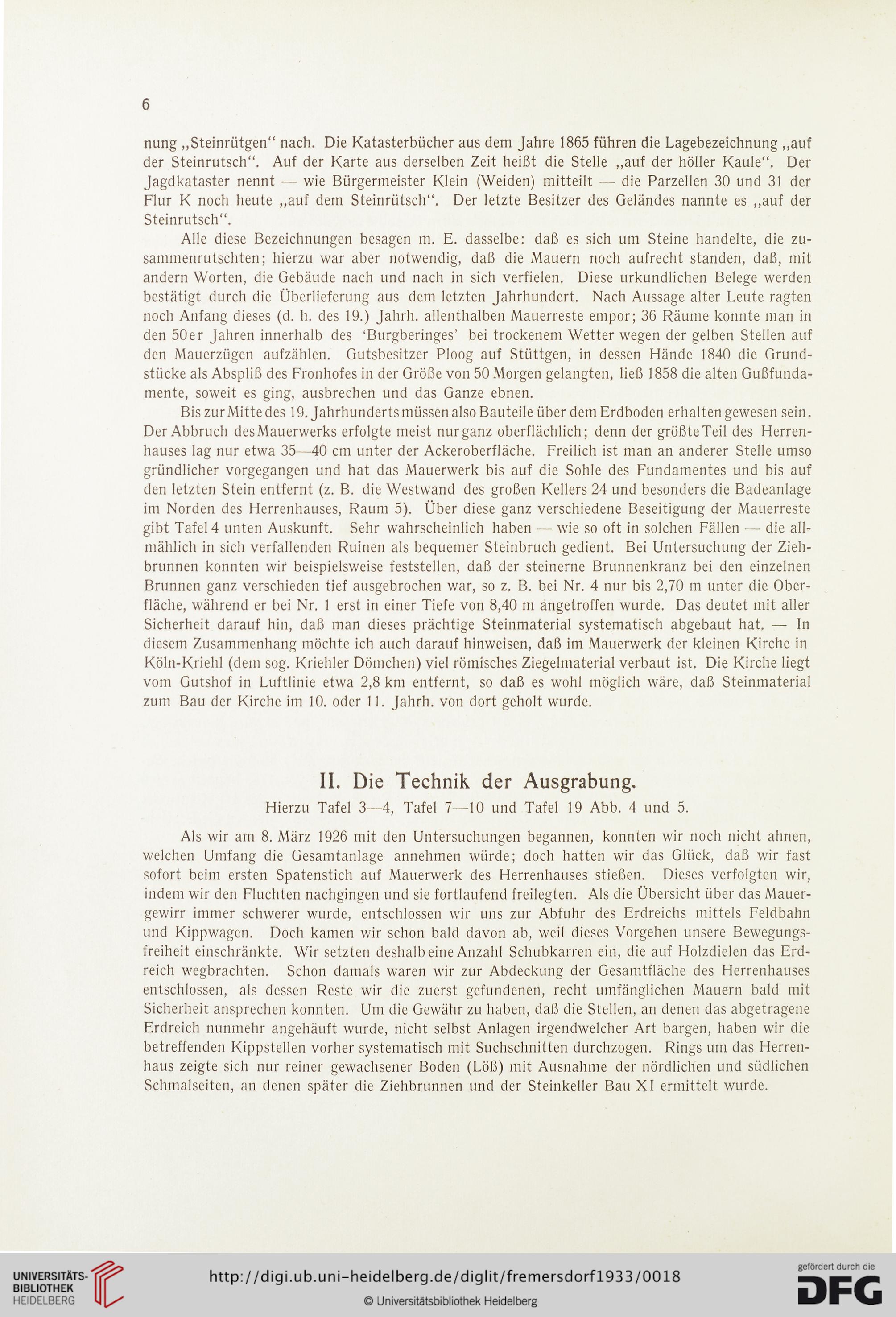6
nung „Steinrütgen“ nach. Die Katasterbücher aus dem Jahre 1865 führen die Lagebezeichnung ,,auf
der Steinrutsch“. Auf der Karte aus derselben Zeit heißt die Stelle „auf der holler Kaule“. Der
Jagdkataster nennt — wie Bürgermeister Klein (Weiden) mitteilt — die Parzellen 30 und 31 der
Flur K noch heute „auf dem Steinrütsch“. Der letzte Besitzer des Geländes nannte es „auf der
Steinrutsch“.
Alle diese Bezeichnungen besagen m. E. dasselbe: daß es sich um Steine handelte, die zu-
sammenrutschten; hierzu war aber notwendig, daß die Mauern noch aufrecht standen, daß, mit
andern Worten, die Gebäude nach und nach in sich verfielen. Diese urkundlichen Belege werden
bestätigt durch die Überlieferung aus dem letzten Jahrhundert. Nach Aussage alter Leute ragten
noch Anfang dieses (d. h. des 19.) Jahrh. allenthalben Mauerreste empor; 36 Räume konnte man in
den 50er Jahren innerhalb des ‘Burgberinges’ bei trockenem Wetter wegen der gelben Stellen auf
den Mauerzügen aufzählen. Gutsbesitzer Ploog auf Stüttgen, in dessen Hände 1840 die Grund-
stücke als Abspliß des Fronhofes in der Größe von 50 Morgen gelangten, ließ 1858 die alten Gußfunda-
mente, soweit es ging, ausbrechen und das Ganze ebnen.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts müssen also Bauteile über dem Erdboden erhalten gewesen sein.
Der Abbruch des Mauerwerks erfolgte meist nur ganz oberflächlich; denn der größte Teil des Herren-
hauses lag nur etwa 35—40 cm unter der Ackeroberfläche. Freilich ist man an anderer Stelle umso
gründlicher vorgegangen und hat das Mauerwerk bis auf die Sohle des Fundamentes und bis auf
den letzten Stein entfernt (z. B. die Westwand des großen Kellers 24 und besonders die Badeanlage
im Norden des Herrenhauses, Raum 5). Über diese ganz verschiedene Beseitigung der Mauerreste
gibt Tafel 4 unten Auskunft. Sehr wahrscheinlich haben — wie so oft in solchen Fällen — die all-
mählich in sich verfallenden Ruinen als bequemer Steinbruch gedient. Bei Untersuchung der Zieh-
brunnen konnten wir beispielsweise feststellen, daß der steinerne Brunnenkranz bei den einzelnen
Brunnen ganz verschieden tief ausgebrochen war, so z. B. bei Nr. 4 nur bis 2,70 m unter die Ober-
fläche, während er bei Nr. 1 erst in einer Tiefe von 8,40 m angetroffen wurde. Das deutet mit aller
Sicherheit darauf hin, daß man dieses prächtige Steinmaterial systematisch abgebaut hat. — In
diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, daß im Mauerwerk der kleinen Kirche in
Köln-Kriehl (dem sog. Kriehler Dörnchen) viel römisches Ziegelmaterial verbaut ist. Die Kirche liegt
vom Gutshof in Luftlinie etwa 2,8 km entfernt, so daß es wohl möglich wäre, daß Steinmaterial
zum Bau der Kirche im 10. oder 11. Jahrh. von dort geholt wurde.
II. Die Technik der Ausgrabung.
Hierzu Tafel 3—4, Tafel 7—10 und Tafel 19 Abb. 4 und 5.
Als wir am 8. März 1926 mit den Untersuchungen begannen, konnten wir noch nicht ahnen,
welchen Umfang die Gesamtanlage annehmen würde; doch hatten wir das Glück, daß wir fast
sofort beim ersten Spatenstich auf Mauerwerk des Herrenhauses stießen. Dieses verfolgten wir,
indem wir den Fluchten nachgingen und sie fortlaufend freilegten. Als die Übersicht über das Mauer-
gewirr immer schwerer wurde, entschlossen wir uns zur Abfuhr des Erdreichs mittels Feldbahn
und Kippwagen. Doch kamen wir schon bald davon ab, weil dieses Vorgehen unsere Bewegungs-
freiheit einschränkte. Wir setzten deshalb eine Anzahl Schubkarren ein, die auf Holzdielen das Erd-
reich wegbrachten. Schon damals waren wir zur Abdeckung der Gesamtfläche des Herrenhauses
entschlossen, als dessen Reste wir die zuerst gefundenen, recht umfänglichen Mauern bald mit
Sicherheit ansprechen konnten. Um die Gewähr zu haben, daß die Stellen, an denen das abgetragene
Erdreich nunmehr angehäuft wurde, nicht selbst Anlagen irgendwelcher Art bargen, haben wir die
betreffenden Kippstellen vorher systematisch mit Suchschnitten durchzogen. Rings um das Herren-
haus zeigte sich nur reiner gewachsener Boden (Löß) mit Ausnahme der nördlichen und südlichen
Schmalseiten, an denen später die Ziehbrunnen und der Steinkeller Bau XI ermittelt wurde.
nung „Steinrütgen“ nach. Die Katasterbücher aus dem Jahre 1865 führen die Lagebezeichnung ,,auf
der Steinrutsch“. Auf der Karte aus derselben Zeit heißt die Stelle „auf der holler Kaule“. Der
Jagdkataster nennt — wie Bürgermeister Klein (Weiden) mitteilt — die Parzellen 30 und 31 der
Flur K noch heute „auf dem Steinrütsch“. Der letzte Besitzer des Geländes nannte es „auf der
Steinrutsch“.
Alle diese Bezeichnungen besagen m. E. dasselbe: daß es sich um Steine handelte, die zu-
sammenrutschten; hierzu war aber notwendig, daß die Mauern noch aufrecht standen, daß, mit
andern Worten, die Gebäude nach und nach in sich verfielen. Diese urkundlichen Belege werden
bestätigt durch die Überlieferung aus dem letzten Jahrhundert. Nach Aussage alter Leute ragten
noch Anfang dieses (d. h. des 19.) Jahrh. allenthalben Mauerreste empor; 36 Räume konnte man in
den 50er Jahren innerhalb des ‘Burgberinges’ bei trockenem Wetter wegen der gelben Stellen auf
den Mauerzügen aufzählen. Gutsbesitzer Ploog auf Stüttgen, in dessen Hände 1840 die Grund-
stücke als Abspliß des Fronhofes in der Größe von 50 Morgen gelangten, ließ 1858 die alten Gußfunda-
mente, soweit es ging, ausbrechen und das Ganze ebnen.
Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts müssen also Bauteile über dem Erdboden erhalten gewesen sein.
Der Abbruch des Mauerwerks erfolgte meist nur ganz oberflächlich; denn der größte Teil des Herren-
hauses lag nur etwa 35—40 cm unter der Ackeroberfläche. Freilich ist man an anderer Stelle umso
gründlicher vorgegangen und hat das Mauerwerk bis auf die Sohle des Fundamentes und bis auf
den letzten Stein entfernt (z. B. die Westwand des großen Kellers 24 und besonders die Badeanlage
im Norden des Herrenhauses, Raum 5). Über diese ganz verschiedene Beseitigung der Mauerreste
gibt Tafel 4 unten Auskunft. Sehr wahrscheinlich haben — wie so oft in solchen Fällen — die all-
mählich in sich verfallenden Ruinen als bequemer Steinbruch gedient. Bei Untersuchung der Zieh-
brunnen konnten wir beispielsweise feststellen, daß der steinerne Brunnenkranz bei den einzelnen
Brunnen ganz verschieden tief ausgebrochen war, so z. B. bei Nr. 4 nur bis 2,70 m unter die Ober-
fläche, während er bei Nr. 1 erst in einer Tiefe von 8,40 m angetroffen wurde. Das deutet mit aller
Sicherheit darauf hin, daß man dieses prächtige Steinmaterial systematisch abgebaut hat. — In
diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, daß im Mauerwerk der kleinen Kirche in
Köln-Kriehl (dem sog. Kriehler Dörnchen) viel römisches Ziegelmaterial verbaut ist. Die Kirche liegt
vom Gutshof in Luftlinie etwa 2,8 km entfernt, so daß es wohl möglich wäre, daß Steinmaterial
zum Bau der Kirche im 10. oder 11. Jahrh. von dort geholt wurde.
II. Die Technik der Ausgrabung.
Hierzu Tafel 3—4, Tafel 7—10 und Tafel 19 Abb. 4 und 5.
Als wir am 8. März 1926 mit den Untersuchungen begannen, konnten wir noch nicht ahnen,
welchen Umfang die Gesamtanlage annehmen würde; doch hatten wir das Glück, daß wir fast
sofort beim ersten Spatenstich auf Mauerwerk des Herrenhauses stießen. Dieses verfolgten wir,
indem wir den Fluchten nachgingen und sie fortlaufend freilegten. Als die Übersicht über das Mauer-
gewirr immer schwerer wurde, entschlossen wir uns zur Abfuhr des Erdreichs mittels Feldbahn
und Kippwagen. Doch kamen wir schon bald davon ab, weil dieses Vorgehen unsere Bewegungs-
freiheit einschränkte. Wir setzten deshalb eine Anzahl Schubkarren ein, die auf Holzdielen das Erd-
reich wegbrachten. Schon damals waren wir zur Abdeckung der Gesamtfläche des Herrenhauses
entschlossen, als dessen Reste wir die zuerst gefundenen, recht umfänglichen Mauern bald mit
Sicherheit ansprechen konnten. Um die Gewähr zu haben, daß die Stellen, an denen das abgetragene
Erdreich nunmehr angehäuft wurde, nicht selbst Anlagen irgendwelcher Art bargen, haben wir die
betreffenden Kippstellen vorher systematisch mit Suchschnitten durchzogen. Rings um das Herren-
haus zeigte sich nur reiner gewachsener Boden (Löß) mit Ausnahme der nördlichen und südlichen
Schmalseiten, an denen später die Ziehbrunnen und der Steinkeller Bau XI ermittelt wurde.