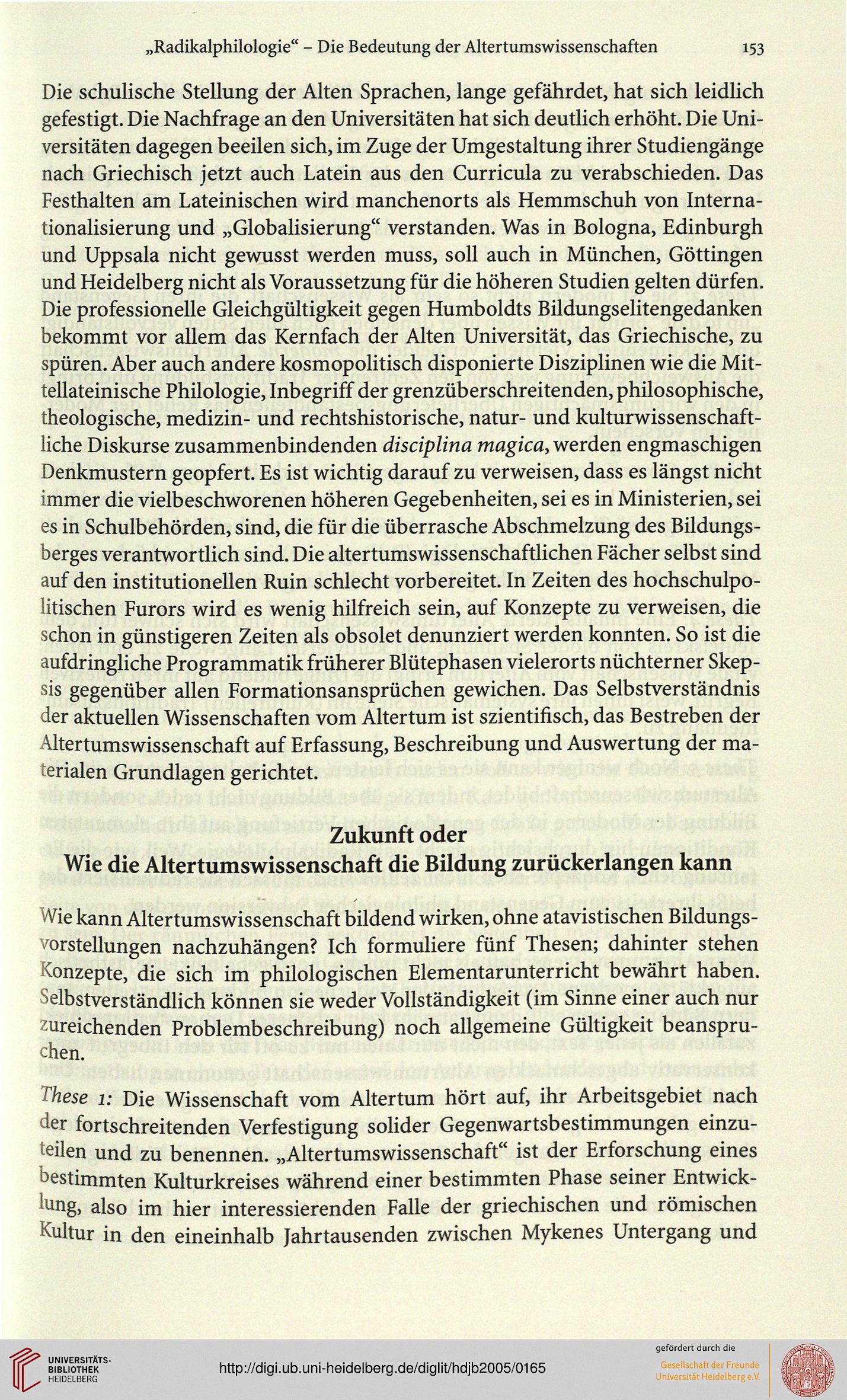„Radikalphilologie" - Die Bedeutung der Altertumswissenschaften 153
Die schulische Stellung der Alten Sprachen, lange gefährdet, hat sich leidlich
gefestigt. Die Nachfrage an den Universitäten hat sich deutlich erhöht. Die Uni-
versitäten dagegen beeilen sich, im Zuge der Umgestaltung ihrer Studiengänge
nach Griechisch jetzt auch Latein aus den Curricula zu verabschieden. Das
Festhalten am Lateinischen wird manchenorts als Hemmschuh von Interna-
tionalisierung und „Globalisierung" verstanden. Was in Bologna, Edinburgh
und Uppsala nicht gewusst werden muss, soll auch in München, Göttingen
und Heidelberg nicht als Voraussetzung für die höheren Studien gelten dürfen.
Die professionelle Gleichgültigkeit gegen Humboldts Bildungselitengedanken
bekommt vor allem das Kernfach der Alten Universität, das Griechische, zu
spüren. Aber auch andere kosmopolitisch disponierte Disziplinen wie die Mit-
tellateinische Philologie, Inbegriff der grenzüberschreitenden, philosophische,
theologische, medizin- und rechtshistorische, natur- und kulturwissenschaft-
liche Diskurse zusammenbindenden disciplina magica, werden engmaschigen
Denkmustern geopfert. Es ist wichtig darauf zu verweisen, dass es längst nicht
immer die vielbeschworenen höheren Gegebenheiten, sei es in Ministerien, sei
es in Schulbehörden, sind, die für die überrasche Abschmelzung des Bildungs-
berges verantwortlich sind. Die altertumswissenschaftlichen Fächer selbst sind
auf den institutionellen Ruin schlecht vorbereitet. In Zeiten des hochschulpo-
litischen Furors wird es wenig hilfreich sein, auf Konzepte zu verweisen, die
schon in günstigeren Zeiten als obsolet denunziert werden konnten. So ist die
aufdringliche Programmatik früherer Blütephasen vielerorts nüchterner Skep-
sis gegenüber allen Formationsansprüchen gewichen. Das Selbstverständnis
der aktuellen Wissenschaften vom Altertum ist szientifisch, das Bestreben der
Altertumswissenschaft auf Erfassung, Beschreibung und Auswertung der ma-
terialen Grundlagen gerichtet.
Zukunft oder
Wie die Altertumswissenschaft die Bildung zurückerlangen kann
Wie kann Altertumswissenschaft bildend wirken, ohne atavistischen Bildungs-
vorstellungen nachzuhängen? Ich formuliere fünf Thesen; dahinter stehen
Konzepte, die sich im philologischen Elementarunterricht bewährt haben.
Selbstverständlich können sie weder Vollständigkeit (im Sinne einer auch nur
zureichenden Problembeschreibung) noch allgemeine Gültigkeit beanspru-
chen.
These 1: Die Wissenschaft vom Altertum hört auf, ihr Arbeitsgebiet nach
der fortschreitenden Verfestigung solider Gegenwartsbestimmungen einzu-
teilen und zu benennen. „Altertumswissenschaft" ist der Erforschung eines
bestimmten Kulturkreises während einer bestimmten Phase seiner Entwick-
lung, also im hier interessierenden Falle der griechischen und römischen
Kultur in den eineinhalb Jahrtausenden zwischen Mykenes Untergang und
Die schulische Stellung der Alten Sprachen, lange gefährdet, hat sich leidlich
gefestigt. Die Nachfrage an den Universitäten hat sich deutlich erhöht. Die Uni-
versitäten dagegen beeilen sich, im Zuge der Umgestaltung ihrer Studiengänge
nach Griechisch jetzt auch Latein aus den Curricula zu verabschieden. Das
Festhalten am Lateinischen wird manchenorts als Hemmschuh von Interna-
tionalisierung und „Globalisierung" verstanden. Was in Bologna, Edinburgh
und Uppsala nicht gewusst werden muss, soll auch in München, Göttingen
und Heidelberg nicht als Voraussetzung für die höheren Studien gelten dürfen.
Die professionelle Gleichgültigkeit gegen Humboldts Bildungselitengedanken
bekommt vor allem das Kernfach der Alten Universität, das Griechische, zu
spüren. Aber auch andere kosmopolitisch disponierte Disziplinen wie die Mit-
tellateinische Philologie, Inbegriff der grenzüberschreitenden, philosophische,
theologische, medizin- und rechtshistorische, natur- und kulturwissenschaft-
liche Diskurse zusammenbindenden disciplina magica, werden engmaschigen
Denkmustern geopfert. Es ist wichtig darauf zu verweisen, dass es längst nicht
immer die vielbeschworenen höheren Gegebenheiten, sei es in Ministerien, sei
es in Schulbehörden, sind, die für die überrasche Abschmelzung des Bildungs-
berges verantwortlich sind. Die altertumswissenschaftlichen Fächer selbst sind
auf den institutionellen Ruin schlecht vorbereitet. In Zeiten des hochschulpo-
litischen Furors wird es wenig hilfreich sein, auf Konzepte zu verweisen, die
schon in günstigeren Zeiten als obsolet denunziert werden konnten. So ist die
aufdringliche Programmatik früherer Blütephasen vielerorts nüchterner Skep-
sis gegenüber allen Formationsansprüchen gewichen. Das Selbstverständnis
der aktuellen Wissenschaften vom Altertum ist szientifisch, das Bestreben der
Altertumswissenschaft auf Erfassung, Beschreibung und Auswertung der ma-
terialen Grundlagen gerichtet.
Zukunft oder
Wie die Altertumswissenschaft die Bildung zurückerlangen kann
Wie kann Altertumswissenschaft bildend wirken, ohne atavistischen Bildungs-
vorstellungen nachzuhängen? Ich formuliere fünf Thesen; dahinter stehen
Konzepte, die sich im philologischen Elementarunterricht bewährt haben.
Selbstverständlich können sie weder Vollständigkeit (im Sinne einer auch nur
zureichenden Problembeschreibung) noch allgemeine Gültigkeit beanspru-
chen.
These 1: Die Wissenschaft vom Altertum hört auf, ihr Arbeitsgebiet nach
der fortschreitenden Verfestigung solider Gegenwartsbestimmungen einzu-
teilen und zu benennen. „Altertumswissenschaft" ist der Erforschung eines
bestimmten Kulturkreises während einer bestimmten Phase seiner Entwick-
lung, also im hier interessierenden Falle der griechischen und römischen
Kultur in den eineinhalb Jahrtausenden zwischen Mykenes Untergang und