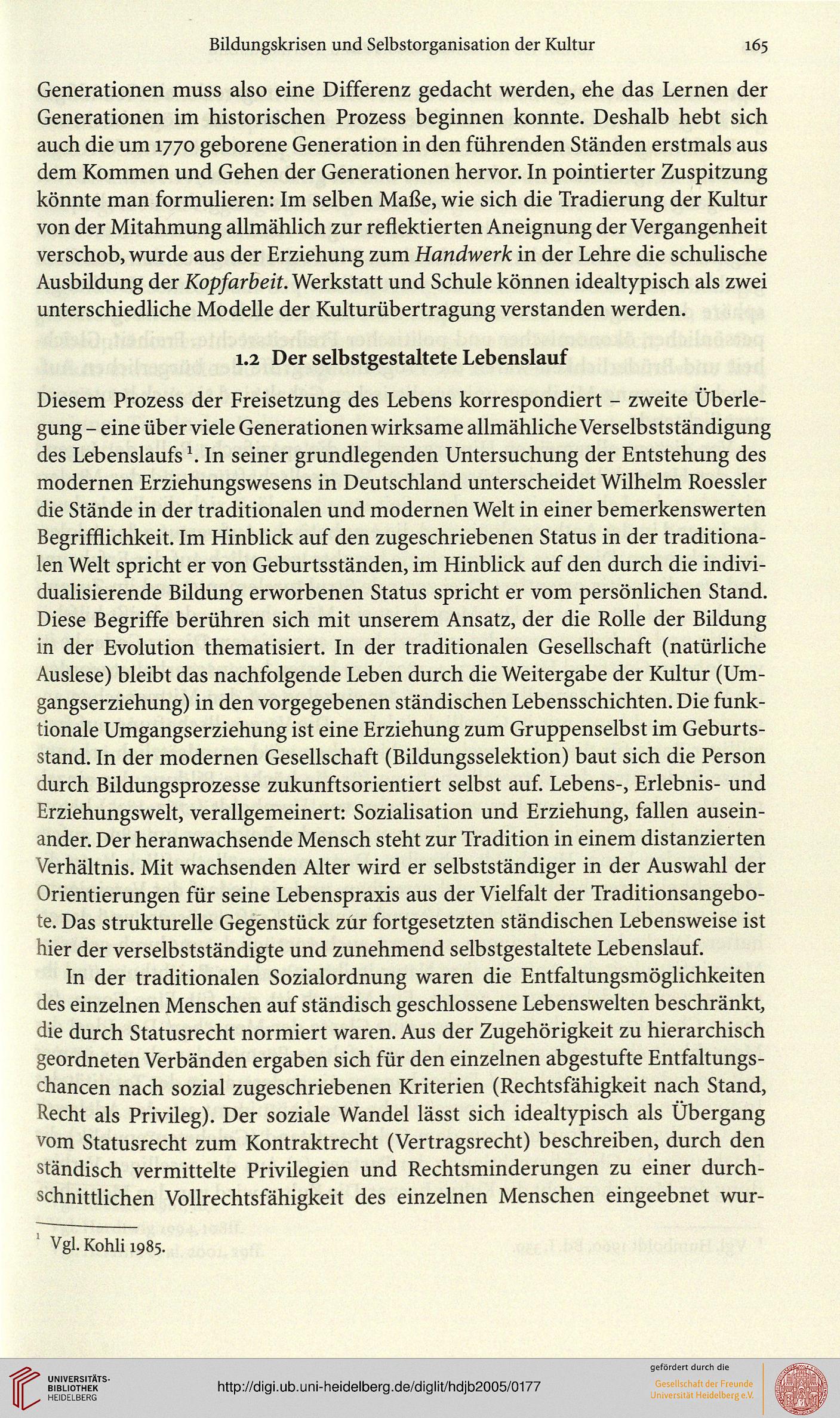Bildungskrisen und Selbstorganisation der Kultur 165
Generationen muss also eine Differenz gedacht werden, ehe das Lernen der
Generationen im historischen Prozess beginnen konnte. Deshalb hebt sich
auch die um 1770 geborene Generation in den führenden Ständen erstmals aus
dem Kommen und Gehen der Generationen hervor. In pointierter Zuspitzung
könnte man formulieren: Im selben Maße, wie sich die Tradierung der Kultur
von der Mitahmung allmählich zur reflektierten Aneignung der Vergangenheit
verschob, wurde aus der Erziehung zum Handwerk in der Lehre die schulische
Ausbildung der Kopfarbeit. Werkstatt und Schule können idealtypisch als zwei
unterschiedliche Modelle der Kulturübertragung verstanden werden.
1.2 Der selbstgestaltete Lebenslauf
Diesem Prozess der Freisetzung des Lebens korrespondiert - zweite Überle-
gung - eine über viele Generationen wirksame allmähliche Verselbstständigung
des Lebenslaufs \ In seiner grundlegenden Untersuchung der Entstehung des
modernen Erziehungswesens in Deutschland unterscheidet Wilhelm Roessler
die Stände in der traditionalen und modernen Welt in einer bemerkenswerten
Begrifflichkeit. Im Hinblick auf den zugeschriebenen Status in der traditiona-
len Welt spricht er von Geburtsständen, im Hinblick auf den durch die indivi-
dualisierende Bildung erworbenen Status spricht er vom persönlichen Stand.
Diese Begriffe berühren sich mit unserem Ansatz, der die Rolle der Bildung
in der Evolution thematisiert. In der traditionalen Gesellschaft (natürliche
Auslese) bleibt das nachfolgende Leben durch die Weitergabe der Kultur (Um-
gangserziehung) in den vorgegebenen ständischen Lebensschichten. Die funk-
tionale Umgangserziehung ist eine Erziehung zum Gruppenselbst im Geburts-
stand. In der modernen Gesellschaft (Bildungsselektion) baut sich die Person
durch Bildungsprozesse zukunftsorientiert selbst auf. Lebens-, Erlebnis- und
Erziehungswelt, verallgemeinert: Sozialisation und Erziehung, fallen ausein-
ander. Der heranwachsende Mensch steht zur Tradition in einem distanzierten
Verhältnis. Mit wachsenden Alter wird er selbstständiger in der Auswahl der
Orientierungen für seine Lebenspraxis aus der Vielfalt der Traditionsangebo-
te. Das strukturelle Gegenstück zur fortgesetzten ständischen Lebensweise ist
hier der verselbstständigte und zunehmend selbstgestaltete Lebenslauf.
In der traditionalen Sozialordnung waren die Entfaltungsmöglichkeiten
des einzelnen Menschen aufständisch geschlossene Lebenswelten beschränkt,
die durch Statusrecht normiert waren. Aus der Zugehörigkeit zu hierarchisch
geordneten Verbänden ergaben sich für den einzelnen abgestufte Entfaltungs-
chancen nach sozial zugeschriebenen Kriterien (Rechtsfähigkeit nach Stand,
Recht als Privileg). Der soziale Wandel lässt sich idealtypisch als Übergang
vom Statusrecht zum Kontraktrecht (Vertragsrecht) beschreiben, durch den
ständisch vermittelte Privilegien und Rechtsminderungen zu einer durch-
schnittlichen Vollrechtsfähigkeit des einzelnen Menschen eingeebnet wur-
' Vgl. Kohli 1985.
Generationen muss also eine Differenz gedacht werden, ehe das Lernen der
Generationen im historischen Prozess beginnen konnte. Deshalb hebt sich
auch die um 1770 geborene Generation in den führenden Ständen erstmals aus
dem Kommen und Gehen der Generationen hervor. In pointierter Zuspitzung
könnte man formulieren: Im selben Maße, wie sich die Tradierung der Kultur
von der Mitahmung allmählich zur reflektierten Aneignung der Vergangenheit
verschob, wurde aus der Erziehung zum Handwerk in der Lehre die schulische
Ausbildung der Kopfarbeit. Werkstatt und Schule können idealtypisch als zwei
unterschiedliche Modelle der Kulturübertragung verstanden werden.
1.2 Der selbstgestaltete Lebenslauf
Diesem Prozess der Freisetzung des Lebens korrespondiert - zweite Überle-
gung - eine über viele Generationen wirksame allmähliche Verselbstständigung
des Lebenslaufs \ In seiner grundlegenden Untersuchung der Entstehung des
modernen Erziehungswesens in Deutschland unterscheidet Wilhelm Roessler
die Stände in der traditionalen und modernen Welt in einer bemerkenswerten
Begrifflichkeit. Im Hinblick auf den zugeschriebenen Status in der traditiona-
len Welt spricht er von Geburtsständen, im Hinblick auf den durch die indivi-
dualisierende Bildung erworbenen Status spricht er vom persönlichen Stand.
Diese Begriffe berühren sich mit unserem Ansatz, der die Rolle der Bildung
in der Evolution thematisiert. In der traditionalen Gesellschaft (natürliche
Auslese) bleibt das nachfolgende Leben durch die Weitergabe der Kultur (Um-
gangserziehung) in den vorgegebenen ständischen Lebensschichten. Die funk-
tionale Umgangserziehung ist eine Erziehung zum Gruppenselbst im Geburts-
stand. In der modernen Gesellschaft (Bildungsselektion) baut sich die Person
durch Bildungsprozesse zukunftsorientiert selbst auf. Lebens-, Erlebnis- und
Erziehungswelt, verallgemeinert: Sozialisation und Erziehung, fallen ausein-
ander. Der heranwachsende Mensch steht zur Tradition in einem distanzierten
Verhältnis. Mit wachsenden Alter wird er selbstständiger in der Auswahl der
Orientierungen für seine Lebenspraxis aus der Vielfalt der Traditionsangebo-
te. Das strukturelle Gegenstück zur fortgesetzten ständischen Lebensweise ist
hier der verselbstständigte und zunehmend selbstgestaltete Lebenslauf.
In der traditionalen Sozialordnung waren die Entfaltungsmöglichkeiten
des einzelnen Menschen aufständisch geschlossene Lebenswelten beschränkt,
die durch Statusrecht normiert waren. Aus der Zugehörigkeit zu hierarchisch
geordneten Verbänden ergaben sich für den einzelnen abgestufte Entfaltungs-
chancen nach sozial zugeschriebenen Kriterien (Rechtsfähigkeit nach Stand,
Recht als Privileg). Der soziale Wandel lässt sich idealtypisch als Übergang
vom Statusrecht zum Kontraktrecht (Vertragsrecht) beschreiben, durch den
ständisch vermittelte Privilegien und Rechtsminderungen zu einer durch-
schnittlichen Vollrechtsfähigkeit des einzelnen Menschen eingeebnet wur-
' Vgl. Kohli 1985.