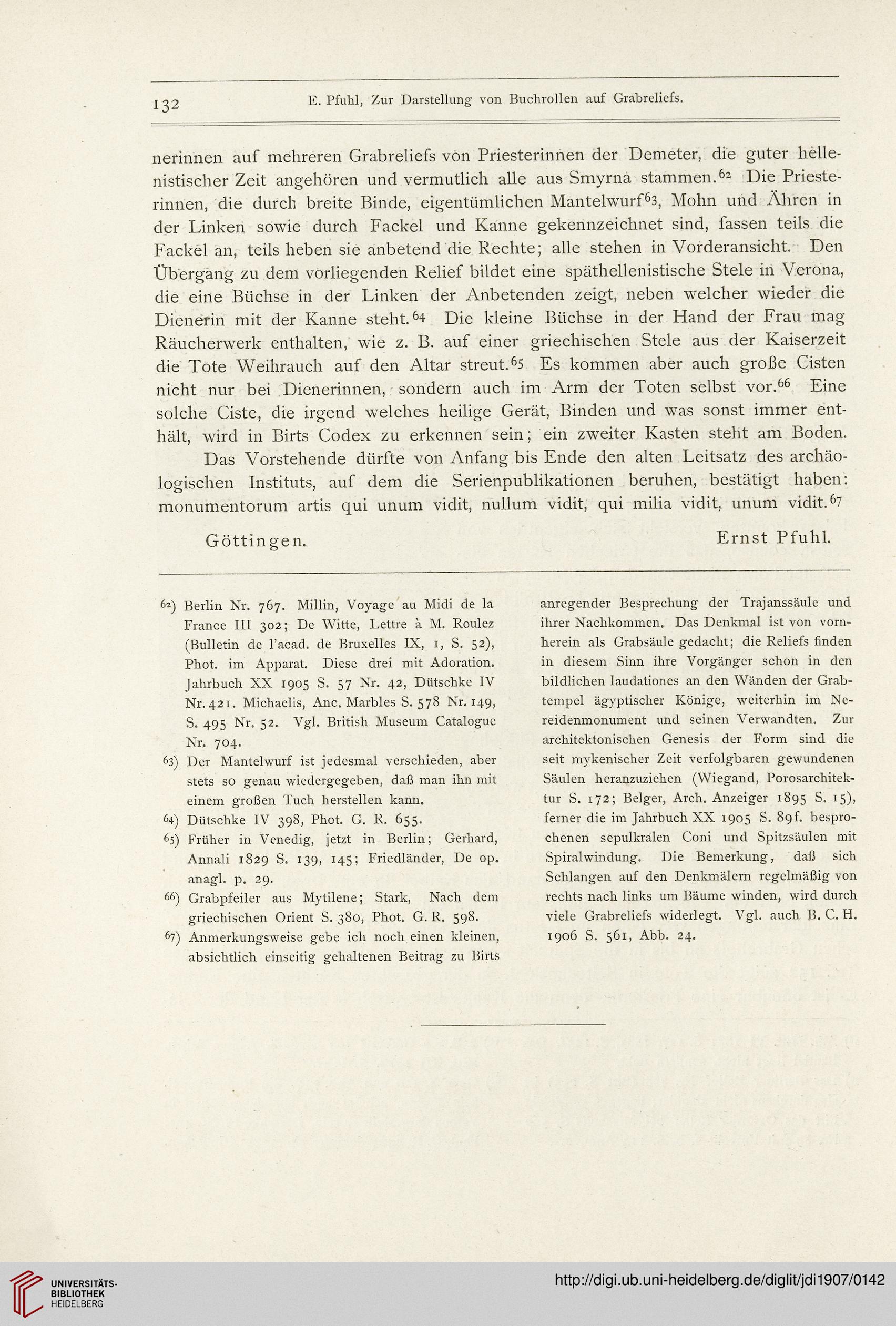E. Pfuhl, Zur Darstellung von Buchrollen auf Grabreliefs.
nerinnen auf mehreren Grabreliefs von Priesterinnen der Demeter, die guter helle-
nistischer Zeit angehören und vermutlich alle aus Smyrna stammen.61 62 * * *· Die Prieste-
rinnen, die durch breite Binde, eigentümlichen Mantelwurf63, Mohn und Ähren in
der Linken sowie durch Fackel und Kanne gekennzeichnet sind, fassen teils die
Fackel an, teils heben sie anbetend die Rechte; alle stehen in Vorderansicht. Den
Übergang zu dem vorliegenden Relief bildet eine späthellenistische Stele in Verona,
die eine Büchse in der Linken der Anbetenden zeigt, neben welcher wieder die
Dienerin mit der Kanne steht. 64 Die kleine Büchse in der Hand der Frau mag
Räucherwerk enthalten, wie z. B. auf einer griechischen Stele aus der Kaiserzeit
die Tote Weihrauch auf den Altar streut. 65 Es kommen aber auch große Cisten
nicht nur bei Dienerinnen, sondern auch im Arm der Toten selbst vor.66 Eine
solche Ciste, die irgend welches heilige Gerät, Binden und was sonst immer ent-
hält, wird in Birts Codex zu erkennen sein; ein zweiter Kasten steht am Boden.
Das Vorstehende dürfte von Anfang bis Ende den alten Leitsatz des archäo-
logischen Instituts, auf dem die Serienpublikationen beruhen, bestätigt haben:
monumentorum artis qui unum vidit, nullum vidit, qui milia vidit, unum vidit.67
Göttingen. Ernst Pfuhl.
61) Berlin Nr. 767. Millin, Voyage au Midi de la
France III 302; De Witte, Lettre ä Μ. Roulez
(Bulletin de l’acad. de Bruxelles IX, 1, S. 52),
Phot, im Apparat. Diese drei mit Adoration.
Jahrbuch XX 1905 S. 57 Nr. 42, Dütschke IV
Nr. 421. Michaelis, Anc. Marbles S. 578 Nr. 149,
S. 495 Nr. 52. Vgl. British Museum Catalogue
Nr. 704.
63) Der Mantelwurf ist jedesmal verschieden, aber
stets so genau wiedergegeben, daß man ihn mit
einem großen Tuch herstellen kann.
64) Dütschke IV 398, Phot. G. R. 655.
65) Früher in Venedig, jetzt in Berlin; Gerhard,
Annali 1829 S. 139, 145; Friedländer, De op.
anagl. p. 29.
66) Grabpfeiler aus Mytilene; Stark, Nach dem
griechischen Orient S. 380, Phot. G. R. 598.
67) Anmerkungsweise gebe ich noch einen kleinen,
absichtlich einseitig gehaltenen Beitrag zu Birts
anregender Besprechung der Trajanssäule und
ihrer Nachkommen. Das Denkmal ist von vorn-
herein als Grabsäule gedacht; die Reliefs finden
in diesem Sinn ihre Vorgänger schon in den
bildlichen laudationes an den Wänden der Grab-
tempel ägyptischer Könige, weiterhin im Ne-
reidenmonument und seinen Verwandten. Zur
architektonischen Genesis der Form sind die
seit mykenischer Zeit verfolgbaren gewundenen
Säulen heranzuziehen (Wiegand, Porosarchitek-
tur S. 172; Belger, Arch. Anzeiger 1895 S. 15),
ferner die im Jahrbuch XX 1905 S. 89 f. bespro-
chenen sepulkralen Coni und Spitzsäulen mit
Spiralwindung. Die Bemerkung, daß sich
Schlangen auf den Denkmälern regelmäßig von
rechts nach links um Bäume winden, wird durch
viele Grabreliefs widerlegt. Vgl. auch B. C. H.
1906 S. 561, Abb. 24.
nerinnen auf mehreren Grabreliefs von Priesterinnen der Demeter, die guter helle-
nistischer Zeit angehören und vermutlich alle aus Smyrna stammen.61 62 * * *· Die Prieste-
rinnen, die durch breite Binde, eigentümlichen Mantelwurf63, Mohn und Ähren in
der Linken sowie durch Fackel und Kanne gekennzeichnet sind, fassen teils die
Fackel an, teils heben sie anbetend die Rechte; alle stehen in Vorderansicht. Den
Übergang zu dem vorliegenden Relief bildet eine späthellenistische Stele in Verona,
die eine Büchse in der Linken der Anbetenden zeigt, neben welcher wieder die
Dienerin mit der Kanne steht. 64 Die kleine Büchse in der Hand der Frau mag
Räucherwerk enthalten, wie z. B. auf einer griechischen Stele aus der Kaiserzeit
die Tote Weihrauch auf den Altar streut. 65 Es kommen aber auch große Cisten
nicht nur bei Dienerinnen, sondern auch im Arm der Toten selbst vor.66 Eine
solche Ciste, die irgend welches heilige Gerät, Binden und was sonst immer ent-
hält, wird in Birts Codex zu erkennen sein; ein zweiter Kasten steht am Boden.
Das Vorstehende dürfte von Anfang bis Ende den alten Leitsatz des archäo-
logischen Instituts, auf dem die Serienpublikationen beruhen, bestätigt haben:
monumentorum artis qui unum vidit, nullum vidit, qui milia vidit, unum vidit.67
Göttingen. Ernst Pfuhl.
61) Berlin Nr. 767. Millin, Voyage au Midi de la
France III 302; De Witte, Lettre ä Μ. Roulez
(Bulletin de l’acad. de Bruxelles IX, 1, S. 52),
Phot, im Apparat. Diese drei mit Adoration.
Jahrbuch XX 1905 S. 57 Nr. 42, Dütschke IV
Nr. 421. Michaelis, Anc. Marbles S. 578 Nr. 149,
S. 495 Nr. 52. Vgl. British Museum Catalogue
Nr. 704.
63) Der Mantelwurf ist jedesmal verschieden, aber
stets so genau wiedergegeben, daß man ihn mit
einem großen Tuch herstellen kann.
64) Dütschke IV 398, Phot. G. R. 655.
65) Früher in Venedig, jetzt in Berlin; Gerhard,
Annali 1829 S. 139, 145; Friedländer, De op.
anagl. p. 29.
66) Grabpfeiler aus Mytilene; Stark, Nach dem
griechischen Orient S. 380, Phot. G. R. 598.
67) Anmerkungsweise gebe ich noch einen kleinen,
absichtlich einseitig gehaltenen Beitrag zu Birts
anregender Besprechung der Trajanssäule und
ihrer Nachkommen. Das Denkmal ist von vorn-
herein als Grabsäule gedacht; die Reliefs finden
in diesem Sinn ihre Vorgänger schon in den
bildlichen laudationes an den Wänden der Grab-
tempel ägyptischer Könige, weiterhin im Ne-
reidenmonument und seinen Verwandten. Zur
architektonischen Genesis der Form sind die
seit mykenischer Zeit verfolgbaren gewundenen
Säulen heranzuziehen (Wiegand, Porosarchitek-
tur S. 172; Belger, Arch. Anzeiger 1895 S. 15),
ferner die im Jahrbuch XX 1905 S. 89 f. bespro-
chenen sepulkralen Coni und Spitzsäulen mit
Spiralwindung. Die Bemerkung, daß sich
Schlangen auf den Denkmälern regelmäßig von
rechts nach links um Bäume winden, wird durch
viele Grabreliefs widerlegt. Vgl. auch B. C. H.
1906 S. 561, Abb. 24.