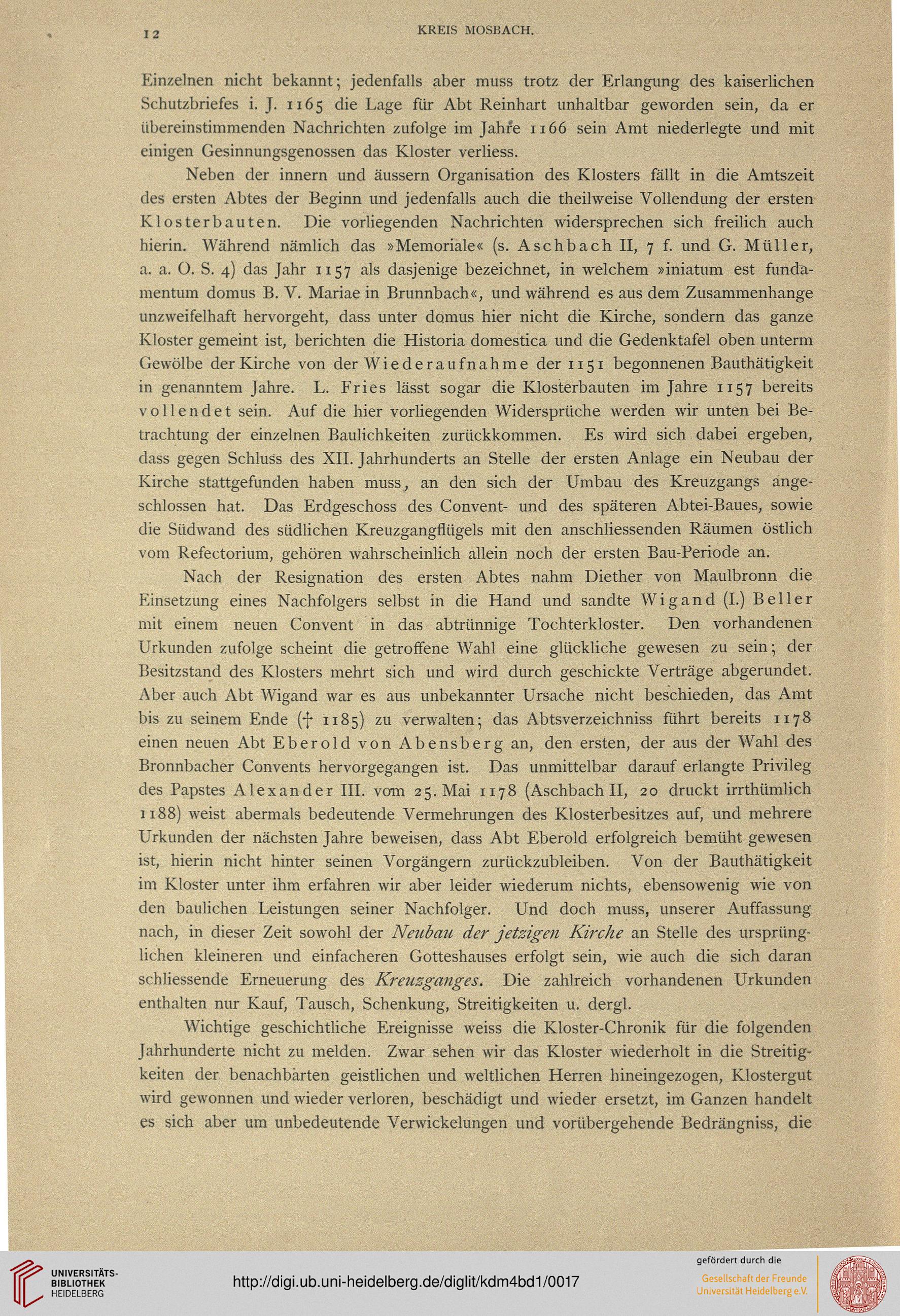KREIS MOSBACH.
Einzelnen nicht bekannt; jedenfalls aber muss trotz der Erlangung des kaiserlichen
Schutzbriefes i. J. 1165 die Lage für Abt Reinhart unhaltbar geworden sein, da er
übereinstimmenden Nachrichten zufolge im Jahre 1166 sein Amt niederlegte und mit
einigen Gesinnungsgenossen das Kloster verliess.
Neben der innern und äussern Organisation des Klosters fällt in die Amtszeit
des ersten Abtes der Beginn und jedenfalls auch die theilweise Vollendung der ersten
Klosterbauten. Die vorliegenden Nachrichten widersprechen sich freilich auch
hierin. Während nämlich das »Memoriale« (s. Aschbach II, 7 f. und G. Müller,
a. a. O. S. 4) das Jahr 1157 als dasjenige bezeichnet, in welchem »iniatum est funda-
mentum domus B. V. Mariae in Brunnbach«, und während es aus dem Zusammenhange
unzweifelhaft hervorgeht, dass unter domus hier nicht die Kirche, sondern das ganze
Kloster gemeint ist, berichten die Historia domestica und die Gedenktafel oben unterm
Gewölbe der Kirche von der Wiederaufnahme der 1151 begonnenen Bauthätigkeit
in genanntem Jahre. L. Fries lässt sogar die Klosterbauten im Jahre 1157 bereits
vollendet sein. Auf die hier vorliegenden Widersprüche werden wir unten bei Be-
trachtung der einzelnen Baulichkeiten zurückkommen. Es wird sich dabei ergeben,
dass gegen Schluss des XII. Jahrhunderts an Stelle der ersten Anlage ein Neubau der
Kirche stattgefunden haben muss, an den sich der Umbau des Kreuzgangs ange-
schlossen hat. Das Erdgeschoss des Convent- und des späteren Abtei-Baues, sowie
die Südwand des südlichen Kreuzgangflügels mit den anschliessenden Räumen östlich
vom Refectorium, gehören wahrscheinlich allein noch der ersten Bau-Periode an.
Nach der Resignation des ersten Abtes nahm Diether von Maulbronn die
Einsetzung eines Nachfolgers selbst in die Hand und sandte Wigand (I.) Beller
mit einem neuen Convent in das abtrünnige Tochterkloster. Den vorhandenen
Urkunden zufolge scheint die getroffene Wahl eine glückliche gewesen zu sein; der
Besitzstand des Klosters mehrt sich und wird durch geschickte Verträge abgerundet.
Aber auch Abt Wigand war es aus unbekannter Ursache nicht beschieden, das Amt
bis zu seinem Ende (f 1185) zu verwalten; das Abtsverzeichniss führt bereits 1178
einen neuen Abt Eberold von Abensberg an, den ersten, der aus der Wahl des
Bronnbacher Convents hervorgegangen ist. Das unmittelbar darauf erlangte Privileg
des Papstes Alexander III. vom 25. Mai n78 (Aschbach II, 20 druckt irrthümlich
1188) weist abermals bedeutende Vermehrungen des Klosterbesitzes auf, und mehrere
Urkunden der nächsten Jahre beweisen, dass Abt Eberold erfolgreich bemüht gewesen
ist, hierin nicht hinter seinen Vorgängern zurückzubleiben. Von der Bauthätigkeit
im Kloster unter ihm erfahren wir aber leider wiederum nichts, ebensowenig wie von
den baulichen Leistungen seiner Nachfolger. Und doch muss, unserer Auffassung
nach, in dieser Zeit sowohl der Neubau der jetzigen Kirche an Stelle des ursprüng-
lichen kleineren und einfacheren Gotteshauses erfolgt sein, wie auch die sich daran
schliessende Erneuerung des Kreuzganges. Die zahlreich vorhandenen Urkunden
enthalten nur Kauf, Tausch, Schenkung, Streitigkeiten u. dergl.
Wichtige geschichtliche Ereignisse weiss die Kloster-Chronik für die folgenden
Jahrhunderte nicht zu melden. Zwar sehen wir das Kloster wiederholt in die Streitig-
keiten der benachbarten geistlichen und weltlichen Herren hineingezogen, Klostergut
wird gewonnen und wieder verloren, beschädigt und wieder ersetzt, im Ganzen handelt
es sich aber um unbedeutende Verwickelungen und vorübergehende Bedrängniss, die
Einzelnen nicht bekannt; jedenfalls aber muss trotz der Erlangung des kaiserlichen
Schutzbriefes i. J. 1165 die Lage für Abt Reinhart unhaltbar geworden sein, da er
übereinstimmenden Nachrichten zufolge im Jahre 1166 sein Amt niederlegte und mit
einigen Gesinnungsgenossen das Kloster verliess.
Neben der innern und äussern Organisation des Klosters fällt in die Amtszeit
des ersten Abtes der Beginn und jedenfalls auch die theilweise Vollendung der ersten
Klosterbauten. Die vorliegenden Nachrichten widersprechen sich freilich auch
hierin. Während nämlich das »Memoriale« (s. Aschbach II, 7 f. und G. Müller,
a. a. O. S. 4) das Jahr 1157 als dasjenige bezeichnet, in welchem »iniatum est funda-
mentum domus B. V. Mariae in Brunnbach«, und während es aus dem Zusammenhange
unzweifelhaft hervorgeht, dass unter domus hier nicht die Kirche, sondern das ganze
Kloster gemeint ist, berichten die Historia domestica und die Gedenktafel oben unterm
Gewölbe der Kirche von der Wiederaufnahme der 1151 begonnenen Bauthätigkeit
in genanntem Jahre. L. Fries lässt sogar die Klosterbauten im Jahre 1157 bereits
vollendet sein. Auf die hier vorliegenden Widersprüche werden wir unten bei Be-
trachtung der einzelnen Baulichkeiten zurückkommen. Es wird sich dabei ergeben,
dass gegen Schluss des XII. Jahrhunderts an Stelle der ersten Anlage ein Neubau der
Kirche stattgefunden haben muss, an den sich der Umbau des Kreuzgangs ange-
schlossen hat. Das Erdgeschoss des Convent- und des späteren Abtei-Baues, sowie
die Südwand des südlichen Kreuzgangflügels mit den anschliessenden Räumen östlich
vom Refectorium, gehören wahrscheinlich allein noch der ersten Bau-Periode an.
Nach der Resignation des ersten Abtes nahm Diether von Maulbronn die
Einsetzung eines Nachfolgers selbst in die Hand und sandte Wigand (I.) Beller
mit einem neuen Convent in das abtrünnige Tochterkloster. Den vorhandenen
Urkunden zufolge scheint die getroffene Wahl eine glückliche gewesen zu sein; der
Besitzstand des Klosters mehrt sich und wird durch geschickte Verträge abgerundet.
Aber auch Abt Wigand war es aus unbekannter Ursache nicht beschieden, das Amt
bis zu seinem Ende (f 1185) zu verwalten; das Abtsverzeichniss führt bereits 1178
einen neuen Abt Eberold von Abensberg an, den ersten, der aus der Wahl des
Bronnbacher Convents hervorgegangen ist. Das unmittelbar darauf erlangte Privileg
des Papstes Alexander III. vom 25. Mai n78 (Aschbach II, 20 druckt irrthümlich
1188) weist abermals bedeutende Vermehrungen des Klosterbesitzes auf, und mehrere
Urkunden der nächsten Jahre beweisen, dass Abt Eberold erfolgreich bemüht gewesen
ist, hierin nicht hinter seinen Vorgängern zurückzubleiben. Von der Bauthätigkeit
im Kloster unter ihm erfahren wir aber leider wiederum nichts, ebensowenig wie von
den baulichen Leistungen seiner Nachfolger. Und doch muss, unserer Auffassung
nach, in dieser Zeit sowohl der Neubau der jetzigen Kirche an Stelle des ursprüng-
lichen kleineren und einfacheren Gotteshauses erfolgt sein, wie auch die sich daran
schliessende Erneuerung des Kreuzganges. Die zahlreich vorhandenen Urkunden
enthalten nur Kauf, Tausch, Schenkung, Streitigkeiten u. dergl.
Wichtige geschichtliche Ereignisse weiss die Kloster-Chronik für die folgenden
Jahrhunderte nicht zu melden. Zwar sehen wir das Kloster wiederholt in die Streitig-
keiten der benachbarten geistlichen und weltlichen Herren hineingezogen, Klostergut
wird gewonnen und wieder verloren, beschädigt und wieder ersetzt, im Ganzen handelt
es sich aber um unbedeutende Verwickelungen und vorübergehende Bedrängniss, die