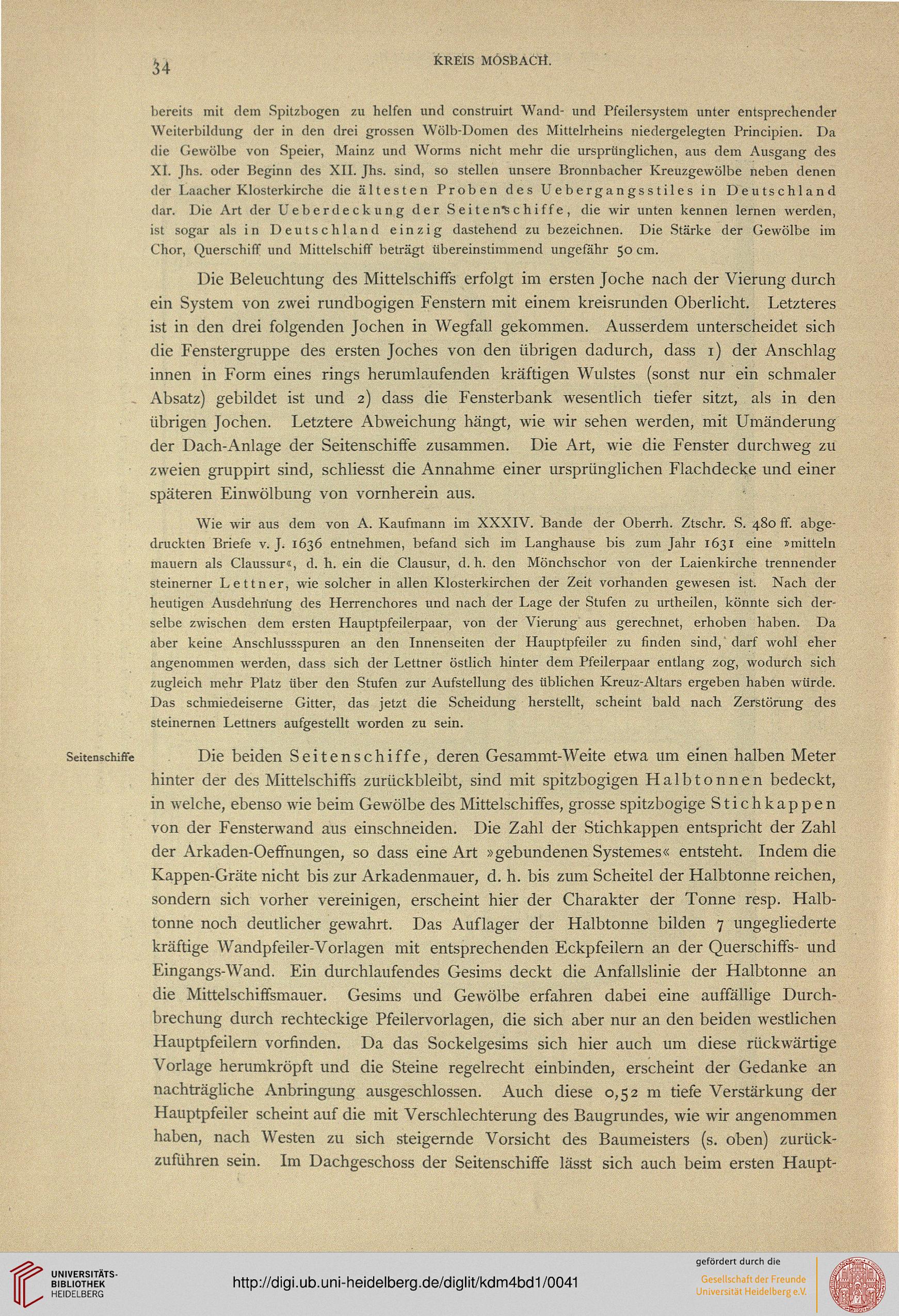34
JCREIS MOSBACH.
bereits mit dem Spitzbogen zu helfen und construirt Wand- und Pfeilersystem unter entsprechender
Weiterbildung der in den drei grossen Wölb-T)omen des Mittelrheins niedergelegten Principien. Da
die Gewölbe von Speier, Mainz und Worms nicht mehr die ursprünglichen, aus dem Ausgang des
XI. Jhs. oder Beginn des XII. Jhs. sind, so stellen unsere Bronnbacher Kreuzgewölbe neben denen
der Laacher Klosterkirche die ältesten Proben des Uebergangsstiles in Deutschland
dar. Die Art der Ueberdeckung der Seitenschiffe, die wir unten kennen lernen werden,
ist sogar als in Deutschland einzig dastehend zu bezeichnen. Die Stärke der Gewölbe im
Chor, Querschiff und Mittelschiff beträgt übereinstimmend ungefähr 50 cm.
Die Beleuchtung des Mittelschiffs erfolgt im ersten Joche nach der Vierung durch
ein System von zwei rundbogigen Fenstern mit einem kreisrunden Oberlicht. Letzteres
ist in den drei folgenden Jochen in Wegfall gekommen. Ausserdem unterscheidet sich
die Fenstergruppe des ersten Joches von den übrigen dadurch, dass 1) der Anschlag
innen in Form eines rings herumlaufenden kräftigen Wulstes (sonst nur ein schmaler
- Absatz) gebildet ist und 2) dass die Fensterbank wesentlich tiefer sitzt, als in den
übrigen Jochen. Letztere Abweichung hängt, wie wir sehen werden, mit Umänderung
der Dach-Anlage der Seitenschiffe zusammen. Die Art, wie die Fenster durchweg zu
zweien gruppirt sind, schliesst die Annahme einer ursprünglichen Flachdecke und einer
späteren Einwölbung von vornherein aus.
Wie wir aus dem von A. Kaufmann im XXXIV. Bande der Oberrh. Ztschr. S. 480 ff. abge-
druckten Briefe v.J. 1636 entnehmen, befand sich im Langhause bis zum Jahr 1631 eine »mittein
mauern als Claussur«, d. h. ein die Clausur, d.h. den Mönchschor von der Laienkirche trennender
steinerner Lettner, wie solcher in allen Klosterkirchen der Zeit vorhanden gewesen ist. Nach der
heutigen Ausdehnung des Herrenchores und nach der Lage der Stufen zu urtheilen, könnte sich der-
selbe zwischen dem ersten Hauptpfeilerpaar, von der Vierung aus gerechnet, erhoben haben. Da
aber keine Anschlussspuren an den Innenseiten der Hauptpfeiler zu finden sind,' darf wohl eher
angenommen werden, dass sich der Lettner östlich hinter dem Pfeilerpaar entlang zog, wodurch sich
zugleich mehr Platz über den Stufen zur Aufstellung des üblichen Kreuz-Altars ergeben haben wurde.
Das schmiedeiserne Gitter, das jetzt die Scheidung herstellt, scheint bald nach Zerstörung des
steinernen Lettners aufgestellt worden zu sein.
Seitenschiffe Die beiden Seitenschiffe, deren Gesammt-Weite etwa um einen halben Meter
hinter der des Mittelschiffs zurückbleibt, sind mit spitzbogigen Halbtonnen bedeckt,
in welche, ebenso wie beim Gewölbe des Mittelschiffes, grosse spitzbogige Stichkappen
von der Fensterwand aus einschneiden. Die Zahl der Stichkappen entspricht der Zahl
der Arkaden-Oeffnungen, so dass eine Art »gebundenen Systemes« entsteht. Indem die
Kappen-Gräte nicht bis zur Arkadenmauer, d. h. bis zum Scheitel der Halbtonne reichen,
sondern sich vorher vereinigen, erscheint hier der Charakter der Tonne resp. Halb-
tonne noch deutlicher gewahrt. Das Auflager der Halbtonne bilden 7 ungegliederte
kräftige Wandpfeiler-Vorlagen mit entsprechenden Eckpfeilern an der Querschiffs- und
Eingangs-Wand. Ein durchlaufendes Gesims deckt die Anfallslinie der Halbtonne an
die Mittelschiffsmauer. Gesims und Gewölbe erfahren dabei eine auffällige Durch-
brechung durch rechteckige Pfeilervorlagen, die sich aber nur an den beiden westlichen
Hauptpfeilern vorfinden. Da das Sockelgesims sich hier auch um diese rückwärtige
Vorlage herumkröpft und die Steine regelrecht einbinden, erscheint der Gedanke an
nachträgliche Anbringung ausgeschlossen. Auch diese 0,52 m tiefe Verstärkung der
Hauptpfeiler scheint auf die mit Verschlechterung des Baugrundes, wie wir angenommen
haben, nach Westen zu sich steigernde Vorsicht des Baumeisters (s. oben) zurück-
zuführen sein. Im Dachgeschoss der Seitenschiffe lässt sich auch beim ersten Haupt-
JCREIS MOSBACH.
bereits mit dem Spitzbogen zu helfen und construirt Wand- und Pfeilersystem unter entsprechender
Weiterbildung der in den drei grossen Wölb-T)omen des Mittelrheins niedergelegten Principien. Da
die Gewölbe von Speier, Mainz und Worms nicht mehr die ursprünglichen, aus dem Ausgang des
XI. Jhs. oder Beginn des XII. Jhs. sind, so stellen unsere Bronnbacher Kreuzgewölbe neben denen
der Laacher Klosterkirche die ältesten Proben des Uebergangsstiles in Deutschland
dar. Die Art der Ueberdeckung der Seitenschiffe, die wir unten kennen lernen werden,
ist sogar als in Deutschland einzig dastehend zu bezeichnen. Die Stärke der Gewölbe im
Chor, Querschiff und Mittelschiff beträgt übereinstimmend ungefähr 50 cm.
Die Beleuchtung des Mittelschiffs erfolgt im ersten Joche nach der Vierung durch
ein System von zwei rundbogigen Fenstern mit einem kreisrunden Oberlicht. Letzteres
ist in den drei folgenden Jochen in Wegfall gekommen. Ausserdem unterscheidet sich
die Fenstergruppe des ersten Joches von den übrigen dadurch, dass 1) der Anschlag
innen in Form eines rings herumlaufenden kräftigen Wulstes (sonst nur ein schmaler
- Absatz) gebildet ist und 2) dass die Fensterbank wesentlich tiefer sitzt, als in den
übrigen Jochen. Letztere Abweichung hängt, wie wir sehen werden, mit Umänderung
der Dach-Anlage der Seitenschiffe zusammen. Die Art, wie die Fenster durchweg zu
zweien gruppirt sind, schliesst die Annahme einer ursprünglichen Flachdecke und einer
späteren Einwölbung von vornherein aus.
Wie wir aus dem von A. Kaufmann im XXXIV. Bande der Oberrh. Ztschr. S. 480 ff. abge-
druckten Briefe v.J. 1636 entnehmen, befand sich im Langhause bis zum Jahr 1631 eine »mittein
mauern als Claussur«, d. h. ein die Clausur, d.h. den Mönchschor von der Laienkirche trennender
steinerner Lettner, wie solcher in allen Klosterkirchen der Zeit vorhanden gewesen ist. Nach der
heutigen Ausdehnung des Herrenchores und nach der Lage der Stufen zu urtheilen, könnte sich der-
selbe zwischen dem ersten Hauptpfeilerpaar, von der Vierung aus gerechnet, erhoben haben. Da
aber keine Anschlussspuren an den Innenseiten der Hauptpfeiler zu finden sind,' darf wohl eher
angenommen werden, dass sich der Lettner östlich hinter dem Pfeilerpaar entlang zog, wodurch sich
zugleich mehr Platz über den Stufen zur Aufstellung des üblichen Kreuz-Altars ergeben haben wurde.
Das schmiedeiserne Gitter, das jetzt die Scheidung herstellt, scheint bald nach Zerstörung des
steinernen Lettners aufgestellt worden zu sein.
Seitenschiffe Die beiden Seitenschiffe, deren Gesammt-Weite etwa um einen halben Meter
hinter der des Mittelschiffs zurückbleibt, sind mit spitzbogigen Halbtonnen bedeckt,
in welche, ebenso wie beim Gewölbe des Mittelschiffes, grosse spitzbogige Stichkappen
von der Fensterwand aus einschneiden. Die Zahl der Stichkappen entspricht der Zahl
der Arkaden-Oeffnungen, so dass eine Art »gebundenen Systemes« entsteht. Indem die
Kappen-Gräte nicht bis zur Arkadenmauer, d. h. bis zum Scheitel der Halbtonne reichen,
sondern sich vorher vereinigen, erscheint hier der Charakter der Tonne resp. Halb-
tonne noch deutlicher gewahrt. Das Auflager der Halbtonne bilden 7 ungegliederte
kräftige Wandpfeiler-Vorlagen mit entsprechenden Eckpfeilern an der Querschiffs- und
Eingangs-Wand. Ein durchlaufendes Gesims deckt die Anfallslinie der Halbtonne an
die Mittelschiffsmauer. Gesims und Gewölbe erfahren dabei eine auffällige Durch-
brechung durch rechteckige Pfeilervorlagen, die sich aber nur an den beiden westlichen
Hauptpfeilern vorfinden. Da das Sockelgesims sich hier auch um diese rückwärtige
Vorlage herumkröpft und die Steine regelrecht einbinden, erscheint der Gedanke an
nachträgliche Anbringung ausgeschlossen. Auch diese 0,52 m tiefe Verstärkung der
Hauptpfeiler scheint auf die mit Verschlechterung des Baugrundes, wie wir angenommen
haben, nach Westen zu sich steigernde Vorsicht des Baumeisters (s. oben) zurück-
zuführen sein. Im Dachgeschoss der Seitenschiffe lässt sich auch beim ersten Haupt-