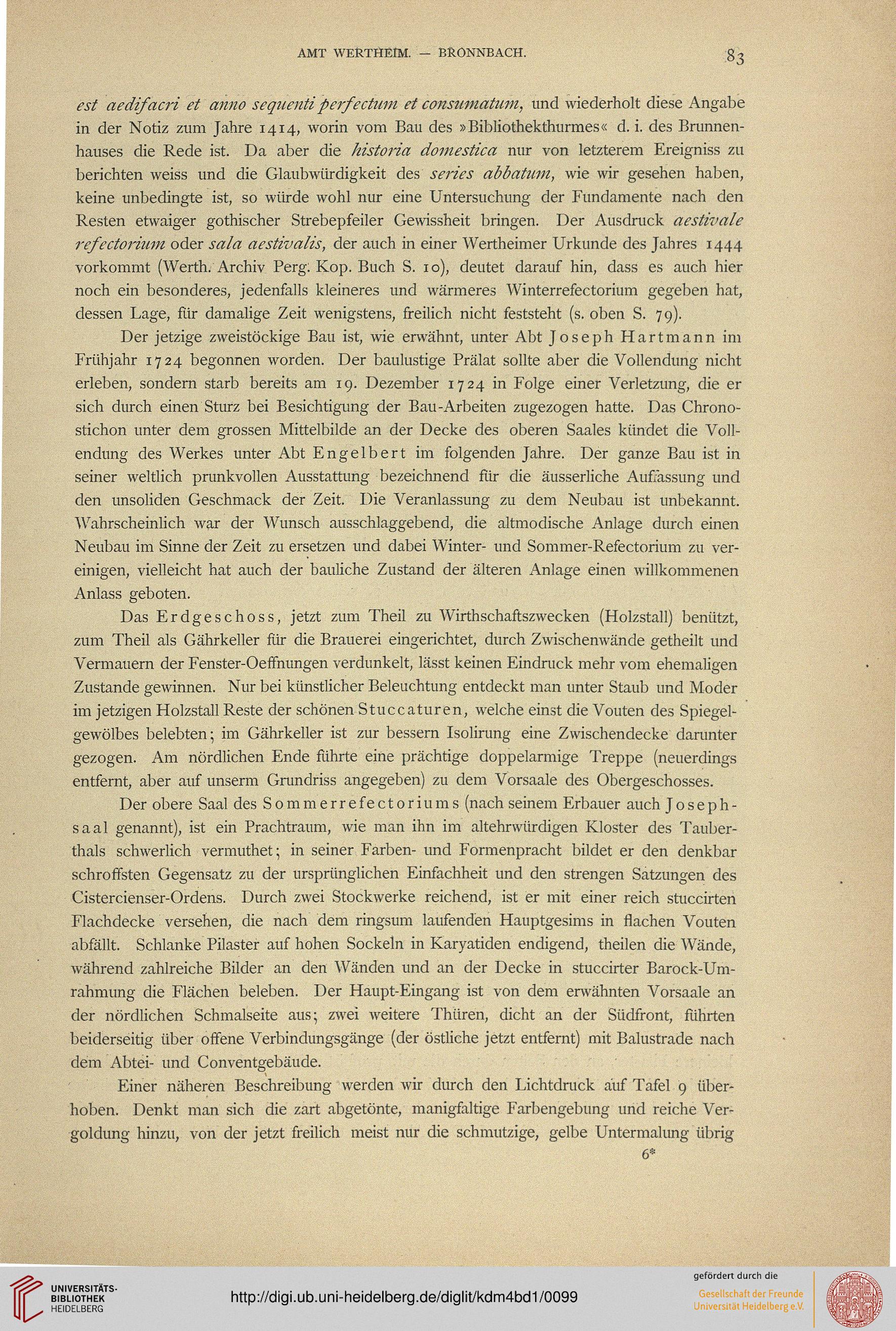AMT WERTHEIM. — BRONNBACH.
83
est aedifacri et anno sequenti perfectum et consumatum, und wiederholt diese Angabe
in der Notiz zum Jahre 1414, worin vom Bau des »Bibliothekthurmes« d. i. des Brunnen-
hauses die Rede ist. Da aber die historia domestica mir von letzterem Ereigniss zu
berichten weiss und die Glaubwürdigkeit des series abbatum, wie wir gesehen haben,
keine unbedingte ist, so würde wohl nur eine Untersuchung der Fundamente nach den
Resten etwaiger gothischer Strebepfeiler Gewissheit bringen. Der Ausdruck aestivale
refectorium oder sala aestivalis, der auch in einer Wertheimer Urkunde des Jahres 1444
vorkommt (Werth. Archiv Perg: Kop. Buch S. 10), deutet darauf hin, dass es auch hier
noch ein besonderes, jedenfalls kleineres und wärmeres Winterrefectorium gegeben hat,
dessen Lage, für damalige Zeit wenigstens, freilich nicht feststeht (s. oben S. 79).
Der jetzige zweistöckige Bau ist, wie erwähnt, unter Abt Joseph Hartmann im
Frühjahr 1724 begonnen worden. Der baulustige Prälat sollte aber die Vollendung nicht
erleben, sondern starb bereits am 19. Dezember 1724 in Folge einer Verletzung, die er
sich durch einen Sturz bei Besichtigung der Bau-Arbeiten zugezogen hatte. Das Chrono-
stichon unter dem grossen Mittelbilde an der Decke des oberen Saales kündet die Voll-
endung des Werkes unter Abt Engelbert im folgenden Jahre. Der ganze Bau ist in
seiner weltlich prunkvollen Ausstattung bezeichnend für die äusserliche Auffassung und
den unsoliden Geschmack der Zeit. Die Veranlassung zu dem Neubau ist unbekannt.
Wahrscheinlich war der Wunsch ausschlaggebend, die altmodische Anlage durch einen
Neubau im Sinne der Zeit zu ersetzen und dabei Winter- und Sommer-Refectorium zu ver-
einigen, vielleicht hat auch der bauliche Zustand der älteren Anlage einen willkommenen
Anlass geboten.
Das Erdgeschoss, jetzt zum Theil zu Wirthschaftszwecken (Holzstall) benützt,
zum Theil als Gährkeller für die Brauerei eingerichtet, durch Zwischenwände getheilt und
Vermauern der Fenster-Oeffnungen verdunkelt, lässt keinen Eindruck mehr vom ehemaligen
Zustande gewinnen. Nur bei künstlicher Beleuchtung entdeckt man unter Staub und Moder
im jetzigen Holzstall Reste der schönen Stuccaturen, welche einst die Vouten des Spiegel-
gewölbes belebten; im Gährkeller ist zur bessern Isolirung eine Zwischendecke darunter
gezogen. Am nördlichen Ende führte eine prächtige doppelarmige Treppe (neuerdings
entfernt, aber auf unserm Grundriss angegeben) zu dem Vorsaale des Obergeschosses.
Der obere Saal des Sommerrefectoriums (nach seinem Erbauer auch Joseph-
saal genannt), ist ein Prachtraum, wie man ihn im altehrwürdigen Kloster des Tauber-
thals schwerlich vermuthet; in seiner Farben- und Formenpracht bildet er den denkbar
schroffsten Gegensatz zu der ursprünglichen Einfachheit und den strengen Satzungen des
Cistercienser-Ordens. Durch zwei Stockwerke reichend, ist er mit einer reich stuccirten
Flachdecke versehen, die nach dem ringsum laufenden Hauptgesims in flachen Vouten
abfällt. Schlanke Pilaster auf hohen Sockeln in Karyatiden endigend, theilen die Wände,
während zahlreiche Bilder an den Wänden und an der Decke in stuccirter Barock-Um-
rahmung die Flächen beleben. Der Haupt-Eingang ist von dem erwähnten Vorsaale an
der nördlichen Schmalseite aus; zwei weitere Thüren, dicht an der Südfront, führten
beiderseitig über offene Verbindungsgänge (der östliche jetzt entfernt) mit Balustrade nach
dem Abtei- und Conventgebäude.
Einer näheren Beschreibung werden wir durch den Lichtdruck auf Tafel 9 über-
hoben. Denkt man sich die zart abgetönte, manigfaltige Farbengebung und reiche Ver-
goldung hinzu, von der jetzt freilich meist nur die schmutzige, gelbe Untermalung übrig
6*
83
est aedifacri et anno sequenti perfectum et consumatum, und wiederholt diese Angabe
in der Notiz zum Jahre 1414, worin vom Bau des »Bibliothekthurmes« d. i. des Brunnen-
hauses die Rede ist. Da aber die historia domestica mir von letzterem Ereigniss zu
berichten weiss und die Glaubwürdigkeit des series abbatum, wie wir gesehen haben,
keine unbedingte ist, so würde wohl nur eine Untersuchung der Fundamente nach den
Resten etwaiger gothischer Strebepfeiler Gewissheit bringen. Der Ausdruck aestivale
refectorium oder sala aestivalis, der auch in einer Wertheimer Urkunde des Jahres 1444
vorkommt (Werth. Archiv Perg: Kop. Buch S. 10), deutet darauf hin, dass es auch hier
noch ein besonderes, jedenfalls kleineres und wärmeres Winterrefectorium gegeben hat,
dessen Lage, für damalige Zeit wenigstens, freilich nicht feststeht (s. oben S. 79).
Der jetzige zweistöckige Bau ist, wie erwähnt, unter Abt Joseph Hartmann im
Frühjahr 1724 begonnen worden. Der baulustige Prälat sollte aber die Vollendung nicht
erleben, sondern starb bereits am 19. Dezember 1724 in Folge einer Verletzung, die er
sich durch einen Sturz bei Besichtigung der Bau-Arbeiten zugezogen hatte. Das Chrono-
stichon unter dem grossen Mittelbilde an der Decke des oberen Saales kündet die Voll-
endung des Werkes unter Abt Engelbert im folgenden Jahre. Der ganze Bau ist in
seiner weltlich prunkvollen Ausstattung bezeichnend für die äusserliche Auffassung und
den unsoliden Geschmack der Zeit. Die Veranlassung zu dem Neubau ist unbekannt.
Wahrscheinlich war der Wunsch ausschlaggebend, die altmodische Anlage durch einen
Neubau im Sinne der Zeit zu ersetzen und dabei Winter- und Sommer-Refectorium zu ver-
einigen, vielleicht hat auch der bauliche Zustand der älteren Anlage einen willkommenen
Anlass geboten.
Das Erdgeschoss, jetzt zum Theil zu Wirthschaftszwecken (Holzstall) benützt,
zum Theil als Gährkeller für die Brauerei eingerichtet, durch Zwischenwände getheilt und
Vermauern der Fenster-Oeffnungen verdunkelt, lässt keinen Eindruck mehr vom ehemaligen
Zustande gewinnen. Nur bei künstlicher Beleuchtung entdeckt man unter Staub und Moder
im jetzigen Holzstall Reste der schönen Stuccaturen, welche einst die Vouten des Spiegel-
gewölbes belebten; im Gährkeller ist zur bessern Isolirung eine Zwischendecke darunter
gezogen. Am nördlichen Ende führte eine prächtige doppelarmige Treppe (neuerdings
entfernt, aber auf unserm Grundriss angegeben) zu dem Vorsaale des Obergeschosses.
Der obere Saal des Sommerrefectoriums (nach seinem Erbauer auch Joseph-
saal genannt), ist ein Prachtraum, wie man ihn im altehrwürdigen Kloster des Tauber-
thals schwerlich vermuthet; in seiner Farben- und Formenpracht bildet er den denkbar
schroffsten Gegensatz zu der ursprünglichen Einfachheit und den strengen Satzungen des
Cistercienser-Ordens. Durch zwei Stockwerke reichend, ist er mit einer reich stuccirten
Flachdecke versehen, die nach dem ringsum laufenden Hauptgesims in flachen Vouten
abfällt. Schlanke Pilaster auf hohen Sockeln in Karyatiden endigend, theilen die Wände,
während zahlreiche Bilder an den Wänden und an der Decke in stuccirter Barock-Um-
rahmung die Flächen beleben. Der Haupt-Eingang ist von dem erwähnten Vorsaale an
der nördlichen Schmalseite aus; zwei weitere Thüren, dicht an der Südfront, führten
beiderseitig über offene Verbindungsgänge (der östliche jetzt entfernt) mit Balustrade nach
dem Abtei- und Conventgebäude.
Einer näheren Beschreibung werden wir durch den Lichtdruck auf Tafel 9 über-
hoben. Denkt man sich die zart abgetönte, manigfaltige Farbengebung und reiche Ver-
goldung hinzu, von der jetzt freilich meist nur die schmutzige, gelbe Untermalung übrig
6*