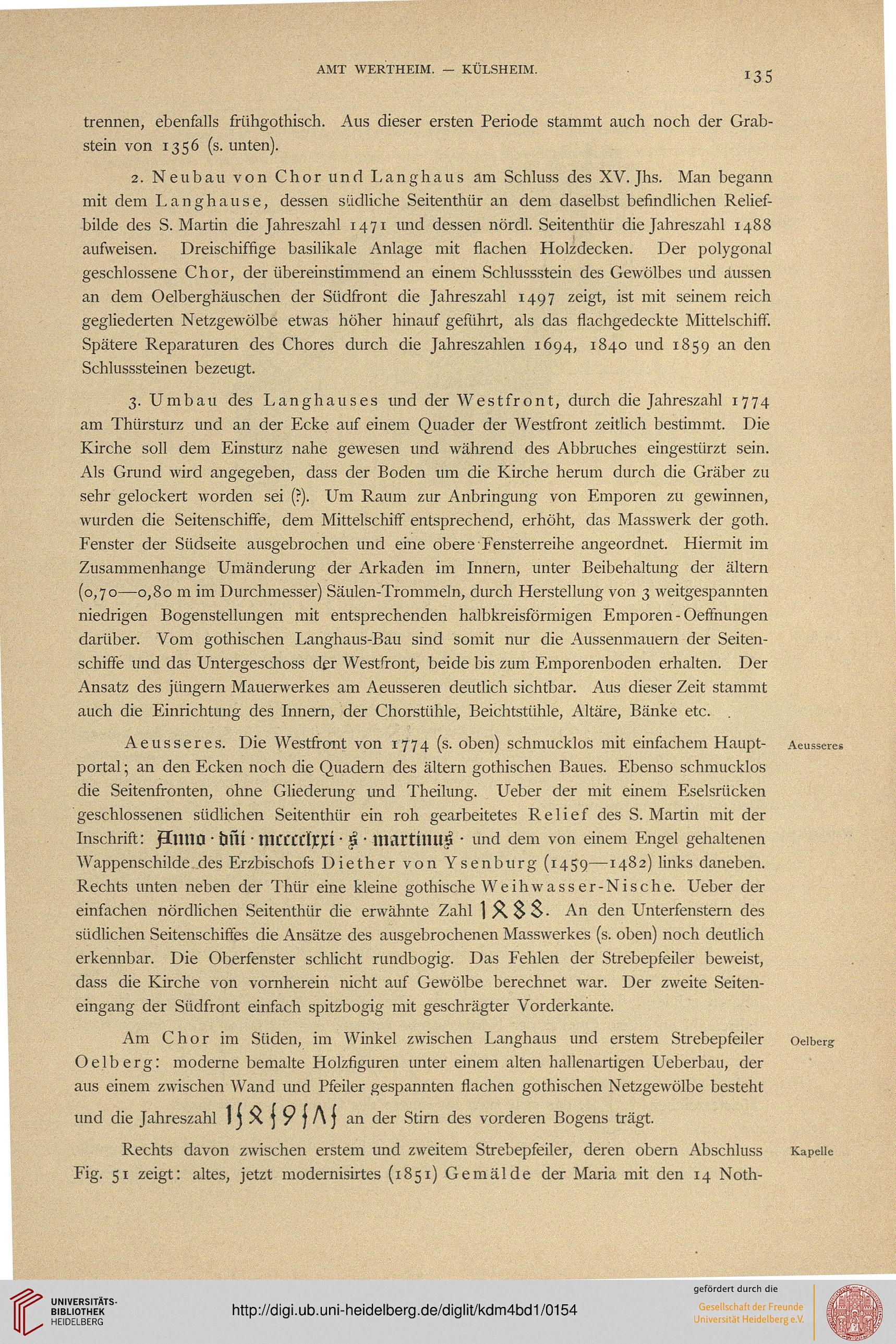AMT WERTHEIM. — KULSHEIM.
trennen, ebenfalls frühgothisch. Aus dieser ersten Periode stammt auch noch der Grab-
stein von 1356 (s. unten).
2. Neubau von Chor und Langhaus am Schluss des XV. Jhs. Man begann
mit dem Langhause, dessen sudliche Seitenthür an dem daselbst befindlichen Relief-
bilde des S. Martin die Jahreszahl 1471 und dessen nördl. Seitenthür die Jahreszahl 1488
aufweisen. Dreischiffige basilikale Anlage mit flachen Holzdecken. Der polygonal
geschlossene Chor, der übereinstimmend an einem Schlussstein des Gewölbes und aussen
an dem Oelberghäuschen der Südfront die Jahreszahl 1497 zeigt, ist mit seinem reich
gegliederten Netzgewölbe etwas höher hinauf geführt, als das nachgedeckte Mittelschiff.
Spätere Reparaturen des Chores durch die Jahreszahlen 1694, 1840 und 1859 an den
Schlusssteinen bezeugt.
3. Umbau des Langhauses und der Westfront, durch die Jahreszahl 1774
am Thürsturz und an der Ecke auf einem Quader der Westfront zeitlich bestimmt. Die
Kirche soll dem Einsturz nahe gewesen und während des Abbruches eingestürzt sein.
Als Grund wird angegeben, dass der Boden um die Kirche herum durch die Gräber zu
sehr gelockert worden sei (?). Um Raum zur Anbringung von Emporen zu gewinnen,
wurden die Seitenschiffe, dem Mittelschiff entsprechend, erhöht, das Masswerk der goth.
Fenster der Südseite ausgebrochen und eine obere Fensterreihe angeordnet. Hiermit im
Zusammenhange Umänderung der Arkaden im Innern, unter Beibehaltung der altern
(0,70—0,80 m im Durchmesser) Säulen-Trommeln, durch Herstellung von 3 weitgespannten
niedrigen Bogenstellungen mit entsprechenden halbkreisförmigen Emporen - Oeffnungen
darüber. Vom gothischen Langhaus-Bau sind somit nur die Aussenmauern der Seiten-
schiffe und das Untergeschoss der Westfront, beide bis zum Emporenboden erhalten. Der
Ansatz des Jüngern Mauerwerkes am Aeusseren deutlich sichtbar. Aus dieser Zeit stammt
auch die Einrichtung des Innern, der Chorstühle, Beichtstühle, Altäre, Bänke etc. .
Aeusseres. Die Westfront von 1774 (s. oben) schmucklos mit einfachem Haupt-
portal ; an den Ecken noch die Quadern des altern gothischen Baues. Ebenso schmucklos
die Seitenfronten, ohne Gliederung und Theihmg. Ueber der mit einem Eselsriicken
geschlossenen südlichen Seitenthür ein roh gearbeitetes Relief des S. Martin mit der
Inschrift: JInn0 ■ ÖÜt • IJll'CCdfrP • J> • martitUt!» • und dem von einem Engel gehaltenen
Wappenschilde des Erzbischofs Diether von Ysenburg (1459—1482) links daneben.
Rechts unten neben der Thür eine kleine gothische Weihwasser-Nische. Ueber der
einfachen nördlichen Seitenthür die erwähnte Zahl ] &$$. An den Unterfenstern des
südlichen Seitenschiffes die Ansätze des ausgebrochenen Masswerkes (s. oben) noch deutlich
erkennbar. Die Oberfenster schlicht rundbogig. Das Fehlen der Strebepfeiler beweist,
dass die Kirche von vornherein nicht auf Gewölbe berechnet war. Der zweite Seiten-
eingang der Südfront einfach spitzbogig mit geschrägter Vorderkante.
Am Chor im Süden, im Winkel zwischen Langhaus und erstem Strebepfeiler
Oelberg: moderne bemalte Holzfiguren unter einem alten hallenartigen Ueberbau, der
aus einem zwischen Wand und Pfeiler gespannten flachen gothischen Netzgewölbe besteht
und die Jahreszahl Ij&J/jAj an der Stirn des vorderen Bogens trägt.
Rechts davon zwischen erstem und zweitem Strebepfeiler, deren obern Abschluss
Fig. 51 zeigt: altes, jetzt modernisirtes (1851) Gemälde der Maria mit den 14 Noth-
Aeusseres
Oelberg
Kapelle
trennen, ebenfalls frühgothisch. Aus dieser ersten Periode stammt auch noch der Grab-
stein von 1356 (s. unten).
2. Neubau von Chor und Langhaus am Schluss des XV. Jhs. Man begann
mit dem Langhause, dessen sudliche Seitenthür an dem daselbst befindlichen Relief-
bilde des S. Martin die Jahreszahl 1471 und dessen nördl. Seitenthür die Jahreszahl 1488
aufweisen. Dreischiffige basilikale Anlage mit flachen Holzdecken. Der polygonal
geschlossene Chor, der übereinstimmend an einem Schlussstein des Gewölbes und aussen
an dem Oelberghäuschen der Südfront die Jahreszahl 1497 zeigt, ist mit seinem reich
gegliederten Netzgewölbe etwas höher hinauf geführt, als das nachgedeckte Mittelschiff.
Spätere Reparaturen des Chores durch die Jahreszahlen 1694, 1840 und 1859 an den
Schlusssteinen bezeugt.
3. Umbau des Langhauses und der Westfront, durch die Jahreszahl 1774
am Thürsturz und an der Ecke auf einem Quader der Westfront zeitlich bestimmt. Die
Kirche soll dem Einsturz nahe gewesen und während des Abbruches eingestürzt sein.
Als Grund wird angegeben, dass der Boden um die Kirche herum durch die Gräber zu
sehr gelockert worden sei (?). Um Raum zur Anbringung von Emporen zu gewinnen,
wurden die Seitenschiffe, dem Mittelschiff entsprechend, erhöht, das Masswerk der goth.
Fenster der Südseite ausgebrochen und eine obere Fensterreihe angeordnet. Hiermit im
Zusammenhange Umänderung der Arkaden im Innern, unter Beibehaltung der altern
(0,70—0,80 m im Durchmesser) Säulen-Trommeln, durch Herstellung von 3 weitgespannten
niedrigen Bogenstellungen mit entsprechenden halbkreisförmigen Emporen - Oeffnungen
darüber. Vom gothischen Langhaus-Bau sind somit nur die Aussenmauern der Seiten-
schiffe und das Untergeschoss der Westfront, beide bis zum Emporenboden erhalten. Der
Ansatz des Jüngern Mauerwerkes am Aeusseren deutlich sichtbar. Aus dieser Zeit stammt
auch die Einrichtung des Innern, der Chorstühle, Beichtstühle, Altäre, Bänke etc. .
Aeusseres. Die Westfront von 1774 (s. oben) schmucklos mit einfachem Haupt-
portal ; an den Ecken noch die Quadern des altern gothischen Baues. Ebenso schmucklos
die Seitenfronten, ohne Gliederung und Theihmg. Ueber der mit einem Eselsriicken
geschlossenen südlichen Seitenthür ein roh gearbeitetes Relief des S. Martin mit der
Inschrift: JInn0 ■ ÖÜt • IJll'CCdfrP • J> • martitUt!» • und dem von einem Engel gehaltenen
Wappenschilde des Erzbischofs Diether von Ysenburg (1459—1482) links daneben.
Rechts unten neben der Thür eine kleine gothische Weihwasser-Nische. Ueber der
einfachen nördlichen Seitenthür die erwähnte Zahl ] &$$. An den Unterfenstern des
südlichen Seitenschiffes die Ansätze des ausgebrochenen Masswerkes (s. oben) noch deutlich
erkennbar. Die Oberfenster schlicht rundbogig. Das Fehlen der Strebepfeiler beweist,
dass die Kirche von vornherein nicht auf Gewölbe berechnet war. Der zweite Seiten-
eingang der Südfront einfach spitzbogig mit geschrägter Vorderkante.
Am Chor im Süden, im Winkel zwischen Langhaus und erstem Strebepfeiler
Oelberg: moderne bemalte Holzfiguren unter einem alten hallenartigen Ueberbau, der
aus einem zwischen Wand und Pfeiler gespannten flachen gothischen Netzgewölbe besteht
und die Jahreszahl Ij&J/jAj an der Stirn des vorderen Bogens trägt.
Rechts davon zwischen erstem und zweitem Strebepfeiler, deren obern Abschluss
Fig. 51 zeigt: altes, jetzt modernisirtes (1851) Gemälde der Maria mit den 14 Noth-
Aeusseres
Oelberg
Kapelle