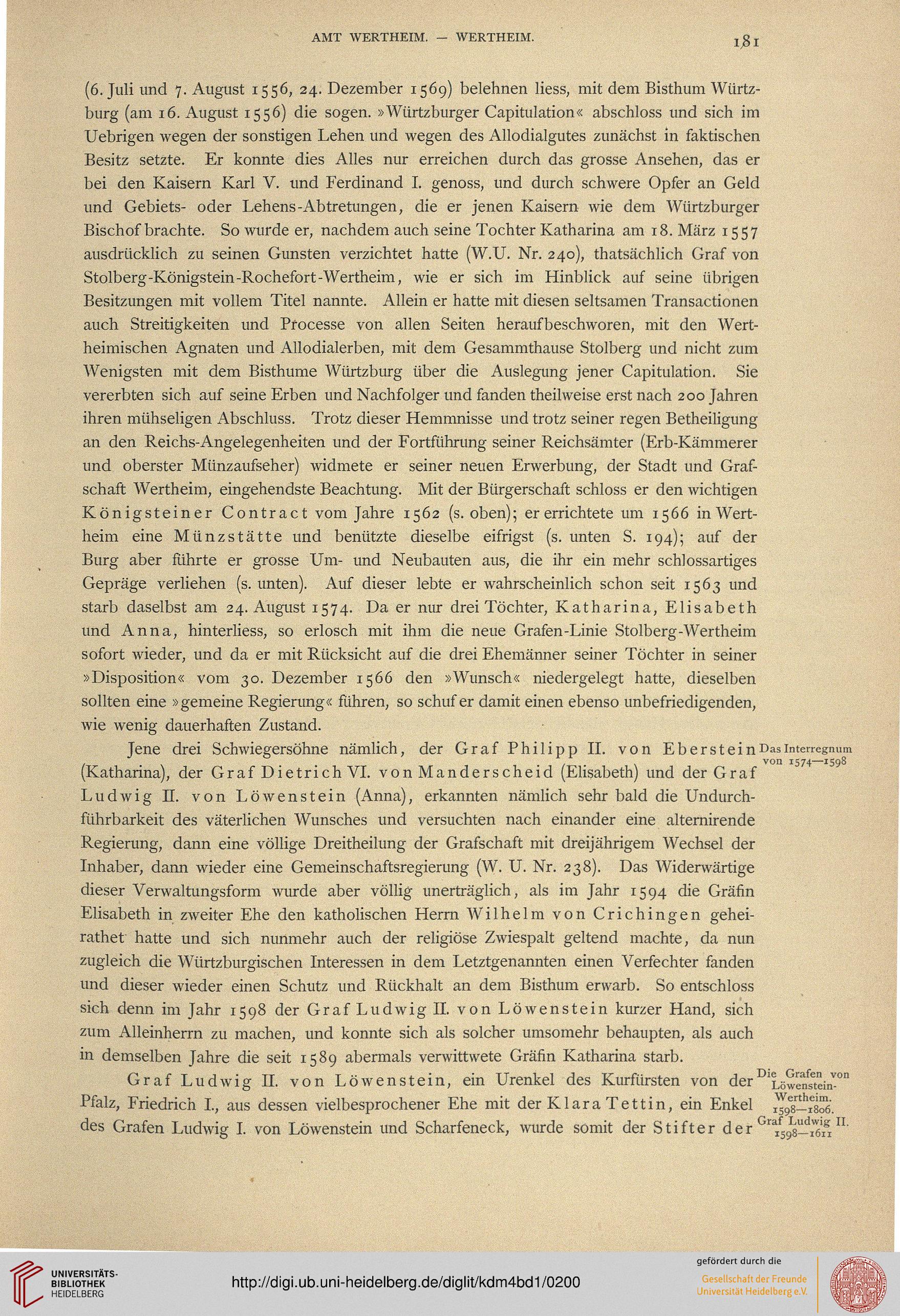AMT WERTHEIM.
WERTHEIM.
1J81
(6. Juli und 7. August 1556, 24. Dezember 1569) belehnen Hess, mit dem Bisthum Würtz-
burg (am 16. August 1556) die sogen. »Würtzburger Capitulation« abschloss und sich im
Uebrigen wegen der sonstigen Lehen und wegen des Allodialgutes zunächst in faktischen
Besitz setzte. Er konnte dies Alles nur erreichen durch das grosse Ansehen, das er
bei den Kaisern Karl V. und Ferdinand I. genoss, und durch schwere Opfer an Geld
und Gebiets- oder Lehens-Abtretungen, die er jenen Kaisern wie dem Würtzburger
Bischof brachte. So wurde er, nachdem auch seine Tochter Katharina am 18. März 15 57
ausdrücklich zu seinen Gunsten verzichtet hatte (W.U. Nr. 240), thatsächlich Graf von
Stolberg-Königstein-Rochefort-Wertheim, wie er sich im Hinblick auf seine übrigen
Besitzungen mit vollem Titel nannte. Allein er hatte mit diesen seltsamen Transactionen
auch Streitigkeiten und Pfocesse von allen Seiten heraufbeschworen, mit den Wert-
heimischen Agnaten und Allodialerben, mit dem Gesammthause Stolberg und nicht zum
Wenigsten mit dem Bisthume Würtzburg über die Auslegung jener Capitulation. Sie
vererbten sich auf seine Erben und Nachfolger und fanden theilweise erst nach 200 Jahren
ihren mühseligen Abschluss. Trotz dieser Hemmnisse und trotz seiner regen Betheiligung
an den Reichs-Angelegenheiten und der Fortführung seiner Reichsämter (Erb-Kämmerer
und oberster Münzaufseher) widmete er seiner neuen Erwerbung, der Stadt und Graf-
schaft Wertheim, eingehendste Beachtung. Mit der Bürgerschaft schloss er den wichtigen
Königsteiner Contract vom Jahre 1562 (s. oben); er errichtete um 1566 in Wert-
heim eine Münzstätte und benützte dieselbe eifrigst (s. unten S. 194); auf der
Burg aber führte er grosse Um- und Neubauten aus, die ihr ein mehr schlossartiges
Gepräge verliehen (s. unten). Auf dieser lebte er wahrscheinlich schon seit 1563 und
starb daselbst am 24. August 1574. Da er nur drei Töchter, Katharina, Elisabeth
und Anna, hinterliess, so erlosch mit ihm die neue Grafen-Linie Stolberg-Wertheim
sofort wieder, und da er mit Rücksicht auf die drei Ehemänner seiner Töchter in seiner
»Disposition« vom 30. Dezember 1566 den »Wunsch« niedergelegt hatte, dieselben
sollten eine »gemeine Regierung« führen, so schuf er damit einen ebenso unbefriedigenden,
wie wenig dauerhaften Zustand.
Jene drei Schwiegersöhne nämlich, der Graf Philipp IL von Eberstein Das Interregnum
von 1574—1598
(Katharina), der Graf Dietrich VI. von Manderscheid (Elisabeth) und der Graf
Ludwig H. von Löwenstein (Anna), erkannten nämlich sehr bald die Undurch-
führbarkeit des väterlichen Wunsches und versuchten nach einander eine alternirende
Regierung, dann eine völlige Dreitheilung der Grafschaft mit dreijährigem Wechsel der
Inhaber, dann wieder eine Gemeinschaftsregierung (W. U. Nr. 238). Das Widerwärtige
dieser Verwaltungsform wurde aber völlig unerträglich, als im Jahr 1594 die Gräfin
Elisabeth in zweiter Ehe den katholischen Herrn Wilhelm von Crichingen gehei-
rathet hatte und sich nunmehr auch der religiöse Zwiespalt geltend machte, da nun
zugleich die Würtzburgischen Interessen in dem Letztgenannten einen Verfechter fanden
und dieser wieder einen Schutz und Rückhalt an dem Bisthum erwarb. So entschloss
sich denn im Jahr 1598 der Graf Ludwig II. von Löwenstein kurzer Hand, sich
zum Alleinherrn zu machen, und konnte sich als solcher umsomehr behaupten, als auch
in demselben Jahre die seit 1589 abermals verwittwete Gräfin Katharina starb.
Graf Ludwig II. von Löwenstein, ein Urenkel des Kurfürsten von derDlLsSen?teinTOn
Pfalz, Friedrich I, aus dessen vielbesprochener Ehe mit der Klara Tettin, ein Enkel ^s-S.
des Grafen Ludwig I. von Löwenstein und Scharfeneck, wurde somit der Stifter der G'%gs-^ "'
WERTHEIM.
1J81
(6. Juli und 7. August 1556, 24. Dezember 1569) belehnen Hess, mit dem Bisthum Würtz-
burg (am 16. August 1556) die sogen. »Würtzburger Capitulation« abschloss und sich im
Uebrigen wegen der sonstigen Lehen und wegen des Allodialgutes zunächst in faktischen
Besitz setzte. Er konnte dies Alles nur erreichen durch das grosse Ansehen, das er
bei den Kaisern Karl V. und Ferdinand I. genoss, und durch schwere Opfer an Geld
und Gebiets- oder Lehens-Abtretungen, die er jenen Kaisern wie dem Würtzburger
Bischof brachte. So wurde er, nachdem auch seine Tochter Katharina am 18. März 15 57
ausdrücklich zu seinen Gunsten verzichtet hatte (W.U. Nr. 240), thatsächlich Graf von
Stolberg-Königstein-Rochefort-Wertheim, wie er sich im Hinblick auf seine übrigen
Besitzungen mit vollem Titel nannte. Allein er hatte mit diesen seltsamen Transactionen
auch Streitigkeiten und Pfocesse von allen Seiten heraufbeschworen, mit den Wert-
heimischen Agnaten und Allodialerben, mit dem Gesammthause Stolberg und nicht zum
Wenigsten mit dem Bisthume Würtzburg über die Auslegung jener Capitulation. Sie
vererbten sich auf seine Erben und Nachfolger und fanden theilweise erst nach 200 Jahren
ihren mühseligen Abschluss. Trotz dieser Hemmnisse und trotz seiner regen Betheiligung
an den Reichs-Angelegenheiten und der Fortführung seiner Reichsämter (Erb-Kämmerer
und oberster Münzaufseher) widmete er seiner neuen Erwerbung, der Stadt und Graf-
schaft Wertheim, eingehendste Beachtung. Mit der Bürgerschaft schloss er den wichtigen
Königsteiner Contract vom Jahre 1562 (s. oben); er errichtete um 1566 in Wert-
heim eine Münzstätte und benützte dieselbe eifrigst (s. unten S. 194); auf der
Burg aber führte er grosse Um- und Neubauten aus, die ihr ein mehr schlossartiges
Gepräge verliehen (s. unten). Auf dieser lebte er wahrscheinlich schon seit 1563 und
starb daselbst am 24. August 1574. Da er nur drei Töchter, Katharina, Elisabeth
und Anna, hinterliess, so erlosch mit ihm die neue Grafen-Linie Stolberg-Wertheim
sofort wieder, und da er mit Rücksicht auf die drei Ehemänner seiner Töchter in seiner
»Disposition« vom 30. Dezember 1566 den »Wunsch« niedergelegt hatte, dieselben
sollten eine »gemeine Regierung« führen, so schuf er damit einen ebenso unbefriedigenden,
wie wenig dauerhaften Zustand.
Jene drei Schwiegersöhne nämlich, der Graf Philipp IL von Eberstein Das Interregnum
von 1574—1598
(Katharina), der Graf Dietrich VI. von Manderscheid (Elisabeth) und der Graf
Ludwig H. von Löwenstein (Anna), erkannten nämlich sehr bald die Undurch-
führbarkeit des väterlichen Wunsches und versuchten nach einander eine alternirende
Regierung, dann eine völlige Dreitheilung der Grafschaft mit dreijährigem Wechsel der
Inhaber, dann wieder eine Gemeinschaftsregierung (W. U. Nr. 238). Das Widerwärtige
dieser Verwaltungsform wurde aber völlig unerträglich, als im Jahr 1594 die Gräfin
Elisabeth in zweiter Ehe den katholischen Herrn Wilhelm von Crichingen gehei-
rathet hatte und sich nunmehr auch der religiöse Zwiespalt geltend machte, da nun
zugleich die Würtzburgischen Interessen in dem Letztgenannten einen Verfechter fanden
und dieser wieder einen Schutz und Rückhalt an dem Bisthum erwarb. So entschloss
sich denn im Jahr 1598 der Graf Ludwig II. von Löwenstein kurzer Hand, sich
zum Alleinherrn zu machen, und konnte sich als solcher umsomehr behaupten, als auch
in demselben Jahre die seit 1589 abermals verwittwete Gräfin Katharina starb.
Graf Ludwig II. von Löwenstein, ein Urenkel des Kurfürsten von derDlLsSen?teinTOn
Pfalz, Friedrich I, aus dessen vielbesprochener Ehe mit der Klara Tettin, ein Enkel ^s-S.
des Grafen Ludwig I. von Löwenstein und Scharfeneck, wurde somit der Stifter der G'%gs-^ "'