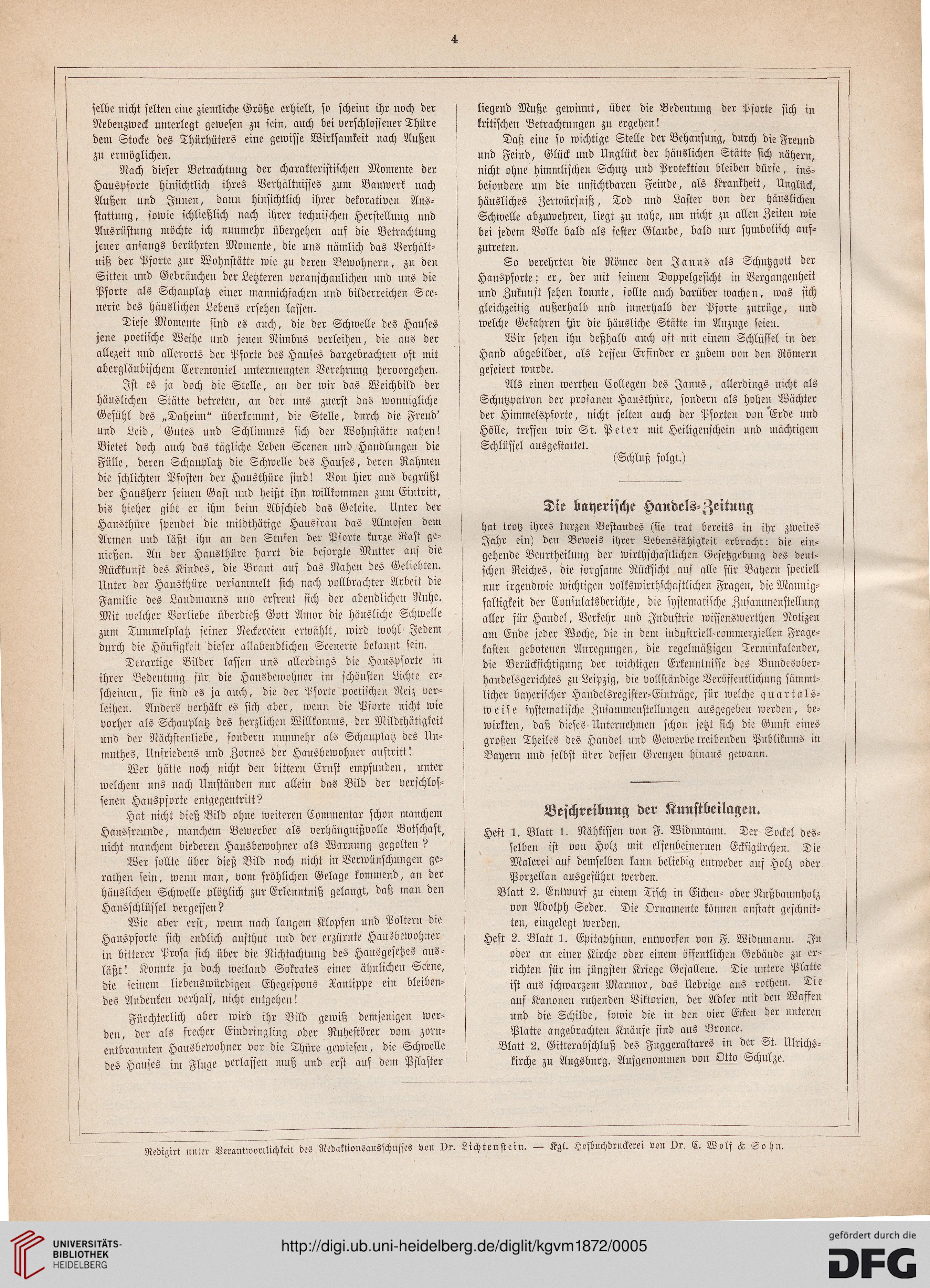4
selbe nicht selten eine ziemliche Größe erhielt, so scheint ihr noch der
Nebenzweck unterlegt gewesen zu sein, auch bei verschlossener Thüre
dem Stocke des Thürhüters eine gewisse Wirksamkeit nach Außen
zu ermöglichen.
Nach dieser Betrachtung der charakteristischen Momente der
Hauspforte hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Bauwerk nach
Außen und Innen, dann hinsichtlich ihrer dekorativen Aus-
stattung, sowie schließlich nach ihrer technischen Herstellung und
Ausrüstung möchte ich nunmehr übergehen auf die Betrachtung
jener anfangs berührten Momente, die uns nämlich das Verhält- >
niß der Pforte zur Wohnstätte wie zu deren Bewohnern, zu den
Sitten und Gebräuchen der Letzteren veranschaulichen und uns die
Pforte als Schauplatz einer mannichfachen und bilderreichen Sce-
nerie des häuslichen Lebens ersehen lassen.
Diese Momente sind es auch, die der Schwelle des Hauses
jene poetische Weihe und jenen Nimbus verleihen, die aus der
allezeit und allerorts der Pforte des Hauses dargebrachten oft mit
abergläubischem Ceremoniel untermengten Verehrung hervorgehen.
Ist es ja doch die Stelle, an der wir das Weichbild der
häuslichen Stätte betreten, an der uns zuerst das wonnigliche
Gefühl des „Daheim" überkommt, die Stelle, durch die Freud'
und Leid, Gutes und Schlimmes sich der Wohnstätte nahen!
Bietet doch auch das tägliche Leben Scenen und Handlungen die
Fülle, deren Schauplatz die Schwelle des Hauses, deren Rahmen
die schlichten Pfosten der Hausthüre sind! Von hier aus begrüßt
der Hausherr seinen Gast und heißt ihn willkommen zum Eintritt,
bis hieher gibt er ihm beim Abschied das Geleite. Unter der
Hausthüre spendet die mildthätige Hausfrau das Almosen dem
Armen und läßt ihn an den Stufen der Pforte kurze Rast ge-
nießen. An der Hausthüre harrt die besorgte Mutter auf die
Rückkunft des Kindes, die Braut auf das Nahen des Geliebten.
Unter der Hausthüre versammelt sich nach vollbrachter Arbeit die
Familie des Landmanns und erfreut sich der abendlichen Ruhe.
Mit welcher Vorliebe überdieß Gott Amor die häusliche Schwelle
zum Tummelplatz seiner Neckereien erwählt, wird wohl Jedem
durch die Häufigkeit dieser allabendlichen Scenerie bekannt sein.
Derartige Bilder lassen uns allerdings die Hauspforte in
ihrer Bedeutung für die Hausbewohner im schönsten Lichte er-
scheinen, sie sind es ja auch, die der Pforte poetischen Reiz ver-
leihen. Anders verhält es sich aber, wenn die Pforte nicht wie
vorher als Schauplatz des herzlichen Willkomms, der Mildthütigkeit
und der Nächstenliebe, sondern nunmehr als Schauplatz des Un-
muthes, ltnsricdens und Zornes der Hausbewohner auftritt!
Wer hätte noch nicht den bittern Ernst empfunden, unter
welchem uns nach Umstünden nur allein das Bild der verschlos-
senen Hauspforte entgegentritt?
Hat nicht dieß Bild ohne weiteren Commentar schon manchem
Hausfreunde, manchem Bewerber als verhängnißvolle Botschaft,
nicht manchem biederen Hausbewohner als Warnung gegolten?
Wer sollte über dieß Bild noch nicht in Verwünschungen ge-
rathen sein, wenn man, vom fröhlichen Gelage kommend, an der
häuslichen Schwelle plötzlich zur Erkenntniß gelangt, daß man den
Hausschlüssel vergessen?
Wie aber erst, wenn nach langem Klopfen und Poltern die
Hanspsorte sich endlich aufthut und der erzürnte Hausbewohner
in bitterer Prosa sich über die Nichtachtung des Hausgesetzes aus-
läßt! Konnte ja doch weiland Sokrates einer ähnlichen Scene,
die seinem liebenswürdigen Ehegespons Pantippe ein bleiben-
des Andenken verhaft, nicht entgehen!
Fürchterlich aber wird ihr Bild gewiß demjenigen wer-
den, der als frecher Eindringling oder Ruhestörer vom zorn-
entbrannten Hausbewohner vor die Thüre gewiesen, die Schwelle
des Hauses im Fluge verlassen muß und erst auf dem Pflaster
liegend Muße gewinnt, über die Bedeutung der Pforte sich in
kritischen Betrachtungen zu ergehen!
Daß eine so wichtige Stelle der Behausung, durch die Freund
und Feind, Glück und Unglück der häuslichen Stätte sich nähern,
nicht ohne himmlischen Schutz und Protektion bleiben dürfe, ins-
besondere um die unsichtbaren Feinde, als Krankheit, Unglück,
häusliches Zerwürfniß, Tod und Laster von der häuslichen
Schwelle abzuwehren, liegt zu nahe, um nicht zu allen Zeiten wie
bei jedem Volke bald als fester Glaube, bald nur symbolisch auf-
zutreten.
So verehrten die Römer den Janus als Schutzgott der
Hauspforte; er, der mit seinem Doppelgesicht in Vergangenheit
und Zukunft sehen konnte, sollte auch darüber wachen, was sich
gleichzeitig außerhalb und innerhalb der Pforte zutrüge, und
welche Gefahren für die häusliche Stätte im Anzuge seien.
Wir sehen ihn deßhalb auch oft mit einem Schlüssel in der
Hand abgebildet, als dessen Erfinder er zudem von den Römern
gefeiert wurde.
Als einen werthen Collegen des Janus, allerdings nicht als
Schutzpatron der profanen Hausthüre, sondern als hohen Wächter
der Himmelspforte, nicht selten auch der Pforten von "Erde und
Hölle, treffen wir St. Peter mit Heiligenschein und mächtigem
Schlüssel ausgestattet.
(Schluß folgt.)
Die bayerische Handels-Zeitung
hat trotz ihres kurzen Bestandes (sie trat bereits in ihr zweites
Jahr ein) den Beweis ihrer Lebensfähigkeit erbracht: die ein-
gehende Bcurtheilung der wirthschaftlichen Gesetzgebung des deut-
schen Reiches, die sorgsame Rücksicht auf alle für Bayern speciell
nur irgendwie wichtigen volkswirthschaftlichen Fragen, die Mannig-
faltigkeit der Consulatsberichte, die systematische Zusamiuenstellung
aller für Handel, Verkehr und Industrie wissenswerthen Notizen
am Ende jeder Woche, die in dem industriell-commerziellen Frage-
kasten gebotenen Anregungen, die regelmäßigen Terminkalender,
die Berücksichtigung der wichtigen Erkenntnisse des Bundesober-
handelsgerichtes zu Leipzig, die vollständige Veröffentlichung sämmt-
licher bayerischer Handelsregister-Einträge, für welche quartals-
weise systematische Zusammenstellungen ausgegeben werden, be-
wirkten, daß dieses Unternehmen schon jetzt sich die Gunst eines
großen Theiles des Handel und Gewerbetreibenden Publikums in
Bayern und selbst über dessen Grenzen hinaus gewann.
Beschreibung der Kunstbcilagen.
Heft 1. Blatt 1. Nähkissen von F. Widnmann. Der Sockel des-
selben ist von Holz mit elfenbeinernen Eckfigürchen. Die
Malerei auf demselben kann beliebig entweder ans Holz oder
Porzellan ausgeführt werden.
Blatt 2. Entwurf zu einem Tisch in Eichen- oder Nußbaumholz
von Adolph Seder. Die Ornamente können anstatt geschnit-
ten, eingelegt werden.
Heft 2. Blatt 1. Epitaphium, entworfen von F. Widnmann. In
oder an einer Kirche oder einem öffentlichen Gebäude zu er-
richten für im jüngsten Kriege Gefallene. Die untere Platte
ist aus schwarzem Marmor, das Uebrige aus rothem. Die
auf Kanonen ruhenden Viktorien, der Adler mit den Waffen
und die Schilde, sowie die in den vier Ecken der unteren
Platte angebrachten Knäufe sind aus Bronce.
Blatt 2. Gitlerabschluß des Fuggeraltares in der St. Ulrichs-
kirche zu Augsburg. Ausgenommen von Otto Schulze.
i
Redigirt unter Verantwortlichkeit des Redaktionsausschusses von Dr. Lichtenstein. — Kgl. Hofbuchdruckerei von vr. C. Wolf & Sohn.
selbe nicht selten eine ziemliche Größe erhielt, so scheint ihr noch der
Nebenzweck unterlegt gewesen zu sein, auch bei verschlossener Thüre
dem Stocke des Thürhüters eine gewisse Wirksamkeit nach Außen
zu ermöglichen.
Nach dieser Betrachtung der charakteristischen Momente der
Hauspforte hinsichtlich ihres Verhältnisses zum Bauwerk nach
Außen und Innen, dann hinsichtlich ihrer dekorativen Aus-
stattung, sowie schließlich nach ihrer technischen Herstellung und
Ausrüstung möchte ich nunmehr übergehen auf die Betrachtung
jener anfangs berührten Momente, die uns nämlich das Verhält- >
niß der Pforte zur Wohnstätte wie zu deren Bewohnern, zu den
Sitten und Gebräuchen der Letzteren veranschaulichen und uns die
Pforte als Schauplatz einer mannichfachen und bilderreichen Sce-
nerie des häuslichen Lebens ersehen lassen.
Diese Momente sind es auch, die der Schwelle des Hauses
jene poetische Weihe und jenen Nimbus verleihen, die aus der
allezeit und allerorts der Pforte des Hauses dargebrachten oft mit
abergläubischem Ceremoniel untermengten Verehrung hervorgehen.
Ist es ja doch die Stelle, an der wir das Weichbild der
häuslichen Stätte betreten, an der uns zuerst das wonnigliche
Gefühl des „Daheim" überkommt, die Stelle, durch die Freud'
und Leid, Gutes und Schlimmes sich der Wohnstätte nahen!
Bietet doch auch das tägliche Leben Scenen und Handlungen die
Fülle, deren Schauplatz die Schwelle des Hauses, deren Rahmen
die schlichten Pfosten der Hausthüre sind! Von hier aus begrüßt
der Hausherr seinen Gast und heißt ihn willkommen zum Eintritt,
bis hieher gibt er ihm beim Abschied das Geleite. Unter der
Hausthüre spendet die mildthätige Hausfrau das Almosen dem
Armen und läßt ihn an den Stufen der Pforte kurze Rast ge-
nießen. An der Hausthüre harrt die besorgte Mutter auf die
Rückkunft des Kindes, die Braut auf das Nahen des Geliebten.
Unter der Hausthüre versammelt sich nach vollbrachter Arbeit die
Familie des Landmanns und erfreut sich der abendlichen Ruhe.
Mit welcher Vorliebe überdieß Gott Amor die häusliche Schwelle
zum Tummelplatz seiner Neckereien erwählt, wird wohl Jedem
durch die Häufigkeit dieser allabendlichen Scenerie bekannt sein.
Derartige Bilder lassen uns allerdings die Hauspforte in
ihrer Bedeutung für die Hausbewohner im schönsten Lichte er-
scheinen, sie sind es ja auch, die der Pforte poetischen Reiz ver-
leihen. Anders verhält es sich aber, wenn die Pforte nicht wie
vorher als Schauplatz des herzlichen Willkomms, der Mildthütigkeit
und der Nächstenliebe, sondern nunmehr als Schauplatz des Un-
muthes, ltnsricdens und Zornes der Hausbewohner auftritt!
Wer hätte noch nicht den bittern Ernst empfunden, unter
welchem uns nach Umstünden nur allein das Bild der verschlos-
senen Hauspforte entgegentritt?
Hat nicht dieß Bild ohne weiteren Commentar schon manchem
Hausfreunde, manchem Bewerber als verhängnißvolle Botschaft,
nicht manchem biederen Hausbewohner als Warnung gegolten?
Wer sollte über dieß Bild noch nicht in Verwünschungen ge-
rathen sein, wenn man, vom fröhlichen Gelage kommend, an der
häuslichen Schwelle plötzlich zur Erkenntniß gelangt, daß man den
Hausschlüssel vergessen?
Wie aber erst, wenn nach langem Klopfen und Poltern die
Hanspsorte sich endlich aufthut und der erzürnte Hausbewohner
in bitterer Prosa sich über die Nichtachtung des Hausgesetzes aus-
läßt! Konnte ja doch weiland Sokrates einer ähnlichen Scene,
die seinem liebenswürdigen Ehegespons Pantippe ein bleiben-
des Andenken verhaft, nicht entgehen!
Fürchterlich aber wird ihr Bild gewiß demjenigen wer-
den, der als frecher Eindringling oder Ruhestörer vom zorn-
entbrannten Hausbewohner vor die Thüre gewiesen, die Schwelle
des Hauses im Fluge verlassen muß und erst auf dem Pflaster
liegend Muße gewinnt, über die Bedeutung der Pforte sich in
kritischen Betrachtungen zu ergehen!
Daß eine so wichtige Stelle der Behausung, durch die Freund
und Feind, Glück und Unglück der häuslichen Stätte sich nähern,
nicht ohne himmlischen Schutz und Protektion bleiben dürfe, ins-
besondere um die unsichtbaren Feinde, als Krankheit, Unglück,
häusliches Zerwürfniß, Tod und Laster von der häuslichen
Schwelle abzuwehren, liegt zu nahe, um nicht zu allen Zeiten wie
bei jedem Volke bald als fester Glaube, bald nur symbolisch auf-
zutreten.
So verehrten die Römer den Janus als Schutzgott der
Hauspforte; er, der mit seinem Doppelgesicht in Vergangenheit
und Zukunft sehen konnte, sollte auch darüber wachen, was sich
gleichzeitig außerhalb und innerhalb der Pforte zutrüge, und
welche Gefahren für die häusliche Stätte im Anzuge seien.
Wir sehen ihn deßhalb auch oft mit einem Schlüssel in der
Hand abgebildet, als dessen Erfinder er zudem von den Römern
gefeiert wurde.
Als einen werthen Collegen des Janus, allerdings nicht als
Schutzpatron der profanen Hausthüre, sondern als hohen Wächter
der Himmelspforte, nicht selten auch der Pforten von "Erde und
Hölle, treffen wir St. Peter mit Heiligenschein und mächtigem
Schlüssel ausgestattet.
(Schluß folgt.)
Die bayerische Handels-Zeitung
hat trotz ihres kurzen Bestandes (sie trat bereits in ihr zweites
Jahr ein) den Beweis ihrer Lebensfähigkeit erbracht: die ein-
gehende Bcurtheilung der wirthschaftlichen Gesetzgebung des deut-
schen Reiches, die sorgsame Rücksicht auf alle für Bayern speciell
nur irgendwie wichtigen volkswirthschaftlichen Fragen, die Mannig-
faltigkeit der Consulatsberichte, die systematische Zusamiuenstellung
aller für Handel, Verkehr und Industrie wissenswerthen Notizen
am Ende jeder Woche, die in dem industriell-commerziellen Frage-
kasten gebotenen Anregungen, die regelmäßigen Terminkalender,
die Berücksichtigung der wichtigen Erkenntnisse des Bundesober-
handelsgerichtes zu Leipzig, die vollständige Veröffentlichung sämmt-
licher bayerischer Handelsregister-Einträge, für welche quartals-
weise systematische Zusammenstellungen ausgegeben werden, be-
wirkten, daß dieses Unternehmen schon jetzt sich die Gunst eines
großen Theiles des Handel und Gewerbetreibenden Publikums in
Bayern und selbst über dessen Grenzen hinaus gewann.
Beschreibung der Kunstbcilagen.
Heft 1. Blatt 1. Nähkissen von F. Widnmann. Der Sockel des-
selben ist von Holz mit elfenbeinernen Eckfigürchen. Die
Malerei auf demselben kann beliebig entweder ans Holz oder
Porzellan ausgeführt werden.
Blatt 2. Entwurf zu einem Tisch in Eichen- oder Nußbaumholz
von Adolph Seder. Die Ornamente können anstatt geschnit-
ten, eingelegt werden.
Heft 2. Blatt 1. Epitaphium, entworfen von F. Widnmann. In
oder an einer Kirche oder einem öffentlichen Gebäude zu er-
richten für im jüngsten Kriege Gefallene. Die untere Platte
ist aus schwarzem Marmor, das Uebrige aus rothem. Die
auf Kanonen ruhenden Viktorien, der Adler mit den Waffen
und die Schilde, sowie die in den vier Ecken der unteren
Platte angebrachten Knäufe sind aus Bronce.
Blatt 2. Gitlerabschluß des Fuggeraltares in der St. Ulrichs-
kirche zu Augsburg. Ausgenommen von Otto Schulze.
i
Redigirt unter Verantwortlichkeit des Redaktionsausschusses von Dr. Lichtenstein. — Kgl. Hofbuchdruckerei von vr. C. Wolf & Sohn.