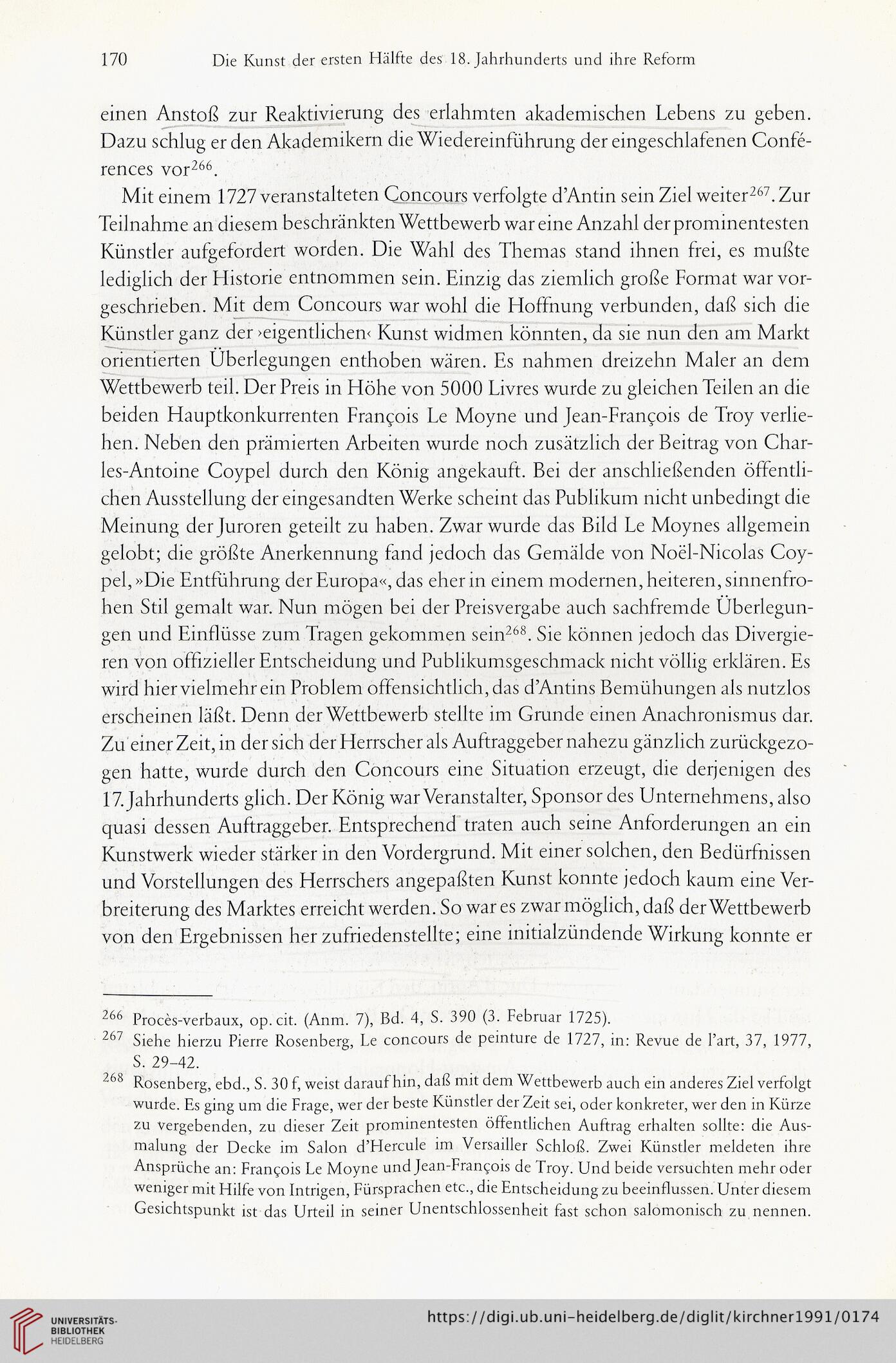170
Die Kunst der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ihre Reform
einen Anstoß zur Reaktivierung des erlahmten akademischen Lebens zu geben.
Dazu schlug er den Akademikern die Wiedereinführung der eingeschlafenen Confé-
rences vor266.
Mit einem 1727 veranstalteten Concours verfolgte d'Antin sein Ziel weiter267. Zur
Teilnahme an diesem beschränkten Wettbewerb war eine Anzahl der prominentesten
Künstler aufgefordert worden. Die Wahl des Themas stand ihnen frei, es mußte
lediglich der Historie entnommen sein. Einzig das ziemlich große Format war vor-
geschrieben. Mit dem Concours war wohl die Hoffnung verbunden, daß sich die
Künstler ganz der »eigentlichem Kunst widmen könnten, da sie nun den am Markt
orientierten Überlegungen enthoben wären. Es nahmen dreizehn Maler an dem
Wettbewerb teil. Der Preis in Höhe von 5000 Livres wurde zu gleichen Teilen an die
beiden Hauptkonkurrenten François Le Moyne und Jean-François de Troy verlie-
hen. Neben den prämierten Arbeiten wurde noch zusätzlich der Beitrag von Char-
les-Antoine Coypel durch den König angekauft. Bei der anschließenden öffentli-
chen Ausstellung der eingesandten Werke scheint das Publikum nicht unbedingt die
Meinung der Juroren geteilt zu haben. Zwar wurde das Bild Le Moynes allgemein
gelobt; die größte Anerkennung fand jedoch das Gemälde von Noël-Nicolas Coy-
pel, »Die Entführung der Europa«, das eher in einem modernen, heiteren, sinnenfro-
hen Stil gemalt war. Nun mögen bei der Preisvergabe auch sachfremde Überlegun-
gen und Einflüsse zum Tragen gekommen sein268. Sie können jedoch das Divergie-
ren von offizieller Entscheidung und Publikumsgeschmack nicht völlig erklären. Es
wird hier vielmehr ein Problem offensichtlich, das d'Antins Bemühungen als nutzlos
erscheinen läßt. Denn der Wettbewerb stellte im Grunde einen Anachronismus dar.
Zu einer Zeit, in der sich der Herrscher als Auftraggeber nahezu gänzlich zurückgezo-
gen hatte, wurde durch den Concours eine Situation erzeugt, die derjenigen des
17.Jahrhunderts glich. Der König war Veranstalter, Sponsor des Unternehmens, also
quasi dessen Auftraggeber. Entsprechend traten auch seine Anforderungen an ein
Kunstwerk wieder stärker in den Vordergrund. Mit einer solchen, den Bedürfnissen
und Vorstellungen des Herrschers angepaßten Kunst konnte jedoch kaum eine Ver-
breiterung des Marktes erreicht werden. So war es zwar möglich, daß der Wettbewerb
von den Ergebnissen her zufriedenstellte; eine initialzündende Wirkung konnte er
266 Procès-verbaux, op.cit. (Anm. 7), Bd. 4, S. 390 (3. Februar 1725).
267 Siehe hierzu Pierre Rosenberg, Le concours de peinture de 1727, in: Revue de l'art, 37, 1977,
S. 29-42.
268 Rosenberg, ebd., S. 30 f, weist daraufhin, daß mit dem Wettbewerb auch ein anderes Ziel verfolgt
wurde. Es ging um die Frage, wer der beste Künstler der Zeit sei, oder konkreter, wer den in Kürze
zu Vergebenden, zu dieser Zeit prominentesten öffentlichen Auftrag erhalten sollte: die Aus-
malung der Decke im Salon d'Hercule im Versailler Schloß. Zwei Künstler meldeten ihre
Ansprüche an: François Le Moyne und Jean-François de Troy. Und beide versuchten mehr oder
weniger mit Hilfe von Intrigen, Fürsprachen etc., die Entscheidung zu beeinflussen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist das Urteil in seiner Unentschlossenheit fast schon salomonisch zu nennen.
Die Kunst der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ihre Reform
einen Anstoß zur Reaktivierung des erlahmten akademischen Lebens zu geben.
Dazu schlug er den Akademikern die Wiedereinführung der eingeschlafenen Confé-
rences vor266.
Mit einem 1727 veranstalteten Concours verfolgte d'Antin sein Ziel weiter267. Zur
Teilnahme an diesem beschränkten Wettbewerb war eine Anzahl der prominentesten
Künstler aufgefordert worden. Die Wahl des Themas stand ihnen frei, es mußte
lediglich der Historie entnommen sein. Einzig das ziemlich große Format war vor-
geschrieben. Mit dem Concours war wohl die Hoffnung verbunden, daß sich die
Künstler ganz der »eigentlichem Kunst widmen könnten, da sie nun den am Markt
orientierten Überlegungen enthoben wären. Es nahmen dreizehn Maler an dem
Wettbewerb teil. Der Preis in Höhe von 5000 Livres wurde zu gleichen Teilen an die
beiden Hauptkonkurrenten François Le Moyne und Jean-François de Troy verlie-
hen. Neben den prämierten Arbeiten wurde noch zusätzlich der Beitrag von Char-
les-Antoine Coypel durch den König angekauft. Bei der anschließenden öffentli-
chen Ausstellung der eingesandten Werke scheint das Publikum nicht unbedingt die
Meinung der Juroren geteilt zu haben. Zwar wurde das Bild Le Moynes allgemein
gelobt; die größte Anerkennung fand jedoch das Gemälde von Noël-Nicolas Coy-
pel, »Die Entführung der Europa«, das eher in einem modernen, heiteren, sinnenfro-
hen Stil gemalt war. Nun mögen bei der Preisvergabe auch sachfremde Überlegun-
gen und Einflüsse zum Tragen gekommen sein268. Sie können jedoch das Divergie-
ren von offizieller Entscheidung und Publikumsgeschmack nicht völlig erklären. Es
wird hier vielmehr ein Problem offensichtlich, das d'Antins Bemühungen als nutzlos
erscheinen läßt. Denn der Wettbewerb stellte im Grunde einen Anachronismus dar.
Zu einer Zeit, in der sich der Herrscher als Auftraggeber nahezu gänzlich zurückgezo-
gen hatte, wurde durch den Concours eine Situation erzeugt, die derjenigen des
17.Jahrhunderts glich. Der König war Veranstalter, Sponsor des Unternehmens, also
quasi dessen Auftraggeber. Entsprechend traten auch seine Anforderungen an ein
Kunstwerk wieder stärker in den Vordergrund. Mit einer solchen, den Bedürfnissen
und Vorstellungen des Herrschers angepaßten Kunst konnte jedoch kaum eine Ver-
breiterung des Marktes erreicht werden. So war es zwar möglich, daß der Wettbewerb
von den Ergebnissen her zufriedenstellte; eine initialzündende Wirkung konnte er
266 Procès-verbaux, op.cit. (Anm. 7), Bd. 4, S. 390 (3. Februar 1725).
267 Siehe hierzu Pierre Rosenberg, Le concours de peinture de 1727, in: Revue de l'art, 37, 1977,
S. 29-42.
268 Rosenberg, ebd., S. 30 f, weist daraufhin, daß mit dem Wettbewerb auch ein anderes Ziel verfolgt
wurde. Es ging um die Frage, wer der beste Künstler der Zeit sei, oder konkreter, wer den in Kürze
zu Vergebenden, zu dieser Zeit prominentesten öffentlichen Auftrag erhalten sollte: die Aus-
malung der Decke im Salon d'Hercule im Versailler Schloß. Zwei Künstler meldeten ihre
Ansprüche an: François Le Moyne und Jean-François de Troy. Und beide versuchten mehr oder
weniger mit Hilfe von Intrigen, Fürsprachen etc., die Entscheidung zu beeinflussen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist das Urteil in seiner Unentschlossenheit fast schon salomonisch zu nennen.