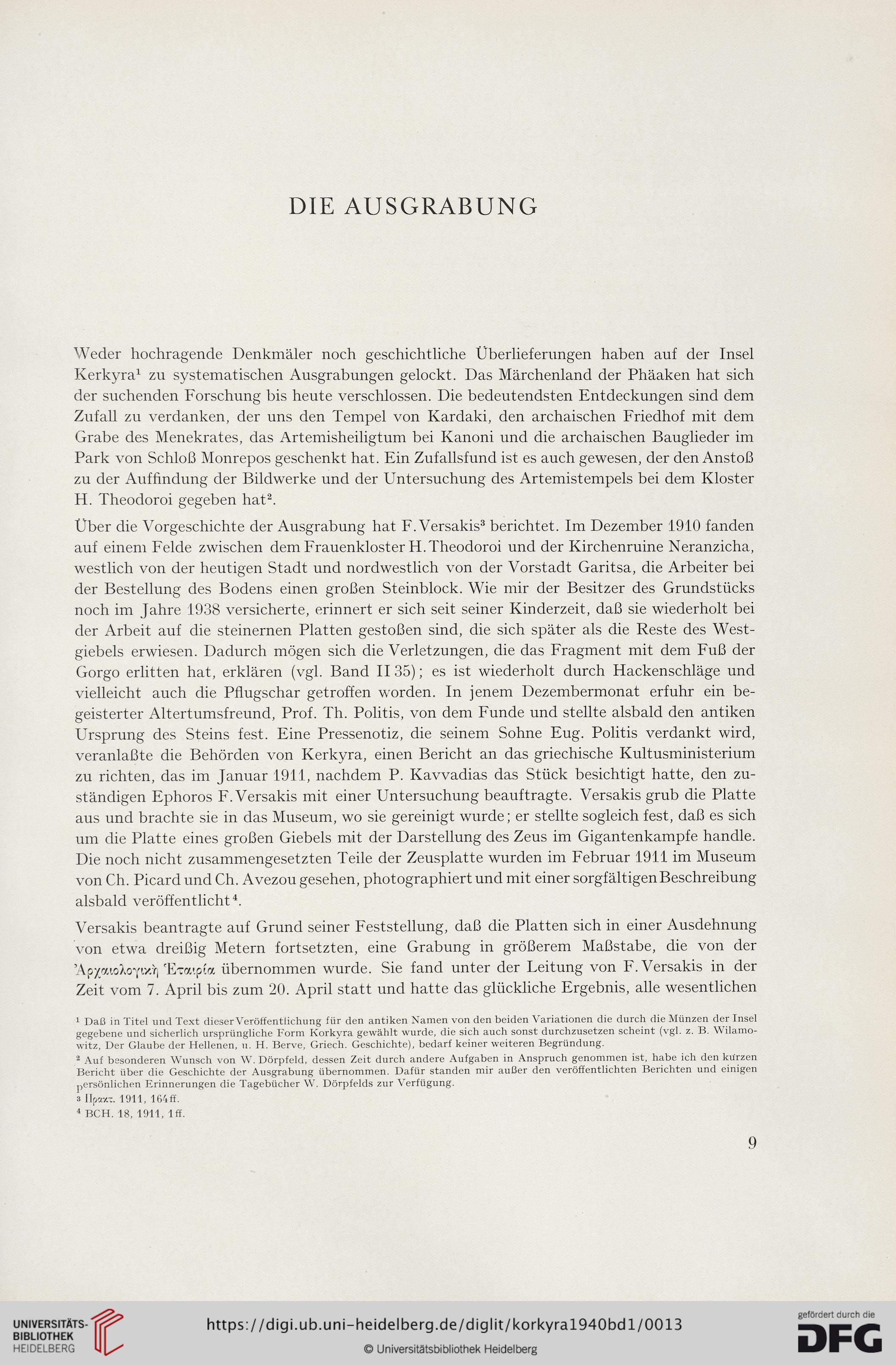DIE AUSGRABUNG
Weder hochragende Denkmäler noch geschichtliche Überlieferungen haben auf der Insel
Kerkyra1 zu systematischen Ausgrabungen gelockt. Das Märchenland der Phäaken hat sich
der suchenden Forschung bis heute verschlossen. Die bedeutendsten Entdeckungen sind dem
Zufall zu verdanken, der uns den Tempel von Kardaki, den archaischen Friedhof mit dem
Grabe des Menekrates, das Artemisheiligtum bei Kanoni und die archaischen Bauglieder im
Park von Schloß Monrepos geschenkt hat. Ein Zufallsfund ist es auch gewesen, der den Anstoß
zu der Auffindung der Bildwerke und der Untersuchung des Artemistempels bei dem Kloster
H. Theodoroi gegeben hat2.
Uber die Vorgeschichte der Ausgrabung hat F. Versakis3 berichtet. Im Dezember 1910 fanden
auf einem Felde zwischen dem Frauenkloster H.Theodoroi und der Kirchenruine Neranzicha,
westlich von der heutigen Stadt und nordwestlich von der Vorstadt Garitsa, die Arbeiter bei
der Bestellung des Bodens einen großen Steinblock. Wie mir der Besitzer des Grundstücks
noch im Jahre 1938 versicherte, erinnert er sich seit seiner Kinderzeit, daß sie wiederholt bei
der Arbeit auf die steinernen Platten gestoßen sind, die sich später als die Reste des West-
giebels erwiesen. Dadurch mögen sich die Verletzungen, die das Fragment mit dem Fuß der
Gorgo erlitten hat, erklären (vgl. Band 1135); es ist wiederholt durch Hackenschläge und
vielleicht auch die Pflugschar getroffen worden. In jenem Dezembermonat erfuhr ein be-
geisterter Altertumsfreund, Prof. Th. Politis, von dem Funde und stellte alsbald den antiken
Ursprung des Steins fest. Eine Pressenotiz, die seinem Sohne Eug. Politis verdankt wird,
veranlaßte die Behörden von Kerkyra, einen Bericht an das griechische Kultusministerium
zu richten, das im Januar 1911, nachdem P. Kavvadias das Stück besichtigt hatte, den zu-
ständigen Ephoros F. Versakis mit einer Untersuchung beauftragte. Versakis grub die Platte
aus und brachte sie in das Museum, wo sie gereinigt wurde; er stellte sogleich fest, daß es sich
um die Platte eines großen Giebels mit der Darstellung des Zeus im Gigantenkampfe handle.
Die noch nicht zusammengesetzten Teile der Zeusplatte wurden im Februar 1911 im Museum
von Ch. Picard und Ch. Avezou gesehen, photographiert und mit einer sorgfältigen Beschreibung
alsbald veröffentlicht4.
Versakis beantragte auf Grund seiner Feststellung, daß die Platten sich in einer Ausdehnung
von etwa dreißig Metern fortsetzten, eine Grabung in größerem Maßstabe, die von der
’Ap/atoXoYtx'q Tka-pG übernommen wurde. Sie fand unter der Leitung von F. Versakis in der
Zeit vom 7. April bis zum 20. April statt und hatte das glückliche Ergebnis, alle wesentlichen
1 Daß in Titel und Text dieserVeröffentlichung für den antiken Namen von den beiden Variationen die durch die Münzen der Insel
gegebene und sicherlich ursprüngliche Form Korkyra gewählt wurde, die sich auch sonst durchzusetzen scheint (vgl. z. B. Wilamo-
witz, Der Glaube der Hellenen, u. H. Berve, Griech. Geschichte), bedarf keiner weiteren Begründung.
2 Auf besonderen Wunsch von W. Dörpfeld, dessen Zeit durch andere Aufgaben in Anspruch genommen ist, habe ich den kürzen
Bericht über die Geschichte der Ausgrabung übernommen. Dafür standen mir außer den veröffentlichten Berichten und einigen
persönlichen Erinnerungen die Tagebücher W. Dörpfelds zur Verfügung.
3 llpa-z-, 1911, 164ff.
4 BCH. 18, 1911, Iff.
9
Weder hochragende Denkmäler noch geschichtliche Überlieferungen haben auf der Insel
Kerkyra1 zu systematischen Ausgrabungen gelockt. Das Märchenland der Phäaken hat sich
der suchenden Forschung bis heute verschlossen. Die bedeutendsten Entdeckungen sind dem
Zufall zu verdanken, der uns den Tempel von Kardaki, den archaischen Friedhof mit dem
Grabe des Menekrates, das Artemisheiligtum bei Kanoni und die archaischen Bauglieder im
Park von Schloß Monrepos geschenkt hat. Ein Zufallsfund ist es auch gewesen, der den Anstoß
zu der Auffindung der Bildwerke und der Untersuchung des Artemistempels bei dem Kloster
H. Theodoroi gegeben hat2.
Uber die Vorgeschichte der Ausgrabung hat F. Versakis3 berichtet. Im Dezember 1910 fanden
auf einem Felde zwischen dem Frauenkloster H.Theodoroi und der Kirchenruine Neranzicha,
westlich von der heutigen Stadt und nordwestlich von der Vorstadt Garitsa, die Arbeiter bei
der Bestellung des Bodens einen großen Steinblock. Wie mir der Besitzer des Grundstücks
noch im Jahre 1938 versicherte, erinnert er sich seit seiner Kinderzeit, daß sie wiederholt bei
der Arbeit auf die steinernen Platten gestoßen sind, die sich später als die Reste des West-
giebels erwiesen. Dadurch mögen sich die Verletzungen, die das Fragment mit dem Fuß der
Gorgo erlitten hat, erklären (vgl. Band 1135); es ist wiederholt durch Hackenschläge und
vielleicht auch die Pflugschar getroffen worden. In jenem Dezembermonat erfuhr ein be-
geisterter Altertumsfreund, Prof. Th. Politis, von dem Funde und stellte alsbald den antiken
Ursprung des Steins fest. Eine Pressenotiz, die seinem Sohne Eug. Politis verdankt wird,
veranlaßte die Behörden von Kerkyra, einen Bericht an das griechische Kultusministerium
zu richten, das im Januar 1911, nachdem P. Kavvadias das Stück besichtigt hatte, den zu-
ständigen Ephoros F. Versakis mit einer Untersuchung beauftragte. Versakis grub die Platte
aus und brachte sie in das Museum, wo sie gereinigt wurde; er stellte sogleich fest, daß es sich
um die Platte eines großen Giebels mit der Darstellung des Zeus im Gigantenkampfe handle.
Die noch nicht zusammengesetzten Teile der Zeusplatte wurden im Februar 1911 im Museum
von Ch. Picard und Ch. Avezou gesehen, photographiert und mit einer sorgfältigen Beschreibung
alsbald veröffentlicht4.
Versakis beantragte auf Grund seiner Feststellung, daß die Platten sich in einer Ausdehnung
von etwa dreißig Metern fortsetzten, eine Grabung in größerem Maßstabe, die von der
’Ap/atoXoYtx'q Tka-pG übernommen wurde. Sie fand unter der Leitung von F. Versakis in der
Zeit vom 7. April bis zum 20. April statt und hatte das glückliche Ergebnis, alle wesentlichen
1 Daß in Titel und Text dieserVeröffentlichung für den antiken Namen von den beiden Variationen die durch die Münzen der Insel
gegebene und sicherlich ursprüngliche Form Korkyra gewählt wurde, die sich auch sonst durchzusetzen scheint (vgl. z. B. Wilamo-
witz, Der Glaube der Hellenen, u. H. Berve, Griech. Geschichte), bedarf keiner weiteren Begründung.
2 Auf besonderen Wunsch von W. Dörpfeld, dessen Zeit durch andere Aufgaben in Anspruch genommen ist, habe ich den kürzen
Bericht über die Geschichte der Ausgrabung übernommen. Dafür standen mir außer den veröffentlichten Berichten und einigen
persönlichen Erinnerungen die Tagebücher W. Dörpfelds zur Verfügung.
3 llpa-z-, 1911, 164ff.
4 BCH. 18, 1911, Iff.
9