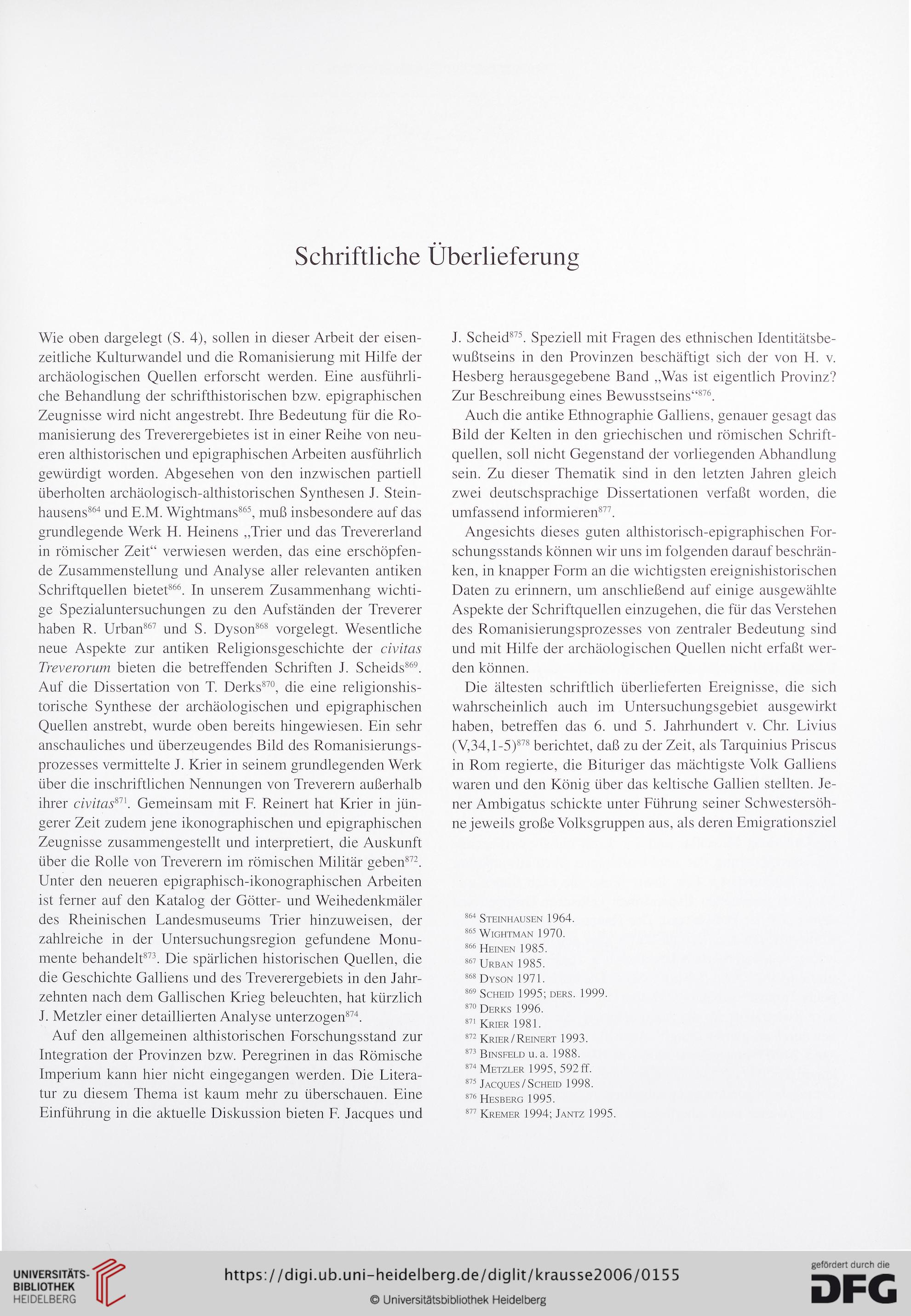Schriftliche Überlieferung
Wie oben dargelegt (S. 4), sollen in dieser Arbeit der eisen-
zeitliche Kulturwandel und die Romanisierung mit Hilfe der
archäologischen Quellen erforscht werden. Eine ausführli-
che Behandlung der schrifthistorischen bzw. epigraphischen
Zeugnisse wird nicht angestrebt. Ihre Bedeutung für die Ro-
manisierung des Treverergebietes ist in einer Reihe von neu-
eren althistorischen und epigraphischen Arbeiten ausführlich
gewürdigt worden. Abgesehen von den inzwischen partiell
überholten archäologisch-althistorischen Synthesen J. Stein-
hausens864 und E.M. Wightmans865, muß insbesondere auf das
grundlegende Werk H. Heinens „Trier und das Trevererland
in römischer Zeit“ verwiesen werden, das eine erschöpfen-
de Zusammenstellung und Analyse aller relevanten antiken
Schriftquellen bietet866. In unserem Zusammenhang wichti-
ge Spezialuntersuchungen zu den Aufständen der Treverer
haben R. Urban867 und S. Dyson868 vorgelegt. Wesentliche
neue Aspekte zur antiken Religionsgeschichte der civitas
Treverorum bieten die betreffenden Schriften J. Scheids869.
Auf die Dissertation von T. Derks870, die eine religionshis-
torische Synthese der archäologischen und epigraphischen
Quellen anstrebt, wurde oben bereits hingewiesen. Ein sehr
anschauliches und überzeugendes Bild des Romanisierungs-
prozesses vermittelte J. Krier in seinem grundlegenden Werk
über die inschriftlichen Nennungen von Treverern außerhalb
ihrer civitas8'11. Gemeinsam mit E Reinert hat Krier in jün-
gerer Zeit zudem jene ikonographischen und epigraphischen
Zeugnisse zusammengestellt und interpretiert, die Auskunft
über die Rolle von Treverern im römischen Militär geben872.
Unter den neueren epigraphisch-ikonographischen Arbeiten
ist ferner auf den Katalog der Götter- und Weihedenkmäler
des Rheinischen Landesmuseums Trier hinzuweisen, der
zahlreiche in der Untersuchungsregion gefundene Monu-
mente behandelt873. Die spärlichen historischen Quellen, die
die Geschichte Galliens und des Treverergebiets in den Jahr-
zehnten nach dem Gallischen Krieg beleuchten, hat kürzlich
I. Metzler einer detaillierten Analyse unterzogen874.
Auf den allgemeinen althistorischen Forschungsstand zur
Integration der Provinzen bzw. Peregrinen in das Römische
Imperium kann hier nicht eingegangen werden. Die Litera-
tur zu diesem Thema ist kaum mehr zu überschauen. Eine
Einführung in die aktuelle Diskussion bieten F. Jacques und
J. Scheid875. Speziell mit Fragen des ethnischen Identitätsbe-
wußtseins in den Provinzen beschäftigt sich der von H. v.
Hesberg herausgegebene Band „Was ist eigentlich Provinz?
Zur Beschreibung eines Bewusstseins“876.
Auch die antike Ethnographie Galliens, genauer gesagt das
Bild der Kelten in den griechischen und römischen Schrift-
quellen, soll nicht Gegenstand der vorliegenden Abhandlung
sein. Zu dieser Thematik sind in den letzten Jahren gleich
zwei deutschsprachige Dissertationen verfaßt worden, die
umfassend informieren877.
Angesichts dieses guten althistorisch-epigraphischen For-
schungsstands können wir uns im folgenden darauf beschrän-
ken, in knapper Form an die wichtigsten ereignishistorischen
Daten zu erinnern, um anschließend auf einige ausgewählte
Aspekte der Schriftquellen einzugehen, die für das Verstehen
des Romanisierungsprozesses von zentraler Bedeutung sind
und mit Hilfe der archäologischen Quellen nicht erfaßt wer-
den können.
Die ältesten schriftlich überlieferten Ereignisse, die sich
wahrscheinlich auch im Untersuchungsgebiet ausgewirkt
haben, betreffen das 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Livius
(V,34,l-5 ) 878 berichtet, daß zu der Zeit, als Tarquinius Priscus
in Rom regierte, die Bituriger das mächtigste Volk Galliens
waren und den König über das keltische Gallien stellten. Je-
ner Ambigatus schickte unter Führung seiner Schwestersöh-
ne jeweils große Volksgruppen aus, als deren Emigrationsziel
864 Steinhausen 1964.
865 Wightman 1970.
866 Heinen 1985.
867 Urban 1985.
868 Dyson 1971.
869 Scheid 1995; ders. 1999.
870 Derks 1996.
871 Krier 1981.
872 Krier/Reinert 1993.
873 Binsfeld u. a. 1988.
874 Metzler 1995, 592 ff.
875 Jacques/Scheid 1998.
876 Hesberg 1995.
877 Kremer 1994; Jantz 1995.
Wie oben dargelegt (S. 4), sollen in dieser Arbeit der eisen-
zeitliche Kulturwandel und die Romanisierung mit Hilfe der
archäologischen Quellen erforscht werden. Eine ausführli-
che Behandlung der schrifthistorischen bzw. epigraphischen
Zeugnisse wird nicht angestrebt. Ihre Bedeutung für die Ro-
manisierung des Treverergebietes ist in einer Reihe von neu-
eren althistorischen und epigraphischen Arbeiten ausführlich
gewürdigt worden. Abgesehen von den inzwischen partiell
überholten archäologisch-althistorischen Synthesen J. Stein-
hausens864 und E.M. Wightmans865, muß insbesondere auf das
grundlegende Werk H. Heinens „Trier und das Trevererland
in römischer Zeit“ verwiesen werden, das eine erschöpfen-
de Zusammenstellung und Analyse aller relevanten antiken
Schriftquellen bietet866. In unserem Zusammenhang wichti-
ge Spezialuntersuchungen zu den Aufständen der Treverer
haben R. Urban867 und S. Dyson868 vorgelegt. Wesentliche
neue Aspekte zur antiken Religionsgeschichte der civitas
Treverorum bieten die betreffenden Schriften J. Scheids869.
Auf die Dissertation von T. Derks870, die eine religionshis-
torische Synthese der archäologischen und epigraphischen
Quellen anstrebt, wurde oben bereits hingewiesen. Ein sehr
anschauliches und überzeugendes Bild des Romanisierungs-
prozesses vermittelte J. Krier in seinem grundlegenden Werk
über die inschriftlichen Nennungen von Treverern außerhalb
ihrer civitas8'11. Gemeinsam mit E Reinert hat Krier in jün-
gerer Zeit zudem jene ikonographischen und epigraphischen
Zeugnisse zusammengestellt und interpretiert, die Auskunft
über die Rolle von Treverern im römischen Militär geben872.
Unter den neueren epigraphisch-ikonographischen Arbeiten
ist ferner auf den Katalog der Götter- und Weihedenkmäler
des Rheinischen Landesmuseums Trier hinzuweisen, der
zahlreiche in der Untersuchungsregion gefundene Monu-
mente behandelt873. Die spärlichen historischen Quellen, die
die Geschichte Galliens und des Treverergebiets in den Jahr-
zehnten nach dem Gallischen Krieg beleuchten, hat kürzlich
I. Metzler einer detaillierten Analyse unterzogen874.
Auf den allgemeinen althistorischen Forschungsstand zur
Integration der Provinzen bzw. Peregrinen in das Römische
Imperium kann hier nicht eingegangen werden. Die Litera-
tur zu diesem Thema ist kaum mehr zu überschauen. Eine
Einführung in die aktuelle Diskussion bieten F. Jacques und
J. Scheid875. Speziell mit Fragen des ethnischen Identitätsbe-
wußtseins in den Provinzen beschäftigt sich der von H. v.
Hesberg herausgegebene Band „Was ist eigentlich Provinz?
Zur Beschreibung eines Bewusstseins“876.
Auch die antike Ethnographie Galliens, genauer gesagt das
Bild der Kelten in den griechischen und römischen Schrift-
quellen, soll nicht Gegenstand der vorliegenden Abhandlung
sein. Zu dieser Thematik sind in den letzten Jahren gleich
zwei deutschsprachige Dissertationen verfaßt worden, die
umfassend informieren877.
Angesichts dieses guten althistorisch-epigraphischen For-
schungsstands können wir uns im folgenden darauf beschrän-
ken, in knapper Form an die wichtigsten ereignishistorischen
Daten zu erinnern, um anschließend auf einige ausgewählte
Aspekte der Schriftquellen einzugehen, die für das Verstehen
des Romanisierungsprozesses von zentraler Bedeutung sind
und mit Hilfe der archäologischen Quellen nicht erfaßt wer-
den können.
Die ältesten schriftlich überlieferten Ereignisse, die sich
wahrscheinlich auch im Untersuchungsgebiet ausgewirkt
haben, betreffen das 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Livius
(V,34,l-5 ) 878 berichtet, daß zu der Zeit, als Tarquinius Priscus
in Rom regierte, die Bituriger das mächtigste Volk Galliens
waren und den König über das keltische Gallien stellten. Je-
ner Ambigatus schickte unter Führung seiner Schwestersöh-
ne jeweils große Volksgruppen aus, als deren Emigrationsziel
864 Steinhausen 1964.
865 Wightman 1970.
866 Heinen 1985.
867 Urban 1985.
868 Dyson 1971.
869 Scheid 1995; ders. 1999.
870 Derks 1996.
871 Krier 1981.
872 Krier/Reinert 1993.
873 Binsfeld u. a. 1988.
874 Metzler 1995, 592 ff.
875 Jacques/Scheid 1998.
876 Hesberg 1995.
877 Kremer 1994; Jantz 1995.