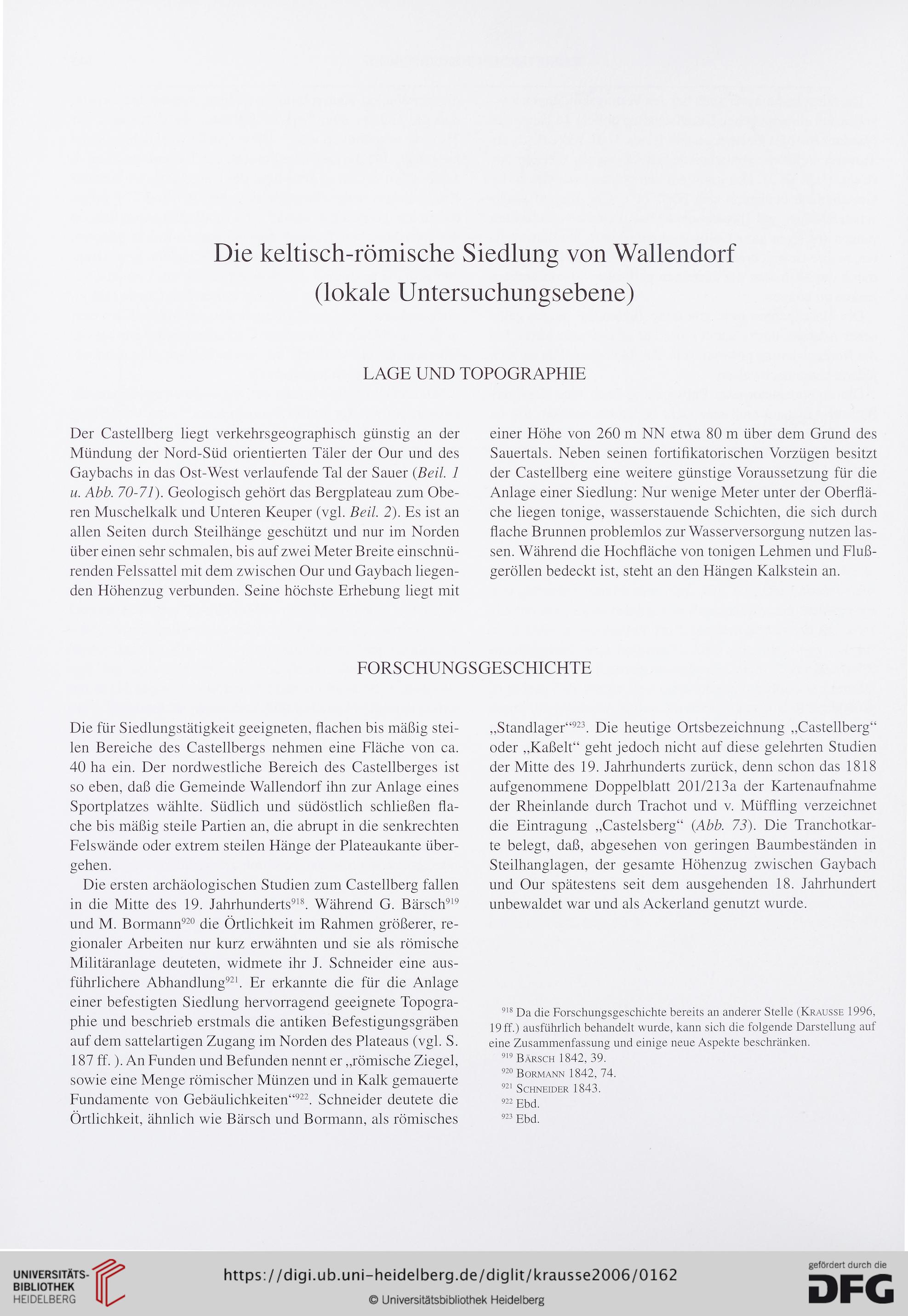Die keltisch-römische Siedlung von Wallendorf
(lokale Untersuchungsebene)
LAGE UND TOPOGRAPHIE
Der Castellberg liegt verkehrsgeographisch günstig an der
Mündung der Nord-Süd orientierten Täler der Our und des
Gaybachs in das Ost-West verlaufende Tal der Sauer (Beil. 1
u. Abb. 70-71). Geologisch gehört das Bergplateau zum Obe-
ren Muschelkalk und Unteren Keuper (vgl. Beil. 2). Es ist an
allen Seiten durch Steilhänge geschützt und nur im Norden
über einen sehr schmalen, bis auf zwei Meter Breite einschnü-
renden Felssattel mit dem zwischen Our und Gaybach liegen-
den Höhenzug verbunden. Seine höchste Erhebung liegt mit
einer Höhe von 260 m NN etwa 80 m über dem Grund des
Sauertals. Neben seinen fortifikatorischen Vorzügen besitzt
der Castellberg eine weitere günstige Voraussetzung für die
Anlage einer Siedlung: Nur wenige Meter unter der Oberflä-
che liegen tonige, wasserstauende Schichten, die sich durch
flache Brunnen problemlos zur Wasserversorgung nutzen las-
sen. Während die Hochfläche von tonigen Lehmen und Fluß-
geröllen bedeckt ist, steht an den Hängen Kalkstein an.
FORSCHUNGSGESCHICHTE
Die für Siedlungstätigkeit geeigneten, flachen bis mäßig stei-
len Bereiche des Castellbergs nehmen eine Fläche von ca.
40 ha ein. Der nordwestliche Bereich des Castellberges ist
so eben, daß die Gemeinde Wallendorf ihn zur Anlage eines
Sportplatzes wählte. Südlich und südöstlich schließen fla-
che bis mäßig steile Partien an, die abrupt in die senkrechten
Felswände oder extrem steilen Hänge der Plateaukante über-
gehen.
Die ersten archäologischen Studien zum Castellberg fallen
in die Mitte des 19. Jahrhunderts918. Während G. Bärsch919
und M. Bormann920 die Örtlichkeit im Rahmen größerer, re-
gionaler Arbeiten nur kurz erwähnten und sie als römische
Militäranlage deuteten, widmete ihr J. Schneider eine aus-
führlichere Abhandlung921. Er erkannte die für die Anlage
einer befestigten Siedlung hervorragend geeignete Topogra-
phie und beschrieb erstmals die antiken Befestigungsgräben
auf dem sattelartigen Zugang im Norden des Plateaus (vgl. S.
187 ff.). An Funden und Befunden nennt er „römische Ziegel,
sowie eine Menge römischer Münzen und in Kalk gemauerte
Fundamente von Gebäulichkeiten“922. Schneider deutete die
Örtlichkeit, ähnlich wie Bärsch und Bormann, als römisches
„Standlager“923. Die heutige Ortsbezeichnung „Castellberg“
oder „Kaßelt“ geht jedoch nicht auf diese gelehrten Studien
der Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, denn schon das 1818
aufgenommene Doppelblatt 201/213a der Kartenaufnahme
der Rheinlande durch Trachot und v. Müffling verzeichnet
die Eintragung „Casteisberg“ (Abb. 73). Die Tranchotkar-
te belegt, daß, abgesehen von geringen Baumbeständen in
Steilhanglagen, der gesamte Höhenzug zwischen Gaybach
und Our spätestens seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
unbewaldet war und als Ackerland genutzt wurde.
918 Da die Forschungsgeschichte bereits an anderer Stelle (Krausse 1996,
19 ff.) ausführlich behandelt wurde, kann sich die folgende Darstellung auf
eine Zusammenfassung und einige neue Aspekte beschränken.
919 Barsch 1842, 39.
920 Bormann 1842, 74.
921 Schneider 1843.
922 Ebd.
923 Ebd.
(lokale Untersuchungsebene)
LAGE UND TOPOGRAPHIE
Der Castellberg liegt verkehrsgeographisch günstig an der
Mündung der Nord-Süd orientierten Täler der Our und des
Gaybachs in das Ost-West verlaufende Tal der Sauer (Beil. 1
u. Abb. 70-71). Geologisch gehört das Bergplateau zum Obe-
ren Muschelkalk und Unteren Keuper (vgl. Beil. 2). Es ist an
allen Seiten durch Steilhänge geschützt und nur im Norden
über einen sehr schmalen, bis auf zwei Meter Breite einschnü-
renden Felssattel mit dem zwischen Our und Gaybach liegen-
den Höhenzug verbunden. Seine höchste Erhebung liegt mit
einer Höhe von 260 m NN etwa 80 m über dem Grund des
Sauertals. Neben seinen fortifikatorischen Vorzügen besitzt
der Castellberg eine weitere günstige Voraussetzung für die
Anlage einer Siedlung: Nur wenige Meter unter der Oberflä-
che liegen tonige, wasserstauende Schichten, die sich durch
flache Brunnen problemlos zur Wasserversorgung nutzen las-
sen. Während die Hochfläche von tonigen Lehmen und Fluß-
geröllen bedeckt ist, steht an den Hängen Kalkstein an.
FORSCHUNGSGESCHICHTE
Die für Siedlungstätigkeit geeigneten, flachen bis mäßig stei-
len Bereiche des Castellbergs nehmen eine Fläche von ca.
40 ha ein. Der nordwestliche Bereich des Castellberges ist
so eben, daß die Gemeinde Wallendorf ihn zur Anlage eines
Sportplatzes wählte. Südlich und südöstlich schließen fla-
che bis mäßig steile Partien an, die abrupt in die senkrechten
Felswände oder extrem steilen Hänge der Plateaukante über-
gehen.
Die ersten archäologischen Studien zum Castellberg fallen
in die Mitte des 19. Jahrhunderts918. Während G. Bärsch919
und M. Bormann920 die Örtlichkeit im Rahmen größerer, re-
gionaler Arbeiten nur kurz erwähnten und sie als römische
Militäranlage deuteten, widmete ihr J. Schneider eine aus-
führlichere Abhandlung921. Er erkannte die für die Anlage
einer befestigten Siedlung hervorragend geeignete Topogra-
phie und beschrieb erstmals die antiken Befestigungsgräben
auf dem sattelartigen Zugang im Norden des Plateaus (vgl. S.
187 ff.). An Funden und Befunden nennt er „römische Ziegel,
sowie eine Menge römischer Münzen und in Kalk gemauerte
Fundamente von Gebäulichkeiten“922. Schneider deutete die
Örtlichkeit, ähnlich wie Bärsch und Bormann, als römisches
„Standlager“923. Die heutige Ortsbezeichnung „Castellberg“
oder „Kaßelt“ geht jedoch nicht auf diese gelehrten Studien
der Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, denn schon das 1818
aufgenommene Doppelblatt 201/213a der Kartenaufnahme
der Rheinlande durch Trachot und v. Müffling verzeichnet
die Eintragung „Casteisberg“ (Abb. 73). Die Tranchotkar-
te belegt, daß, abgesehen von geringen Baumbeständen in
Steilhanglagen, der gesamte Höhenzug zwischen Gaybach
und Our spätestens seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
unbewaldet war und als Ackerland genutzt wurde.
918 Da die Forschungsgeschichte bereits an anderer Stelle (Krausse 1996,
19 ff.) ausführlich behandelt wurde, kann sich die folgende Darstellung auf
eine Zusammenfassung und einige neue Aspekte beschränken.
919 Barsch 1842, 39.
920 Bormann 1842, 74.
921 Schneider 1843.
922 Ebd.
923 Ebd.