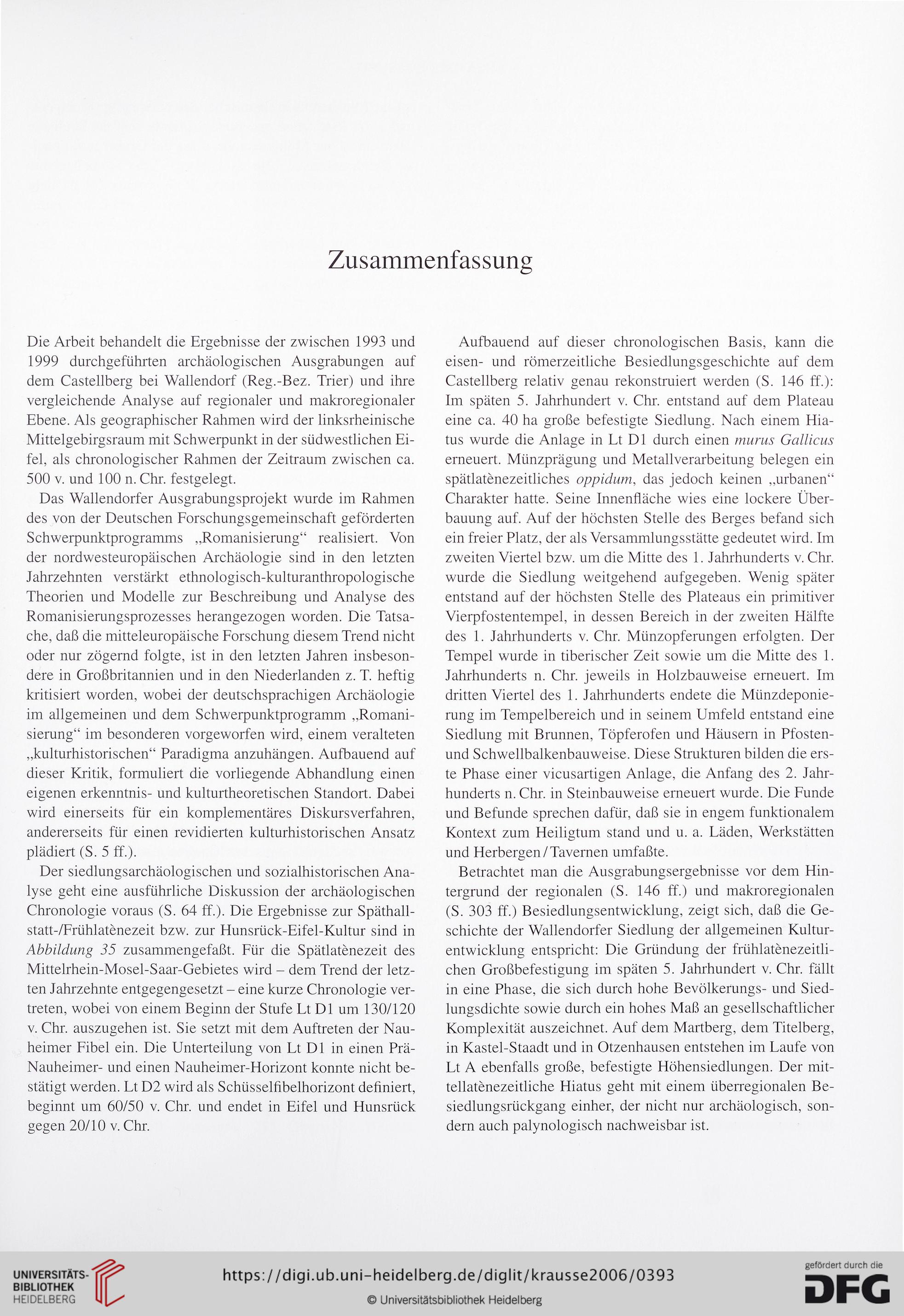Zusammenfassung
Die Arbeit behandelt die Ergebnisse der zwischen 1993 und
1999 durchgeführten archäologischen Ausgrabungen auf
dem Castellberg bei Wallendorf (Reg.-Bez. Trier) und ihre
vergleichende Analyse auf regionaler und makroregionaler
Ebene. Als geographischer Rahmen wird der linksrheinische
Mittelgebirgsraum mit Schwerpunkt in der südwestlichen Ei-
fel, als chronologischer Rahmen der Zeitraum zwischen ca.
500 v. und 100 n. Chr. festgelegt.
Das Wallendorfer Ausgrabungsprojekt wurde im Rahmen
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten
Schwerpunktprogramms „Romanisierung“ realisiert. Von
der nordwesteuropäischen Archäologie sind in den letzten
Jahrzehnten verstärkt ethnologisch-kulturanthropologische
Theorien und Modelle zur Beschreibung und Analyse des
Romanisierungsprozesses herangezogen worden. Die Tatsa-
che, daß die mitteleuropäische Forschung diesem Trend nicht
oder nur zögernd folgte, ist in den letzten Jahren insbeson-
dere in Großbritannien und in den Niederlanden z. T. heftig
kritisiert worden, wobei der deutschsprachigen Archäologie
im allgemeinen und dem Schwerpunktprogramm „Romani-
sierung“ im besonderen vorgeworfen wird, einem veralteten
„kulturhistorischen“ Paradigma anzuhängen. Aufbauend auf
dieser Kritik, formuliert die vorliegende Abhandlung einen
eigenen erkenntnis- und kulturtheoretischen Standort. Dabei
wird einerseits für ein komplementäres Diskursverfahren,
andererseits für einen revidierten kulturhistorischen Ansatz
plädiert (S. 5 ff.).
Der siedlungsarchäologischen und sozialhistorischen Ana-
lyse geht eine ausführliche Diskussion der archäologischen
Chronologie voraus (S. 64 ff.). Die Ergebnisse zur Späthall-
statt-/Frühlatenezeit bzw. zur Hunsrück-Eifel-Kultur sind in
Abbildung 35 zusammengefaßt. Für die Spätlatenezeit des
Mittelrhein-Mosel-Saar-Gebietes wird - dem Trend der letz-
ten Jahrzehnte entgegengesetzt - eine kurze Chronologie ver-
treten, wobei von einem Beginn der Stufe Lt Dl um 130/120
v. Chr. auszugehen ist. Sie setzt mit dem Auftreten der Nau-
heimer Fibel ein. Die Unterteilung von Lt Dl in einen Prä-
Nauheimer- und einen Nauheimer-Horizont konnte nicht be-
stätigt werden. Lt D2 wird als Schüsselübelhorizont definiert,
beginnt um 60/50 v. Chr. und endet in Eifel und Hunsrück
gegen 20/10 v. Chr.
Aufbauend auf dieser chronologischen Basis, kann die
eisen- und römerzeitliche Besiedlungsgeschichte auf dem
Castellberg relativ genau rekonstruiert werden (S. 146 ff.):
Im späten 5. Jahrhundert v. Chr. entstand auf dem Plateau
eine ca. 40 ha große befestigte Siedlung. Nach einem Hia-
tus wurde die Anlage in Lt Dl durch einen murus Galliens
erneuert. Münzprägung und Metallverarbeitung belegen ein
spätlatenezeitliches oppidum, das jedoch keinen „urbanen“
Charakter hatte. Seine Innenfläche wies eine lockere Über-
bauung auf. Auf der höchsten Stelle des Berges befand sich
ein freier Platz, der als Versammlungsstätte gedeutet wird. Im
zweiten Viertel bzw. um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr.
wurde die Siedlung weitgehend aufgegeben. Wenig später
entstand auf der höchsten Stelle des Plateaus ein primitiver
Vierpfostentempel, in dessen Bereich in der zweiten Hälfte
des 1. Jahrhunderts v. Chr. Münzopferungen erfolgten. Der
Tempel wurde in tiberischer Zeit sowie um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. jeweils in Holzbauweise erneuert. Im
dritten Viertel des 1. Jahrhunderts endete die Münzdeponie-
rung im Tempelbereich und in seinem Umfeld entstand eine
Siedlung mit Brunnen, Töpferofen und Häusern in Pfosten-
und Schwellbalkenbauweise. Diese Strukturen bilden die ers-
te Phase einer vicusartigen Anlage, die Anfang des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. in Steinbauweise erneuert wurde. Die Funde
und Befunde sprechen dafür, daß sie in engem funktionalem
Kontext zum Heiligtum stand und u. a. Läden, Werkstätten
und Herbergen/Tavernen umfaßte.
Betrachtet man die Ausgrabungsergebnisse vor dem Hin-
tergrund der regionalen (S. 146 ff.) und makroregionalen
(S. 303 ff.) Besiedlungsentwicklung, zeigt sich, daß die Ge-
schichte der Wallendorfer Siedlung der allgemeinen Kultur-
entwicklung entspricht: Die Gründung der frühlatenezeitli-
chen Großbefestigung im späten 5. Jahrhundert v. Chr. fällt
in eine Phase, die sich durch hohe Bevölkerungs- und Sied-
lungsdichte sowie durch ein hohes Maß an gesellschaftlicher
Komplexität auszeichnet. Auf dem Martberg, dem Titelberg,
in Kastel-Staadt und in Otzenhausen entstehen im Laufe von
Lt A ebenfalls große, befestigte Höhensiedlungen. Der mit-
tel latenezeitliche Hiatus geht mit einem überregionalen Be-
siedlungsrückgang einher, der nicht nur archäologisch, son-
dern auch palynologisch nachweisbar ist.
Die Arbeit behandelt die Ergebnisse der zwischen 1993 und
1999 durchgeführten archäologischen Ausgrabungen auf
dem Castellberg bei Wallendorf (Reg.-Bez. Trier) und ihre
vergleichende Analyse auf regionaler und makroregionaler
Ebene. Als geographischer Rahmen wird der linksrheinische
Mittelgebirgsraum mit Schwerpunkt in der südwestlichen Ei-
fel, als chronologischer Rahmen der Zeitraum zwischen ca.
500 v. und 100 n. Chr. festgelegt.
Das Wallendorfer Ausgrabungsprojekt wurde im Rahmen
des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten
Schwerpunktprogramms „Romanisierung“ realisiert. Von
der nordwesteuropäischen Archäologie sind in den letzten
Jahrzehnten verstärkt ethnologisch-kulturanthropologische
Theorien und Modelle zur Beschreibung und Analyse des
Romanisierungsprozesses herangezogen worden. Die Tatsa-
che, daß die mitteleuropäische Forschung diesem Trend nicht
oder nur zögernd folgte, ist in den letzten Jahren insbeson-
dere in Großbritannien und in den Niederlanden z. T. heftig
kritisiert worden, wobei der deutschsprachigen Archäologie
im allgemeinen und dem Schwerpunktprogramm „Romani-
sierung“ im besonderen vorgeworfen wird, einem veralteten
„kulturhistorischen“ Paradigma anzuhängen. Aufbauend auf
dieser Kritik, formuliert die vorliegende Abhandlung einen
eigenen erkenntnis- und kulturtheoretischen Standort. Dabei
wird einerseits für ein komplementäres Diskursverfahren,
andererseits für einen revidierten kulturhistorischen Ansatz
plädiert (S. 5 ff.).
Der siedlungsarchäologischen und sozialhistorischen Ana-
lyse geht eine ausführliche Diskussion der archäologischen
Chronologie voraus (S. 64 ff.). Die Ergebnisse zur Späthall-
statt-/Frühlatenezeit bzw. zur Hunsrück-Eifel-Kultur sind in
Abbildung 35 zusammengefaßt. Für die Spätlatenezeit des
Mittelrhein-Mosel-Saar-Gebietes wird - dem Trend der letz-
ten Jahrzehnte entgegengesetzt - eine kurze Chronologie ver-
treten, wobei von einem Beginn der Stufe Lt Dl um 130/120
v. Chr. auszugehen ist. Sie setzt mit dem Auftreten der Nau-
heimer Fibel ein. Die Unterteilung von Lt Dl in einen Prä-
Nauheimer- und einen Nauheimer-Horizont konnte nicht be-
stätigt werden. Lt D2 wird als Schüsselübelhorizont definiert,
beginnt um 60/50 v. Chr. und endet in Eifel und Hunsrück
gegen 20/10 v. Chr.
Aufbauend auf dieser chronologischen Basis, kann die
eisen- und römerzeitliche Besiedlungsgeschichte auf dem
Castellberg relativ genau rekonstruiert werden (S. 146 ff.):
Im späten 5. Jahrhundert v. Chr. entstand auf dem Plateau
eine ca. 40 ha große befestigte Siedlung. Nach einem Hia-
tus wurde die Anlage in Lt Dl durch einen murus Galliens
erneuert. Münzprägung und Metallverarbeitung belegen ein
spätlatenezeitliches oppidum, das jedoch keinen „urbanen“
Charakter hatte. Seine Innenfläche wies eine lockere Über-
bauung auf. Auf der höchsten Stelle des Berges befand sich
ein freier Platz, der als Versammlungsstätte gedeutet wird. Im
zweiten Viertel bzw. um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr.
wurde die Siedlung weitgehend aufgegeben. Wenig später
entstand auf der höchsten Stelle des Plateaus ein primitiver
Vierpfostentempel, in dessen Bereich in der zweiten Hälfte
des 1. Jahrhunderts v. Chr. Münzopferungen erfolgten. Der
Tempel wurde in tiberischer Zeit sowie um die Mitte des 1.
Jahrhunderts n. Chr. jeweils in Holzbauweise erneuert. Im
dritten Viertel des 1. Jahrhunderts endete die Münzdeponie-
rung im Tempelbereich und in seinem Umfeld entstand eine
Siedlung mit Brunnen, Töpferofen und Häusern in Pfosten-
und Schwellbalkenbauweise. Diese Strukturen bilden die ers-
te Phase einer vicusartigen Anlage, die Anfang des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. in Steinbauweise erneuert wurde. Die Funde
und Befunde sprechen dafür, daß sie in engem funktionalem
Kontext zum Heiligtum stand und u. a. Läden, Werkstätten
und Herbergen/Tavernen umfaßte.
Betrachtet man die Ausgrabungsergebnisse vor dem Hin-
tergrund der regionalen (S. 146 ff.) und makroregionalen
(S. 303 ff.) Besiedlungsentwicklung, zeigt sich, daß die Ge-
schichte der Wallendorfer Siedlung der allgemeinen Kultur-
entwicklung entspricht: Die Gründung der frühlatenezeitli-
chen Großbefestigung im späten 5. Jahrhundert v. Chr. fällt
in eine Phase, die sich durch hohe Bevölkerungs- und Sied-
lungsdichte sowie durch ein hohes Maß an gesellschaftlicher
Komplexität auszeichnet. Auf dem Martberg, dem Titelberg,
in Kastel-Staadt und in Otzenhausen entstehen im Laufe von
Lt A ebenfalls große, befestigte Höhensiedlungen. Der mit-
tel latenezeitliche Hiatus geht mit einem überregionalen Be-
siedlungsrückgang einher, der nicht nur archäologisch, son-
dern auch palynologisch nachweisbar ist.