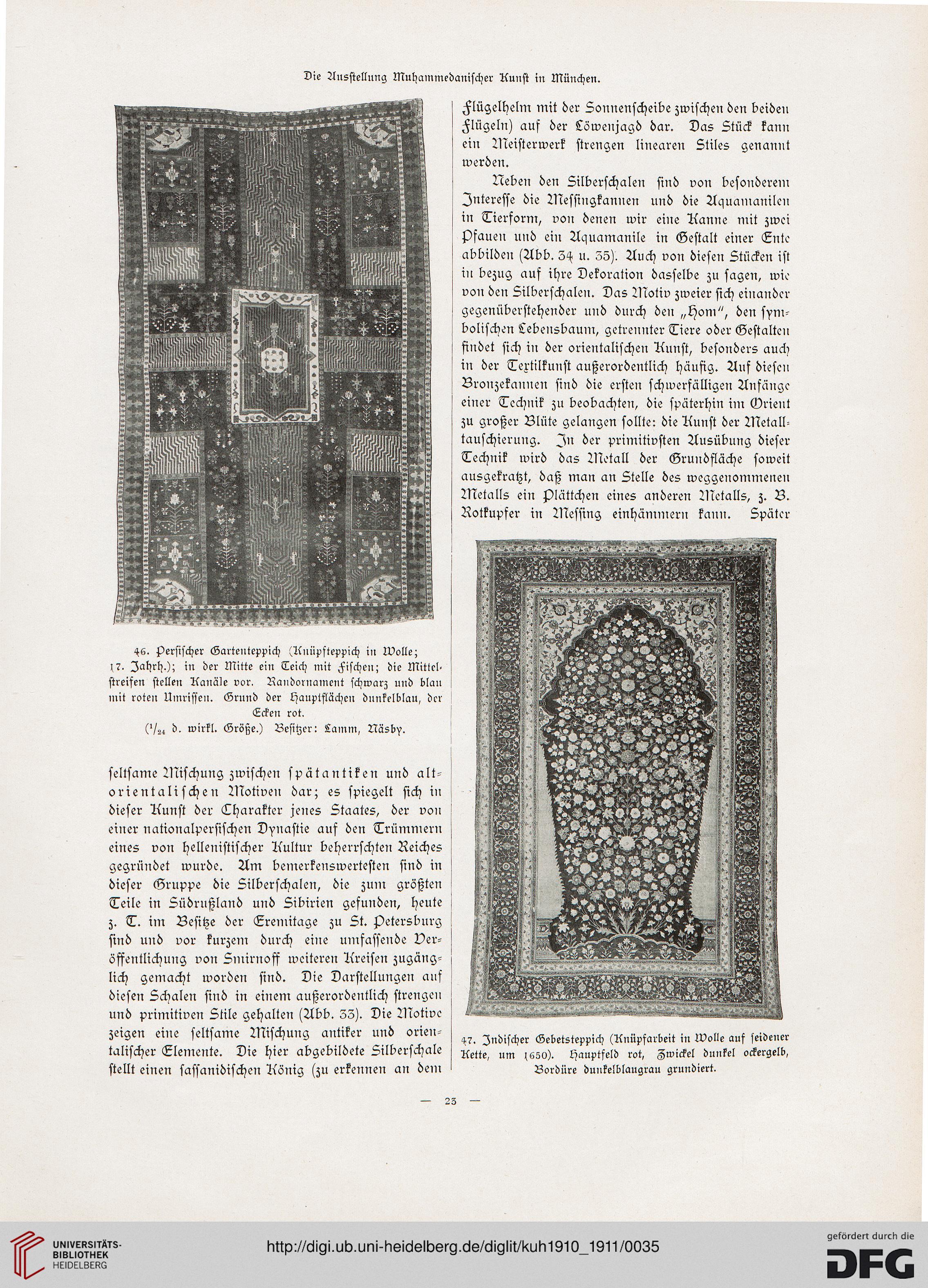Die Ausstellung Muhammedanischer Kunst in München.
46. persischer Gartentcppich (Knüpfteppich in Wolle;
;7. Jahrh.); in der Mitte ein Teich mit Fischen; die Mittel-
streifen stellen Kanäle vor. Randornament schwarz und blau
mit roten Umrissen. Grund der ksauptflächen dunkelblau, der
Ecken rot.
O/su d. wirkt. Größe.) Besitzer: Lamm, Näsby.
seltsame Mischung zwischen spätantiken und alt
orientalischen Motiven dar; es spiegelt sich in
dieser Kunst der Charakter jenes Staates, der von
einer nationalpersischen Dynastie auf den Trümniern
eines von hellenistischer Kultur beherrschten Reiches
gegründet wurde. Am bemerkenswertesten sind in
dieser Gruppe die Silberschalen, die zum größten
Teile in Südrußland und Sibirien gefunden, heute
z. T. in: Besitze der Eremitage zu St. Petersburg
sind und vor kurzen: durch eilte umfassende Bcr-
öffentlichung von Smirnoff weiteren Kreisen zugäng-
lich gemacht worden sind. Die Darstellungen auf
diesen Schalen sind in einen: außerordentlich strengen
und primitiven Stile gehalten (Abb. 33). Die Motive
zeigen eine seltsame Mischung antiker und orien-
talischer Elemente. Die hier abgebildete Silberschale
stellt einen sassanidischcn König (zu erkennen an den:
Flügelhelm mit der Sonnenscheibe zwischen den beiden
Flügeln) auf der Löwenjagd dar. Das Stück kann
eii: Meisterwerk strengen linearen Stiles genannt
werden.
Neben den Silberschalen sind von besonderen:
Interesse die Messingkannen ui:d die Aquamanilen
in Tierform, voi: denen wir eine Kanne mit zwei
Pfauen und eii: Aquamanile in Gestalt einer Ente
abbilden (Abb. 3q- u. 35). Auch von diesen Stücken ist
in bezug auf ihre Dekoration dasselbe zu sagen, wie
von den Silberschalen. Das Motiv zweier sich einander
gegenüberstehender und durch den „Hom", den sym-
bolischen Lebensbaum, getrennter Tiere oder Gestalten
findet sich in der orientalischen Kunst, besonders auch
in der Textilkunst außerordentlich häufig. Auf diesen
Bronzekannen sind die ersten schwerfälligen Anfänge
einer Technik zu beobachten, die späterhin in: Orient
zu großer Blüte gelangen sollte: die Kunst der Metall-
tauschierung. In der primitivsten Ausübung dieser
Technik wird das Metall der Grundfläche soweit
ausgekratzt, daß man an Stelle des weggenommeneu
Metalls ein Plättchen eines anderen Metalls, z. B.
Rotkupfer iu Messing einhämmern kann. Später
47. Indischer Gebetsteppich (Knüpfarbeit in Wolle auf seidener
Kette, um ;65v). Hauptfeld rot, Zwickel dunkel ockergelb,
Bordüre dunkelblaugrau grundiert.
22
46. persischer Gartentcppich (Knüpfteppich in Wolle;
;7. Jahrh.); in der Mitte ein Teich mit Fischen; die Mittel-
streifen stellen Kanäle vor. Randornament schwarz und blau
mit roten Umrissen. Grund der ksauptflächen dunkelblau, der
Ecken rot.
O/su d. wirkt. Größe.) Besitzer: Lamm, Näsby.
seltsame Mischung zwischen spätantiken und alt
orientalischen Motiven dar; es spiegelt sich in
dieser Kunst der Charakter jenes Staates, der von
einer nationalpersischen Dynastie auf den Trümniern
eines von hellenistischer Kultur beherrschten Reiches
gegründet wurde. Am bemerkenswertesten sind in
dieser Gruppe die Silberschalen, die zum größten
Teile in Südrußland und Sibirien gefunden, heute
z. T. in: Besitze der Eremitage zu St. Petersburg
sind und vor kurzen: durch eilte umfassende Bcr-
öffentlichung von Smirnoff weiteren Kreisen zugäng-
lich gemacht worden sind. Die Darstellungen auf
diesen Schalen sind in einen: außerordentlich strengen
und primitiven Stile gehalten (Abb. 33). Die Motive
zeigen eine seltsame Mischung antiker und orien-
talischer Elemente. Die hier abgebildete Silberschale
stellt einen sassanidischcn König (zu erkennen an den:
Flügelhelm mit der Sonnenscheibe zwischen den beiden
Flügeln) auf der Löwenjagd dar. Das Stück kann
eii: Meisterwerk strengen linearen Stiles genannt
werden.
Neben den Silberschalen sind von besonderen:
Interesse die Messingkannen ui:d die Aquamanilen
in Tierform, voi: denen wir eine Kanne mit zwei
Pfauen und eii: Aquamanile in Gestalt einer Ente
abbilden (Abb. 3q- u. 35). Auch von diesen Stücken ist
in bezug auf ihre Dekoration dasselbe zu sagen, wie
von den Silberschalen. Das Motiv zweier sich einander
gegenüberstehender und durch den „Hom", den sym-
bolischen Lebensbaum, getrennter Tiere oder Gestalten
findet sich in der orientalischen Kunst, besonders auch
in der Textilkunst außerordentlich häufig. Auf diesen
Bronzekannen sind die ersten schwerfälligen Anfänge
einer Technik zu beobachten, die späterhin in: Orient
zu großer Blüte gelangen sollte: die Kunst der Metall-
tauschierung. In der primitivsten Ausübung dieser
Technik wird das Metall der Grundfläche soweit
ausgekratzt, daß man an Stelle des weggenommeneu
Metalls ein Plättchen eines anderen Metalls, z. B.
Rotkupfer iu Messing einhämmern kann. Später
47. Indischer Gebetsteppich (Knüpfarbeit in Wolle auf seidener
Kette, um ;65v). Hauptfeld rot, Zwickel dunkel ockergelb,
Bordüre dunkelblaugrau grundiert.
22