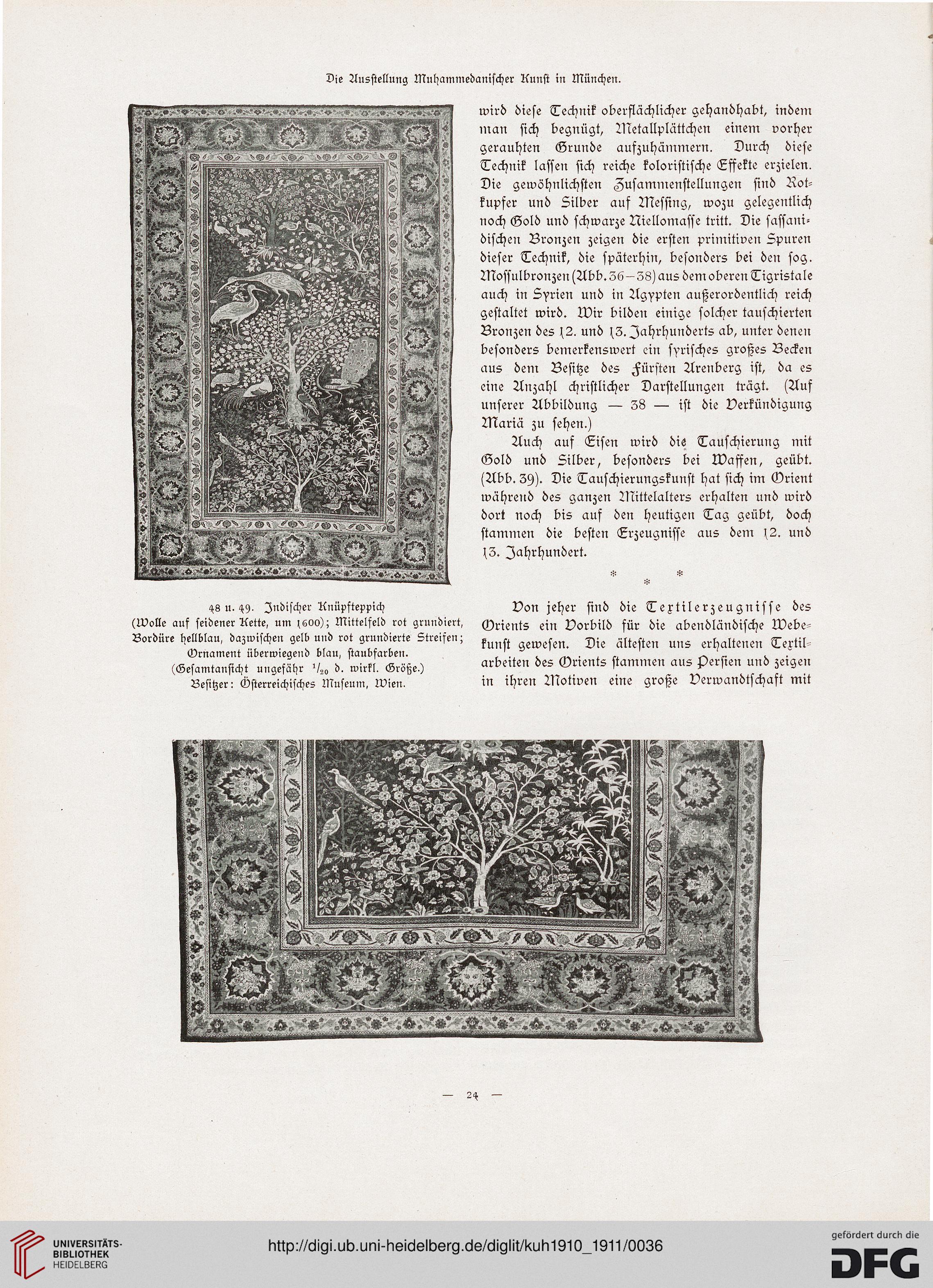Die Ausstellung Muhammedanischer Kunst in München.
<*8 u. 49. Indischer Knüpftexpich
(Wolle auf seidener Kette, um ^soo); Mittelfeld rot grundiert,
Bordüre hellblau, dazwischen gelb und rot grundierte Streifen;
Vrnament überwiegend blau, staubfarben.
(Gesamtansicht ungefähr '/zg d. wirkl. Größe.)
Besitzer: (Österreichisches Museum, Wien.
wird diese Technik oberflächlicher gehandhabt, indem
inan sich begnügt, Metallplättchen einem vorher
gerauhten Grunde aufzuhämmern. Durch diese
Technik lassen sich reiche koloristische Effekte erzielen.
Die gewöhnlichsten Zusammenstellungen sind Rot-
kupfer und Silber auf Messing, wozu gelegentlich
noch Gold und schwarze Niellomasse tritt. Die sassani-
dischen Bronzen zeigen die ersten primitiven Spuren
dieser Technik, die späterhin, besonders bei den fog.
Moffulbronzen (Abb. 36-38) aus dem oberen Tigristale
auch in Syrien und in Ägypten außerordentlich reich
gestaltet wird. Wir bilden einige solcher tauschierten
Bronzen des \2. und (3. Jahrhunderts ab, unter denen
besonders bemerkenswert ein syrisches großes Becken
aus dem Besitze des Fürsten Arenberg ist, da es
eine Anzahl christlicher Darstellungen trägt. (Auf
unserer Abbildung — 38 — ist die Verkündigung
Mariä zu sehen.)
Auch auf Eisen wird dis Tauschierung mit
Gold und Silber, besonders bei Waffen, geübt.
(Abb. 39). Die Tauschierungskunst hat sich im Orient
während des ganzen Mittelalters erhalten und wird
dort noch bis auf den heutigen Tag geübt, doch
stammen die besten Erzeugnisse aus dein \2. und
(3. Jahrhundert.
*
Von jeher sind die Textilerzeugnisse des
Orients ein Vorbild für die abendländische Webe-
kunst gewesen. Die ältesten uns erhaltenen Textil
arbeiten des Orients stammen aus Persien und zeigen
in ihren Motiven eine große Verwandtschaft mit
2*
<*8 u. 49. Indischer Knüpftexpich
(Wolle auf seidener Kette, um ^soo); Mittelfeld rot grundiert,
Bordüre hellblau, dazwischen gelb und rot grundierte Streifen;
Vrnament überwiegend blau, staubfarben.
(Gesamtansicht ungefähr '/zg d. wirkl. Größe.)
Besitzer: (Österreichisches Museum, Wien.
wird diese Technik oberflächlicher gehandhabt, indem
inan sich begnügt, Metallplättchen einem vorher
gerauhten Grunde aufzuhämmern. Durch diese
Technik lassen sich reiche koloristische Effekte erzielen.
Die gewöhnlichsten Zusammenstellungen sind Rot-
kupfer und Silber auf Messing, wozu gelegentlich
noch Gold und schwarze Niellomasse tritt. Die sassani-
dischen Bronzen zeigen die ersten primitiven Spuren
dieser Technik, die späterhin, besonders bei den fog.
Moffulbronzen (Abb. 36-38) aus dem oberen Tigristale
auch in Syrien und in Ägypten außerordentlich reich
gestaltet wird. Wir bilden einige solcher tauschierten
Bronzen des \2. und (3. Jahrhunderts ab, unter denen
besonders bemerkenswert ein syrisches großes Becken
aus dem Besitze des Fürsten Arenberg ist, da es
eine Anzahl christlicher Darstellungen trägt. (Auf
unserer Abbildung — 38 — ist die Verkündigung
Mariä zu sehen.)
Auch auf Eisen wird dis Tauschierung mit
Gold und Silber, besonders bei Waffen, geübt.
(Abb. 39). Die Tauschierungskunst hat sich im Orient
während des ganzen Mittelalters erhalten und wird
dort noch bis auf den heutigen Tag geübt, doch
stammen die besten Erzeugnisse aus dein \2. und
(3. Jahrhundert.
*
Von jeher sind die Textilerzeugnisse des
Orients ein Vorbild für die abendländische Webe-
kunst gewesen. Die ältesten uns erhaltenen Textil
arbeiten des Orients stammen aus Persien und zeigen
in ihren Motiven eine große Verwandtschaft mit
2*