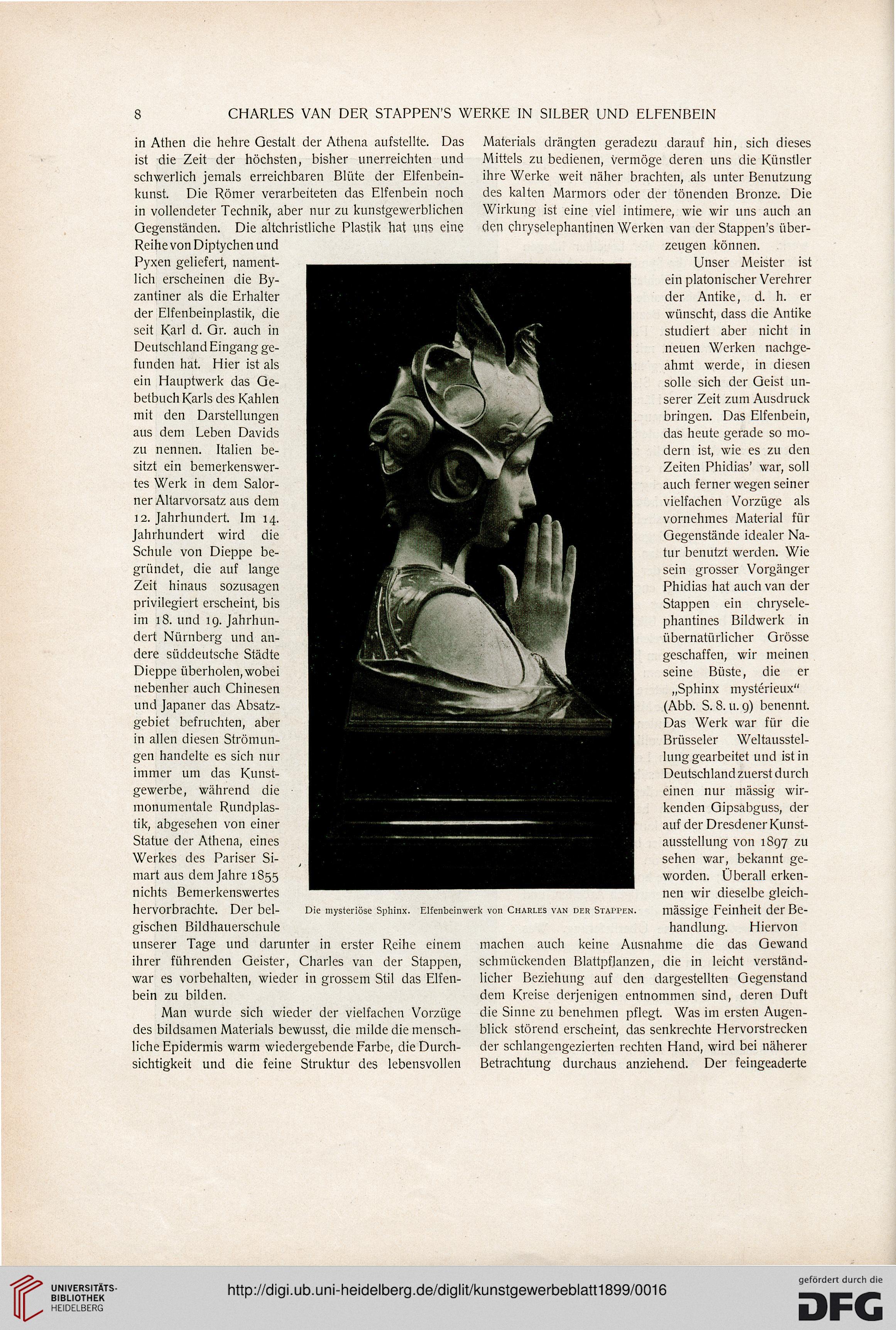CHARLES VAN DER STAPPEN'S WERKE IN SILBER UND ELFENBEIN
in Athen die hehre Gestalt der Athena aufstellte. Das
ist die Zeit der höchsten, bisher unerreichten und
schwerlich jemals erreichbaren Blüte der Elfenbein-
kunst. Die Römer verarbeiteten das Elfenbein noch
in vollendeter Technik, aber nur zu kunstgewerblichen
Gegenständen. Die altchristliche Plastik hat uns eine
Reihe von Diptychen und
Pyxen geliefert, nament-
lich erscheinen die By-
zantiner als die Erhalter
der Elfenbeinplastik, die
seit Karl d. Gr. auch in
Deutschland Eingang ge-
funden hat. Hier ist als
ein Hauptwerk das Ge-
betbuch Karls des Kahlen
mit den Darstellungen
aus dem Leben Davids
zu nennen. Italien be-
sitzt ein bemerkenswer-
tes Werk in dem Salor-
ner Altarvorsatz aus dem
12. Jahrhundert. Im 14.
Jahrhundert wird die
Schule von Dieppe be-
gründet, die auf lange
Zeit hinaus sozusagen
privilegiert erscheint, bis
im 18. und 19. Jahrhun-
dert Nürnberg und an-
dere süddeutsche Städte
Dieppe überholen, wobei
nebenher auch Chinesen
und Japaner das Absatz-
gebiet befruchten, aber
in allen diesen Strömun-
gen handelte es sich nur
immer um das Kunst-
gewerbe, während die
monumentale Rundplas-
tik, abgesehen von einer
Statue der Athena, eines
Werkes des Pariser Si-
mart aus dem Jahre 1855
nichts Bemerkenswertes
hervorbrachte. Der bel-
gischen Bildhauerschule
unserer Tage und darunter in erster Reihe einem
ihrer führenden Geister, Charles van der Stappen,
war es vorbehalten, wieder in grossem Stil das Elfen-
bein zu bilden.
Man wurde sich wieder der vielfachen Vorzüge
des bildsamen Materials bewusst, die milde die mensch-
liche Epidermis warm wiedergebende Farbe, die Durch-
sichtigkeit und die feine Struktur des lebensvollen
Die mysteriöse Sphinx. Elfenbeinwerk von Charles van der Staiten
Materials drängten geradezu darauf hin, sich dieses
Mittels zu bedienen, vermöge deren uns die Künstler
ihre Werke weit näher brachten, als unter Benutzung
des kalten Marmors oder der tönenden Bronze. Die
Wirkung ist eine viel intimere, wie wir uns auch an
den chryselephantinen Werken van der Stappen's über-
zeugen können.
Unser Meister ist
ein platonischer Verehrer
der Antike, d. h. er
wünscht, dass die Antike
studiert aber nicht in
neuen Werken nachge-
ahmt werde, in diesen
solle sich der Geist un-
serer Zeit zum Ausdruck
bringen. Das Elfenbein,
das heute gerade so mo-
dern ist, wie es zu den
Zeiten Phidias' war, soll
auch ferner wegen seiner
vielfachen Vorzüge als
vornehmes Material für
Gegenstände idealer Na-
tur benutzt werden. Wie
sein grosser Vorgänger
Phidias hat auch van der
Stappen ein chrysele-
phantines Bildwerk in
übernatürlicher Grösse
geschaffen, wir meinen
seine Büste, die er
„Sphinx mysterieux"
(Abb. S. 8. u. 9) benennt.
Das Werk war für die
Brüsseler Weltausstel-
lunggearbeitet und ist in
Deutschland zuerst durch
einen nur massig wir-
kenden Gipsabguss, der
auf der Dresdener Kunst-
ausstellung von 1897 zu
sehen war, bekannt ge-
worden. Überall erken-
nen wir dieselbe gleich-
massige Feinheit der Be-
handlung. Hiervon
machen auch keine Ausnahme die das Gewand
schmückenden Blattpflanzen, die in leicht verständ-
licher Beziehung auf den dargestellten Gegenstand
dem Kreise derjenigen entnommen sind, deren Duft
die Sinne zu benehmen pflegt. Was im ersten Augen-
blick störend erscheint, das senkrechte Hervorstrecken
der schlangengezierten rechten Hand, wird bei näherer
Betrachtung durchaus anziehend. Der feingeaderte
in Athen die hehre Gestalt der Athena aufstellte. Das
ist die Zeit der höchsten, bisher unerreichten und
schwerlich jemals erreichbaren Blüte der Elfenbein-
kunst. Die Römer verarbeiteten das Elfenbein noch
in vollendeter Technik, aber nur zu kunstgewerblichen
Gegenständen. Die altchristliche Plastik hat uns eine
Reihe von Diptychen und
Pyxen geliefert, nament-
lich erscheinen die By-
zantiner als die Erhalter
der Elfenbeinplastik, die
seit Karl d. Gr. auch in
Deutschland Eingang ge-
funden hat. Hier ist als
ein Hauptwerk das Ge-
betbuch Karls des Kahlen
mit den Darstellungen
aus dem Leben Davids
zu nennen. Italien be-
sitzt ein bemerkenswer-
tes Werk in dem Salor-
ner Altarvorsatz aus dem
12. Jahrhundert. Im 14.
Jahrhundert wird die
Schule von Dieppe be-
gründet, die auf lange
Zeit hinaus sozusagen
privilegiert erscheint, bis
im 18. und 19. Jahrhun-
dert Nürnberg und an-
dere süddeutsche Städte
Dieppe überholen, wobei
nebenher auch Chinesen
und Japaner das Absatz-
gebiet befruchten, aber
in allen diesen Strömun-
gen handelte es sich nur
immer um das Kunst-
gewerbe, während die
monumentale Rundplas-
tik, abgesehen von einer
Statue der Athena, eines
Werkes des Pariser Si-
mart aus dem Jahre 1855
nichts Bemerkenswertes
hervorbrachte. Der bel-
gischen Bildhauerschule
unserer Tage und darunter in erster Reihe einem
ihrer führenden Geister, Charles van der Stappen,
war es vorbehalten, wieder in grossem Stil das Elfen-
bein zu bilden.
Man wurde sich wieder der vielfachen Vorzüge
des bildsamen Materials bewusst, die milde die mensch-
liche Epidermis warm wiedergebende Farbe, die Durch-
sichtigkeit und die feine Struktur des lebensvollen
Die mysteriöse Sphinx. Elfenbeinwerk von Charles van der Staiten
Materials drängten geradezu darauf hin, sich dieses
Mittels zu bedienen, vermöge deren uns die Künstler
ihre Werke weit näher brachten, als unter Benutzung
des kalten Marmors oder der tönenden Bronze. Die
Wirkung ist eine viel intimere, wie wir uns auch an
den chryselephantinen Werken van der Stappen's über-
zeugen können.
Unser Meister ist
ein platonischer Verehrer
der Antike, d. h. er
wünscht, dass die Antike
studiert aber nicht in
neuen Werken nachge-
ahmt werde, in diesen
solle sich der Geist un-
serer Zeit zum Ausdruck
bringen. Das Elfenbein,
das heute gerade so mo-
dern ist, wie es zu den
Zeiten Phidias' war, soll
auch ferner wegen seiner
vielfachen Vorzüge als
vornehmes Material für
Gegenstände idealer Na-
tur benutzt werden. Wie
sein grosser Vorgänger
Phidias hat auch van der
Stappen ein chrysele-
phantines Bildwerk in
übernatürlicher Grösse
geschaffen, wir meinen
seine Büste, die er
„Sphinx mysterieux"
(Abb. S. 8. u. 9) benennt.
Das Werk war für die
Brüsseler Weltausstel-
lunggearbeitet und ist in
Deutschland zuerst durch
einen nur massig wir-
kenden Gipsabguss, der
auf der Dresdener Kunst-
ausstellung von 1897 zu
sehen war, bekannt ge-
worden. Überall erken-
nen wir dieselbe gleich-
massige Feinheit der Be-
handlung. Hiervon
machen auch keine Ausnahme die das Gewand
schmückenden Blattpflanzen, die in leicht verständ-
licher Beziehung auf den dargestellten Gegenstand
dem Kreise derjenigen entnommen sind, deren Duft
die Sinne zu benehmen pflegt. Was im ersten Augen-
blick störend erscheint, das senkrechte Hervorstrecken
der schlangengezierten rechten Hand, wird bei näherer
Betrachtung durchaus anziehend. Der feingeaderte