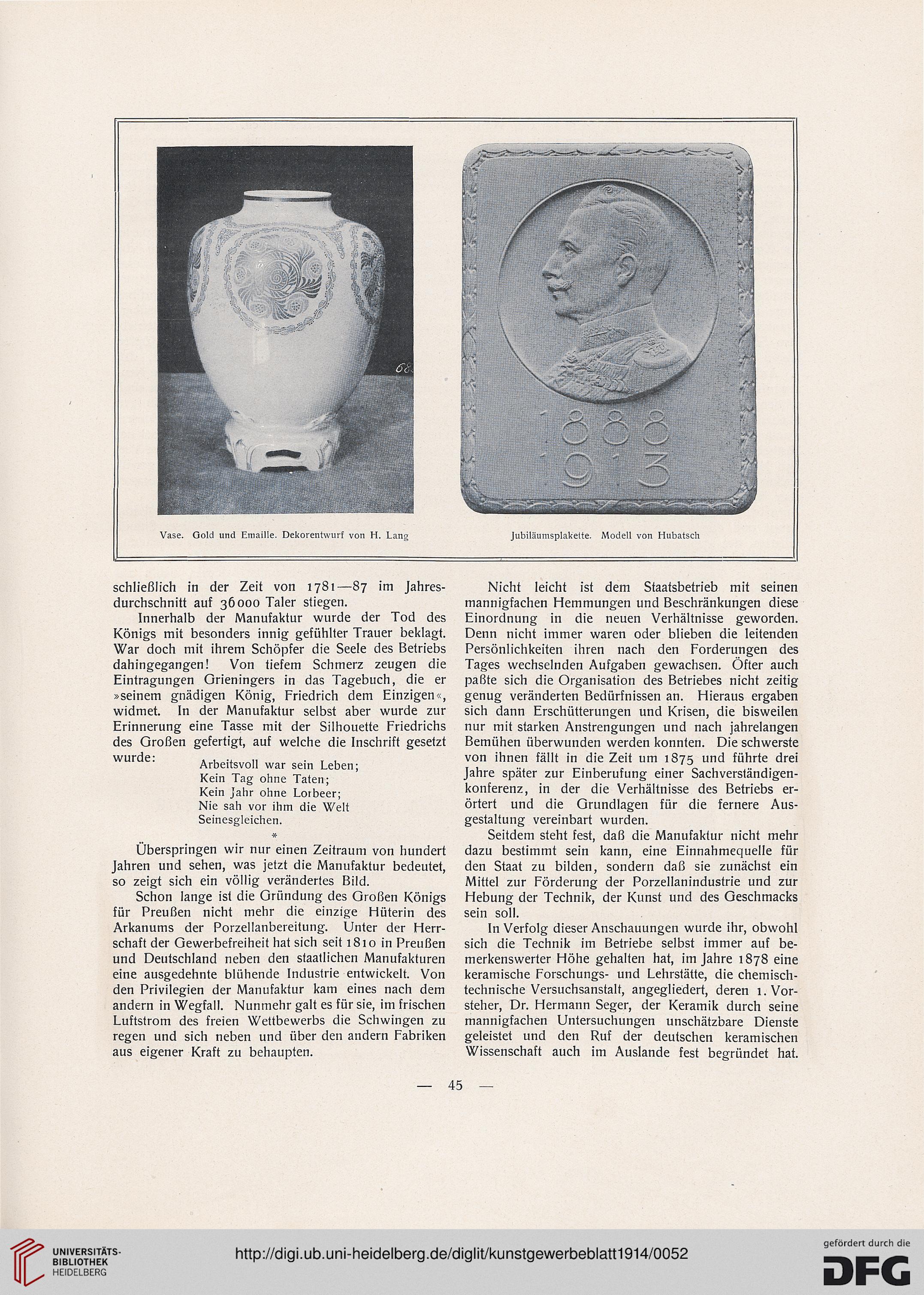schließlich in der Zeit von 1781—87 im Jahres-
durchschnitt auf 36000 Taler stiegen.
Innerhalb der Manufaktur wurde der Tod des
Königs mit besonders innig gefühlter Trauer beklagt.
War doch mit ihrem Schöpfer die Seele des Betriebs
dahingegangen! Von tiefem Schmerz zeugen die
Eintragungen Grieningers in das Tagebuch, die er
»seinem gnädigen König, Friedrich dem Einzigen«,
widmet. In der Manufaktur selbst aber wurde zur
Erinnerung eine Tasse mit der Silhouette Friedrichs
des Großen gefertigt, auf welche die Inschrift gesetzt
wurde. Arbeitsvoll war sein Leben;
Kein Tag ohne Taten;
Kein Jahr ohne Lorbeer;
Nie sah vor ihm die Welt
Seinesgleichen.
*
Überspringen wir nur einen Zeitraum von hundert
Jahren und sehen, was jetzt die Manufaktur bedeutet,
so zeigt sich ein völlig verändertes Bild.
Schon lange ist die Gründung des Großen Königs
für Preußen nicht mehr die einzige Hüterin des
Arkanums der Porzellanbereitung. Unter der Herr-
schaft der Gewerbefreiheit hat sich seit 1810 in Preußen
und Deutschland neben den staatlichen Manufakturen
eine ausgedehnte blühende Industrie entwickelt. Von
den Privilegien der Manufaktur kam eines nach dem
andern in Wegfall. Nunmehr galt es für sie, im frischen
Luftstrom des freien Wettbewerbs die Schwingen zu
regen und sich neben und über den andern Fabriken
aus eigener Kraft zu behaupten.
Nicht leicht ist dem Staatsbetrieb mit seinen
mannigfachen Hemmungen und Beschränkungen diese
Einordnung in die neuen Verhältnisse geworden.
Denn nicht immer waren oder blieben die leitenden
Persönlichkeiten ihren nach den Forderungen des
Tages wechselnden Aufgaben gewachsen. Öfter auch
paßte sich die Organisation des Betriebes nicht zeitig
genug veränderten Bedürfnissen an. Hieraus ergaben
sich dann Erschütterungen und Krisen, die bisweilen
nur mit starken Anstrengungen und nach jahrelangen
Bemühen überwunden werden konnten. Die schwerste
von ihnen fällt in die Zeit um 1875 und führte drei
Jahre später zur Einberufung einer Sachverständigen-
konferenz, in der die Verhältnisse des Betriebs er-
örtert und die Grundlagen für die fernere Aus-
gestaltung vereinbart wurden.
Seitdem steht fest, daß die Manufaktur nicht mehr
dazu bestimmt sein kann, eine Einnahmequelle für
den Staat zu bilden, sondern daß sie zunächst ein
Mittel zur Förderung der Porzellanindustrie und zur
Hebung der Technik, der Kunst und des Geschmacks
sein soll.
In Verfolg dieser Anschauungen wurde ihr, obwohl
sich die Technik im Betriebe selbst immer auf be-
merkenswerter Höhe gehalten hat, im Jahre 1878 eine
keramische Forschungs- und Lehrstätte, die chemisch-
technische Versuchsanstalt, angegliedert, deren 1. Vor-
steher, Dr. Hermann Seger, der Keramik durch seine
mannigfachen Untersuchungen unschätzbare Dienste
geleistet und den Ruf der deutschen keramischen
Wissenschaft auch im Auslande fest begründet hat.
45