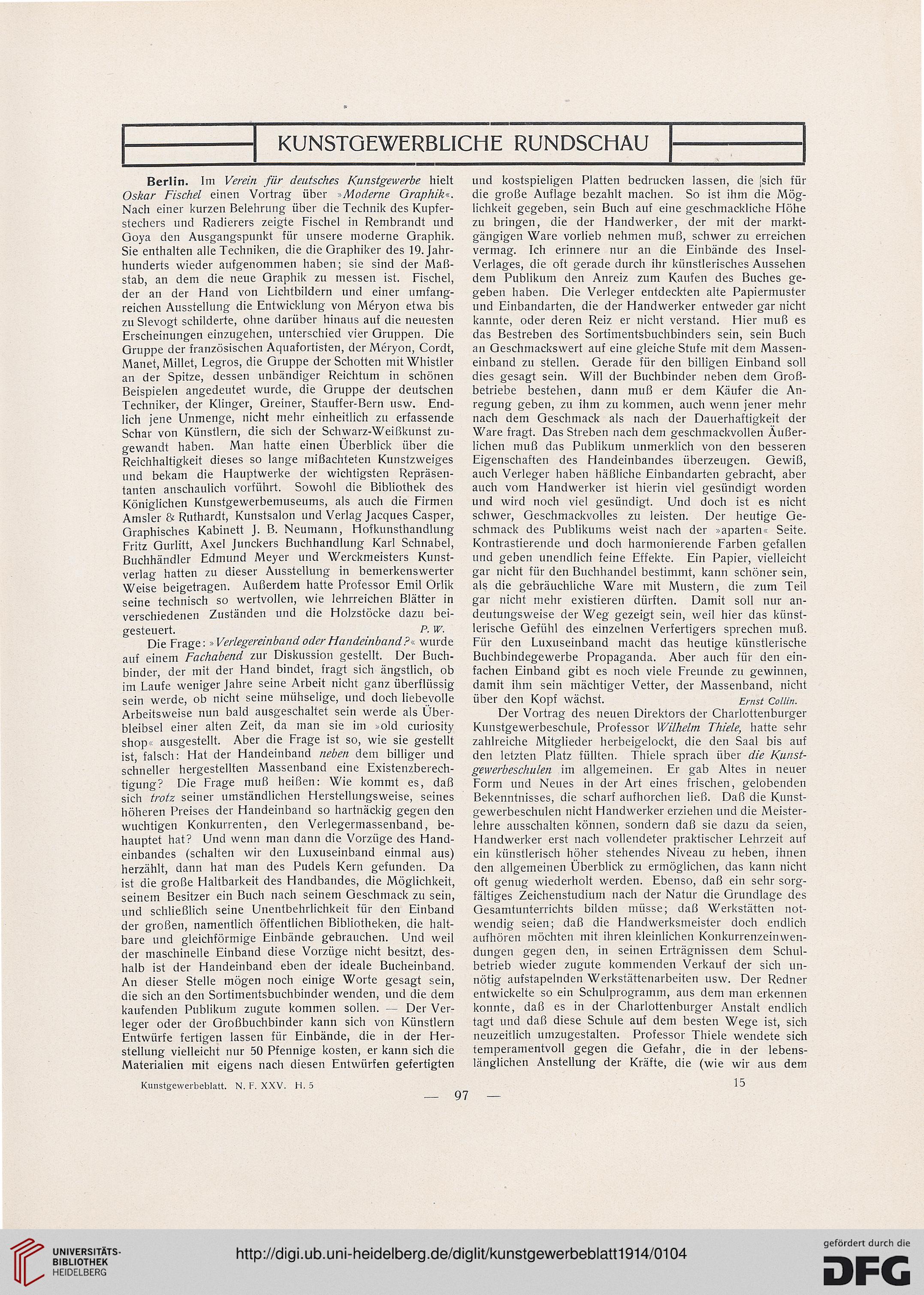KUNSTGEWERBLICHE RUNDSCHAU
Berlin. Im Verein fiir deutsches Kunstgewerbe hielt
Oskar Fischet einen Vortrag über »Moderne Graphik«.
Nach einer kurzen Belehrung über die Technik des Kupfer-
stechers und Radierers zeigte Fischei in Rembrandt und
Goya den Ausgangspunkt für unsere moderne Graphik.
Sie enthalten alle Techniken, die die Graphiker des 19. Jahr-
hunderts wieder aufgenommen haben; sie sind der Maß-
stab, an dem die neue Graphik zu messen ist. Fischei,
der an der Hand von Lichtbildern und einer umfang-
reichen Ausstellung die Entwicklung von Meryon etwa bis
zu Slevogt schilderte, ohne darüber hinaus auf die neuesten
Erscheinungen einzugehen, unterschied vier Gruppen. Die
Gruppe der französischen Aquafortisten, der Meryon, Cordt,
Manet, Millet, Legros, die Gruppe der Schotten mit Whistler
an der Spitze, dessen unbändiger Reichtum in schönen
Beispielen angedeutet wurde, die Gruppe der deutschen
Techniker, der Klinger, Greiner, Stauffer-Bern usw. End-
lich jene Unmenge, nicht mehr einheitlich zu erfassende
Schar von Künstlern, die sich der Schwarz-Weißkunst zu-
gewandt haben. Man hatte einen Überblick über die
Reichhaltigkeit dieses so lange mißachteten Kunstzweiges
und bekam die Hauptwerke der wichtigsten Repräsen-
tanten anschaulich vorführt. Sowohl die Bibliothek des
Königlichen Kunstgewerbemuseums, als auch die Firmen
Amsler & Ruthardt, Kunstsalon und Verlag Jacques Casper,
Graphisches Kabinett J. B. Neumann, Hofkunsthandlung
Fritz Gurlitt, Axel Junckers Buchhandlung Karl Schnabel,
Buchhändler Edmund Meyer und Werckmeisters Kunst-
verlag hatten zu dieser Ausstellung in bemerkenswerter
Weise beigetragen. Außerdem hatte Professor Emil Orlik
seine technisch so wertvollen, wie lehrreichen Blätter in
verschiedenen Zuständen und die Holzstöcke dazu bei-
gesteuert. P- W.
Die Frage: »Verlegereinband oder Hatideinb and?«- wurde
auf einem Fachabend zur Diskussion gestellt. Der Buch-
binder, der mit der Hand bindet, fragt sich ängstlich, ob
im Laufe weniger Jahre seine Arbeit nicht ganz überflüssig
sein werde, ob nicht seine mühselige, und doch liebevolle
Arbeitsweise nun bald ausgeschaltet sein werde als Über-
bleibsel einer alten Zeit, da man sie im »old curiosity
shop« ausgestellt. Aber die Frage ist so, wie sie gestellt
ist, falsch: Hat der Handeinband neben dem billiger und
schneller hergestellten Massenband eine Existenzberech-
tigung? Die Frage muß heißen: Wie kommt es, daß
sich trotz seiner umständlichen Herstellungsweise, seines
höheren Preises der Handeinband so hartnäckig gegen den
wuchtigen Konkurrenten, den Verlegermassenband, be-
hauptet hat? Und wenn man dann die Vorzüge des Hand-
einbandes (schalten wir den Luxuseinband einmal aus)
herzählt, dann hat man des Pudels Kern gefunden. Da
ist die große Haltbarkeit des Handbandes, die Möglichkeit,
seinem Besitzer ein Buch nach seinem Geschmack zn sein,
und schließlich seine Unentbehrlichkeit für den Einband
der großen, namentlich öffentlichen Bibliotheken, die halt-
bare und gleichförmige Einbände gebrauchen. Und weil
der maschinelle Einband diese Vorzüge nicht besitzt, des-
halb ist der Handeinband eben der ideale Bucheinband.
An dieser Stelle mögen noch einige Worte gesagt sein,
die sich an den Sortimentsbuchbinder wenden, und die dem
kaufenden Publikum zugute kommen sollen. — Der Ver-
leger oder der Großbuchbinder kann sich von Künstlern
Entwürfe fertigen lassen für Einbände, die in der Her-
stellung vielleicht nur 50 Pfennige kosten, er kann sich die
Materialien mit eigens nach diesen Entwürfen gefertigten
und kostspieligen Platten bedrucken lassen, die [sich für
die große Auflage bezahlt machen. So ist ihm die Mög-
lichkeit gegeben, sein Buch auf eine geschmackliche Höhe
zu bringen, die der Handwerker, der mit der markt-
gängigen Ware vorlieb nehmen muß, schwer zu erreichen
vermag. Ich erinnere nur an die Einbände des Insel-
Verlages, die oft gerade durch ihr künstlerisches Aussehen
dem Publikum den Anreiz zum Kaufen des Buches ge-
geben haben. Die Verleger entdeckten alte Papiermuster
und Einbandarten, die der Handwerker entweder gar nicht
kannte, oder deren Reiz er nicht verstand. Hier muß es
das Bestreben des Sortimentsbuchbinders sein, sein Buch
an Geschmackswert auf eine gleiche Stufe mit dem Massen-
einband zu stellen. Gerade für den billigen Einband soll
dies gesagt sein. Will der Buchbinder neben dem Groß-
betriebe bestehen, dann muß er dem Käufer die An-
regung geben, zu ihm zu kommen, auch wenn jener mehr
nach dem Geschmack als nach der Dauerhaftigkeit der
Ware fragt. Das Streben nach dem geschmackvollen Äußer-
lichen muß das Publikum unmerklich von den besseren
Eigenschaften des Handeinbandes überzeugen. Gewiß,
auch Verleger haben häßliche Einbandarten gebracht, aber
auch vom Handwerker ist hierin viel gesündigt worden
und wird noch viel gesündigt. Und doch ist es nicht
schwer, Geschmackvolles zu leisten. Der heutige Ge-
schmack des Publikums weist nach der »aparten« Seite.
Kontrastierende und doch harmonierende Farben gefallen
und geben unendlich feine Effekte. Ein Papier, vielleicht
gar nicht für den Buchhandel bestimmt, kann schöner sein,
als die gebräuchliche Ware mit Mustern, die zum Teil
gar nicht mehr existieren dürften. Damit soll nur an-
deutungsweise der Weg gezeigt sein, weil hier das künst-
lerische Gefühl des einzelnen Verfertigers sprechen muß.
Für den Luxuseinband macht das heutige künstlerische
Buchbindegewerbe Propaganda. Aber auch für den ein-
fachen Einband gibt es noch viele Freunde zu gewinnen,
damit ihm sein mächtiger Vetter, der Massenband, nicht
über den Kopf wächst. Ernst Collin.
Der Vortrag des neuen Direktors der Charlottenburger
Kunstgewerbeschule, Professor Wilhelm Thiele, hatte sehr
zahlreiche Mitglieder herbeigelockt, die den Saal bis auf
den letzten Platz füllten. Thiele sprach über die Kunst-
gewerbeschulen im allgemeinen. Er gab Altes in neuer
Form und Neues in der Art eines frischen, gelobenden
Bekenntnisses, die scharf aufhorchen ließ. Daß die Kunst-
gewerbeschulen nicht Handwerker erziehen und die Meister-
lehre ausschalten können, sondern daß sie dazu da seien,
Handwerker erst nach vollendeter praktischer Lehrzeit auf
ein künstlerisch höher stehendes Niveau zu heben, ihnen
den allgemeinen Überblick zu ermöglichen, das kann nicht
oft genug wiederholt werden. Ebenso, daß ein sehr sorg-
fältiges Zeichenstudium nach der Natur die Grundlage des
Gesamtunterrichts bilden müsse; daß Werkstätten not-
wendig seien; daß die Handwerksmeister doch endlich
aufhören möchten mit ihren kleinlichen Konkurrenzeinwen-
dungen gegen den, in seinen Erträgnissen dem Schul-
betrieb wieder zugute kommenden Verkauf der sich un-
nötig auf stapelnden Werkstättenarbeiten usw. Der Redner
entwickelte so ein Schulprogramm, aus dem man erkennen
konnte, daß es in der Charlottenburger Anstalt endlich
tagt und daß diese Schule auf dem besten Wege ist, sich
neuzeitlich umzugestalten. Professor Thiele wendete sich
temperamentvoll gegen die Gefahr, die in der lebens-
länglichen Anstellung der Kräfte, die (wie wir aus dem
15
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXV. H. 5
97
Berlin. Im Verein fiir deutsches Kunstgewerbe hielt
Oskar Fischet einen Vortrag über »Moderne Graphik«.
Nach einer kurzen Belehrung über die Technik des Kupfer-
stechers und Radierers zeigte Fischei in Rembrandt und
Goya den Ausgangspunkt für unsere moderne Graphik.
Sie enthalten alle Techniken, die die Graphiker des 19. Jahr-
hunderts wieder aufgenommen haben; sie sind der Maß-
stab, an dem die neue Graphik zu messen ist. Fischei,
der an der Hand von Lichtbildern und einer umfang-
reichen Ausstellung die Entwicklung von Meryon etwa bis
zu Slevogt schilderte, ohne darüber hinaus auf die neuesten
Erscheinungen einzugehen, unterschied vier Gruppen. Die
Gruppe der französischen Aquafortisten, der Meryon, Cordt,
Manet, Millet, Legros, die Gruppe der Schotten mit Whistler
an der Spitze, dessen unbändiger Reichtum in schönen
Beispielen angedeutet wurde, die Gruppe der deutschen
Techniker, der Klinger, Greiner, Stauffer-Bern usw. End-
lich jene Unmenge, nicht mehr einheitlich zu erfassende
Schar von Künstlern, die sich der Schwarz-Weißkunst zu-
gewandt haben. Man hatte einen Überblick über die
Reichhaltigkeit dieses so lange mißachteten Kunstzweiges
und bekam die Hauptwerke der wichtigsten Repräsen-
tanten anschaulich vorführt. Sowohl die Bibliothek des
Königlichen Kunstgewerbemuseums, als auch die Firmen
Amsler & Ruthardt, Kunstsalon und Verlag Jacques Casper,
Graphisches Kabinett J. B. Neumann, Hofkunsthandlung
Fritz Gurlitt, Axel Junckers Buchhandlung Karl Schnabel,
Buchhändler Edmund Meyer und Werckmeisters Kunst-
verlag hatten zu dieser Ausstellung in bemerkenswerter
Weise beigetragen. Außerdem hatte Professor Emil Orlik
seine technisch so wertvollen, wie lehrreichen Blätter in
verschiedenen Zuständen und die Holzstöcke dazu bei-
gesteuert. P- W.
Die Frage: »Verlegereinband oder Hatideinb and?«- wurde
auf einem Fachabend zur Diskussion gestellt. Der Buch-
binder, der mit der Hand bindet, fragt sich ängstlich, ob
im Laufe weniger Jahre seine Arbeit nicht ganz überflüssig
sein werde, ob nicht seine mühselige, und doch liebevolle
Arbeitsweise nun bald ausgeschaltet sein werde als Über-
bleibsel einer alten Zeit, da man sie im »old curiosity
shop« ausgestellt. Aber die Frage ist so, wie sie gestellt
ist, falsch: Hat der Handeinband neben dem billiger und
schneller hergestellten Massenband eine Existenzberech-
tigung? Die Frage muß heißen: Wie kommt es, daß
sich trotz seiner umständlichen Herstellungsweise, seines
höheren Preises der Handeinband so hartnäckig gegen den
wuchtigen Konkurrenten, den Verlegermassenband, be-
hauptet hat? Und wenn man dann die Vorzüge des Hand-
einbandes (schalten wir den Luxuseinband einmal aus)
herzählt, dann hat man des Pudels Kern gefunden. Da
ist die große Haltbarkeit des Handbandes, die Möglichkeit,
seinem Besitzer ein Buch nach seinem Geschmack zn sein,
und schließlich seine Unentbehrlichkeit für den Einband
der großen, namentlich öffentlichen Bibliotheken, die halt-
bare und gleichförmige Einbände gebrauchen. Und weil
der maschinelle Einband diese Vorzüge nicht besitzt, des-
halb ist der Handeinband eben der ideale Bucheinband.
An dieser Stelle mögen noch einige Worte gesagt sein,
die sich an den Sortimentsbuchbinder wenden, und die dem
kaufenden Publikum zugute kommen sollen. — Der Ver-
leger oder der Großbuchbinder kann sich von Künstlern
Entwürfe fertigen lassen für Einbände, die in der Her-
stellung vielleicht nur 50 Pfennige kosten, er kann sich die
Materialien mit eigens nach diesen Entwürfen gefertigten
und kostspieligen Platten bedrucken lassen, die [sich für
die große Auflage bezahlt machen. So ist ihm die Mög-
lichkeit gegeben, sein Buch auf eine geschmackliche Höhe
zu bringen, die der Handwerker, der mit der markt-
gängigen Ware vorlieb nehmen muß, schwer zu erreichen
vermag. Ich erinnere nur an die Einbände des Insel-
Verlages, die oft gerade durch ihr künstlerisches Aussehen
dem Publikum den Anreiz zum Kaufen des Buches ge-
geben haben. Die Verleger entdeckten alte Papiermuster
und Einbandarten, die der Handwerker entweder gar nicht
kannte, oder deren Reiz er nicht verstand. Hier muß es
das Bestreben des Sortimentsbuchbinders sein, sein Buch
an Geschmackswert auf eine gleiche Stufe mit dem Massen-
einband zu stellen. Gerade für den billigen Einband soll
dies gesagt sein. Will der Buchbinder neben dem Groß-
betriebe bestehen, dann muß er dem Käufer die An-
regung geben, zu ihm zu kommen, auch wenn jener mehr
nach dem Geschmack als nach der Dauerhaftigkeit der
Ware fragt. Das Streben nach dem geschmackvollen Äußer-
lichen muß das Publikum unmerklich von den besseren
Eigenschaften des Handeinbandes überzeugen. Gewiß,
auch Verleger haben häßliche Einbandarten gebracht, aber
auch vom Handwerker ist hierin viel gesündigt worden
und wird noch viel gesündigt. Und doch ist es nicht
schwer, Geschmackvolles zu leisten. Der heutige Ge-
schmack des Publikums weist nach der »aparten« Seite.
Kontrastierende und doch harmonierende Farben gefallen
und geben unendlich feine Effekte. Ein Papier, vielleicht
gar nicht für den Buchhandel bestimmt, kann schöner sein,
als die gebräuchliche Ware mit Mustern, die zum Teil
gar nicht mehr existieren dürften. Damit soll nur an-
deutungsweise der Weg gezeigt sein, weil hier das künst-
lerische Gefühl des einzelnen Verfertigers sprechen muß.
Für den Luxuseinband macht das heutige künstlerische
Buchbindegewerbe Propaganda. Aber auch für den ein-
fachen Einband gibt es noch viele Freunde zu gewinnen,
damit ihm sein mächtiger Vetter, der Massenband, nicht
über den Kopf wächst. Ernst Collin.
Der Vortrag des neuen Direktors der Charlottenburger
Kunstgewerbeschule, Professor Wilhelm Thiele, hatte sehr
zahlreiche Mitglieder herbeigelockt, die den Saal bis auf
den letzten Platz füllten. Thiele sprach über die Kunst-
gewerbeschulen im allgemeinen. Er gab Altes in neuer
Form und Neues in der Art eines frischen, gelobenden
Bekenntnisses, die scharf aufhorchen ließ. Daß die Kunst-
gewerbeschulen nicht Handwerker erziehen und die Meister-
lehre ausschalten können, sondern daß sie dazu da seien,
Handwerker erst nach vollendeter praktischer Lehrzeit auf
ein künstlerisch höher stehendes Niveau zu heben, ihnen
den allgemeinen Überblick zu ermöglichen, das kann nicht
oft genug wiederholt werden. Ebenso, daß ein sehr sorg-
fältiges Zeichenstudium nach der Natur die Grundlage des
Gesamtunterrichts bilden müsse; daß Werkstätten not-
wendig seien; daß die Handwerksmeister doch endlich
aufhören möchten mit ihren kleinlichen Konkurrenzeinwen-
dungen gegen den, in seinen Erträgnissen dem Schul-
betrieb wieder zugute kommenden Verkauf der sich un-
nötig auf stapelnden Werkstättenarbeiten usw. Der Redner
entwickelte so ein Schulprogramm, aus dem man erkennen
konnte, daß es in der Charlottenburger Anstalt endlich
tagt und daß diese Schule auf dem besten Wege ist, sich
neuzeitlich umzugestalten. Professor Thiele wendete sich
temperamentvoll gegen die Gefahr, die in der lebens-
länglichen Anstellung der Kräfte, die (wie wir aus dem
15
Kunstgewerbeblatt. N. F. XXV. H. 5
97