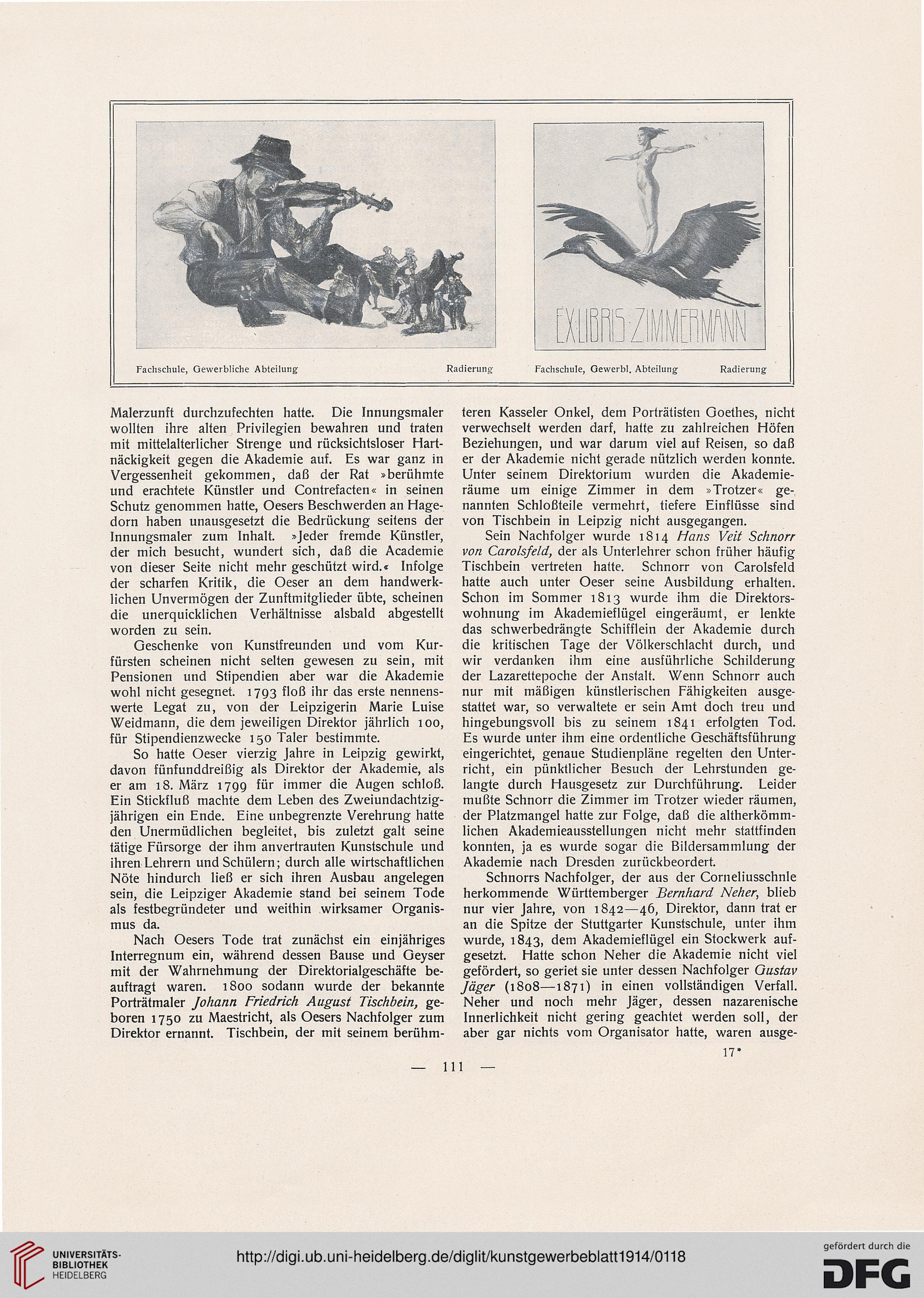Malerzunft durchzufechten hatte. Die Innungsmaler
wollten ihre alten Privilegien bewahren und traten
mit mittelalterlicher Strenge und rücksichtsloser Hart-
näckigkeit gegen die Akademie auf. Es war ganz in
Vergessenheit gekommen, daß der Rat »berühmte
und erachtete Künstler und Contrefacten« in seinen
Schutz genommen hatte, Oesers Beschwerden an Hage-
dorn haben unausgesetzt die Bedrückung seitens der
Innungsmaler zum Inhalt. »Jeder fremde Künstler,
der mich besucht, wundert sich, daß die Academie
von dieser Seite nicht mehr geschützt wird.« Infolge
der scharfen Kritik, die Oeser an dem handwerk-
lichen Unvermögen der Zunftmitglieder übte, scheinen
die unerquicklichen Verhältnisse alsbald abgestellt
worden zu sein.
Geschenke von Kunstfreunden und vom Kur-
fürsten scheinen nicht selten gewesen zu sein, mit
Pensionen und Stipendien aber war die Akademie
wohl nicht gesegnet. 1793 floß ihr das erste nennens-
werte Legat zu, von der Leipzigerin Marie Luise
Weidmann, die dem jeweiligen Direktor jährlich 100,
für Stipendienzwecke 150 Taler bestimmte.
So hatte Oeser vierzig Jahre in Leipzig gewirkt,
davon fünfunddreißig als Direktor der Akademie, als
er am 18. März 1799 für immer die Augen schloß.
Ein Stickfluß machte dem Leben des Zweiundachtzig-
jährigen ein Ende. Eine unbegrenzte Verehrung hatte
den Unermüdlichen begleitet, bis zuletzt galt seine
tätige Fürsorge der ihm anvertrauten Kunstschule und
ihren Lehrern und Schülern; durch alle wirtschaftlichen
Nöte hindurch ließ er sich ihren Ausbau angelegen
sein, die Leipziger Akademie stand bei seinem Tode
als festbegründeter und weithin wirksamer Organis-
mus da.
Nach Oesers Tode trat zunächst ein einjähriges
Interregnum ein, während dessen Bause und Geyser
mit der Wahrnehmung der Direktorialgeschäfte be-
auftragt waren. 1800 sodann wurde der bekannte
Porträtmaler Johann Friedrich August Tischbein, ge-
boren 1750 zu Maestricht, als Oesers Nachfolger zum
Direktor ernannt. Tischbein, der mit seinem berühm-
teren Kasseler Onkel, dem Porträtisten Goethes, nicht
verwechselt werden darf, hatte zu zahlreichen Höfen
Beziehungen, und war darum viel auf Reisen, so daß
er der Akademie nicht gerade nützlich werden konnte.
Unter seinem Direktorium wurden die Akademie-
räume um einige Zimmer in dem »Trotzer« ge-
nannten Schloßteile vermehrt, tiefere Einflüsse sind
von Tischbein in Leipzig nicht ausgegangen.
Sein Nachfolger wurde 1814 Hans Veit Schnorr
von Carolsfeld, der als Unterlehrer schon früher häufig
Tischbein vertreten hatte. Schnorr von Carolsfeld
hatte auch unter Oeser seine Ausbildung erhalten.
Schon im Sommer 1813 wurde ihm die Direktors-
wohnung im Akademieflügel eingeräumt, er lenkte
das schwerbedrängte Schifflein der Akademie durch
die kritischen Tage der Völkerschlacht durch, und
wir verdanken ihm eine ausführliche Schilderung
der Lazarettepoche der Anstalt. Wenn Schnorr auch
nur mit mäßigen künstlerischen Fähigkeiten ausge-
stattet war, so verwaltete er sein Amt doch treu und
hingebungsvoll bis zu seinem 1841 erfolgten Tod.
Es wurde unter ihm eine ordentliche Geschäftsführung
eingerichtet, genaue Studienpläne regelten den Unter-
richt, ein pünktlicher Besuch der Lehrstunden ge-
langte durch Hausgesetz zur Durchführung. Leider
mußte Schnorr die Zimmer im Trotzer wieder räumen,
der Platzmangel hatte zur Folge, daß die altherkömm-
lichen Akademieausstellungen nicht mehr stattfinden
konnten, ja es wurde sogar die Bildersammlung der
Akademie nach Dresden zurückbeordert.
Schnorrs Nachfolger, der aus der Corneliusschnle
herkommende Württemberger Bernhard Neher, blieb
nur vier Jahre, von 1842—46, Direktor, dann trat er
an die Spitze der Stuttgarter Kunstschule, unter ihm
wurde, 1843, dem Akademieflügel ein Stockwerk auf-
gesetzt. Hatte schon Neher die Akademie nicht viel
gefördert, so geriet sie unter dessen Nachfolger Gustav
Jäger (1808—1871) in einen vollständigen Verfall.
Neher und noch mehr Jäger, dessen nazarenische
Innerlichkeit nicht gering geachtet werden soll, der
aber gar nichts vom Organisator hatte, waren ausge-
17*
111