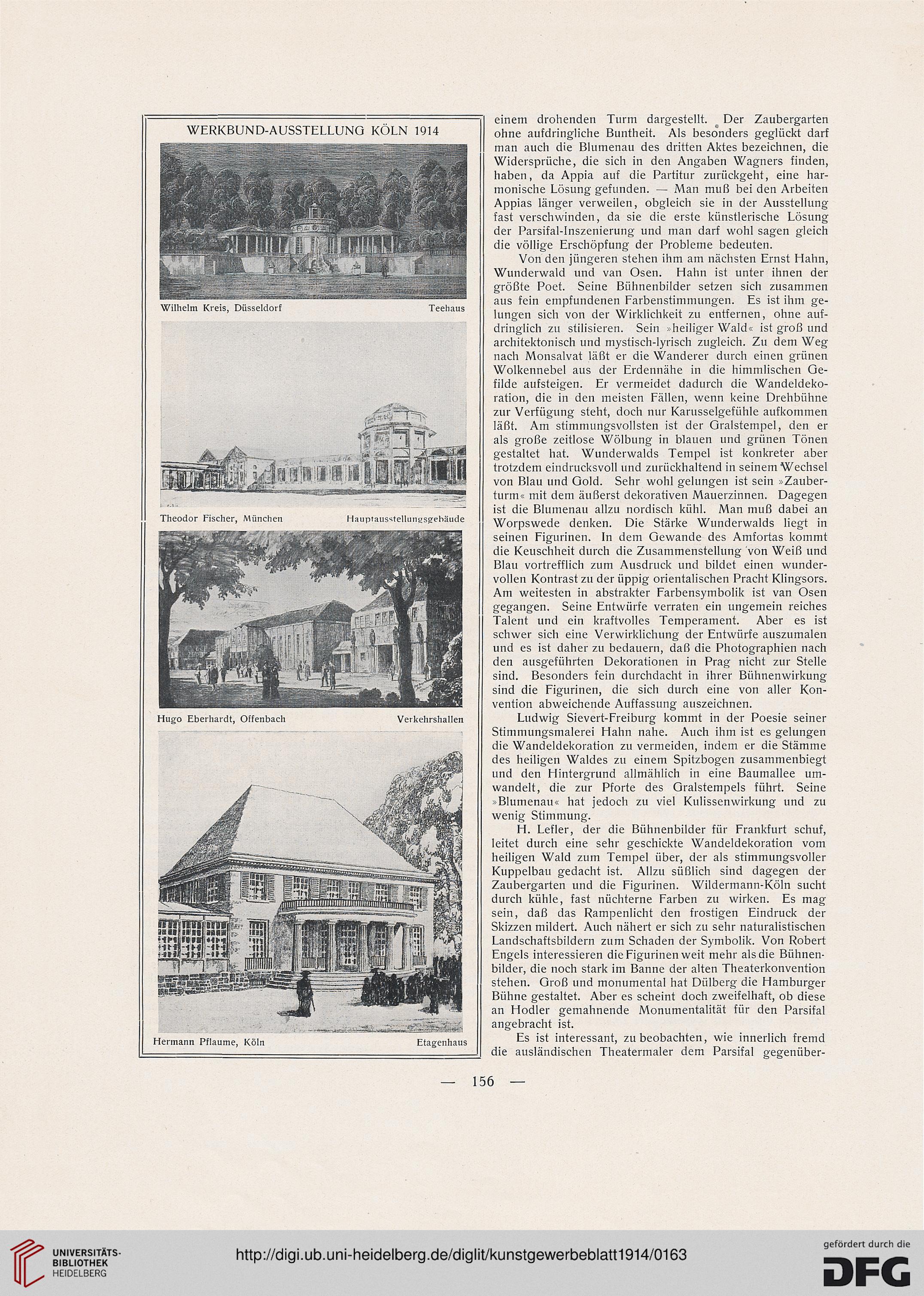Wilhelm Kreis, Düsseldorf
Teehaus
Theodor Fischer, München
Hauptausstellunys^ebäude
Hugo Eberhardt, Offenbach
Verkehrshallen
Hermann Pflaume, Köln
Etagenhaus
fiinHUiumummnimm
einem drohenden Turm dargestellt. Der Zaubergarten
ohne aufdringliche Buntheit. Als besonders geglückt darf
man auch die Blumenau des dritten Aktes bezeichnen, die
Widersprüche, die sich in den Angaben Wagners finden,
haben, da Appia auf die Partitur zurückgeht, eine har-
monische Lösung gefunden. — Man muß bei den Arbeiten
Appias länger verweilen, obgleich sie in der Ausstellung
fast verschwinden, da sie die erste künstlerische Lösung
der Parsifal-Inszenierung und man darf wohl sagen gleich
die völlige Erschöpfung der Probleme bedeuten.
Von den jüngeren stehen ihm am nächsten Ernst Hahn,
Wunderwald und van Ösen. Hahn ist unter ihnen der
größte Poet. Seine Bühnenbilder setzen sich zusammen
aus fein empfundenen Farbenstimmungen. Es ist ihm ge-
lungen sich von der Wirklichkeit zu entfernen, ohne auf-
dringlich zu stilisieren. Sein » heiliger Wald« ist groß und
architektonisch und mystisch-lyrisch zugleich. Zu dem Weg
nach Monsalvat läßt er die Wanderer durch einen grünen
Wolkennebel aus der Erdennähe in die himmlischen Ge-
filde aufsteigen. Er vermeidet dadurch die Wandeldeko-
ration, die in den meisten Fällen, wenn keine Drehbühne
zur Verfügung steht, doch nur Karusselgefühle aufkommen
läßt. Am stimmungsvollsten ist der Gralstempel, den er
als große zeitlose Wölbung in blauen und grünen Tönen
gestaltet hat. Wunderwalds Tempel ist konkreter aber
trotzdem eindrucksvoll und zurückhaltend in seinem Wechsel
von Blau und Gold. Sehr wohl gelungen ist sein »Zauber-
turm« mit dem äußerst dekorativen Mauerzinnen. Dagegen
ist die Blumenau allzu nordisch kühl. Man muß dabei an
Worpswede denken. Die Stärke Wunderwalds liegt in
seinen Figurinen. In dem Gewände des Amfortas kommt
die Keuschheit durch die Zusammenstellung von Weiß und
Blau vortrefflich zum Ausdruck und bildet einen wunder-
vollen Kontrast zu der üppig orientalischen Pracht Klingsors.
Am weitesten in abstrakter Farbensymbolik ist van Ösen
gegangen. Seine Entwürfe verraten ein ungemein reiches
Talent und ein kraftvolles Temperament. Aber es ist
schwer sich eine Verwirklichung der Entwürfe auszumalen
und es ist daher zu bedauern, daß die Photographien nach
den ausgeführten Dekorationen in Prag nicht zur Stelle
sind. Besonders fein durchdacht in ihrer Bühnenwirkung
sind die Figurinen, die sich durch eine von aller Kon-
vention abweichende Auffassung auszeichnen.
Ludwig Sievert-Freiburg kommt in der Poesie seiner
Stimmungsmalerei Hahn nahe. Auch ihm ist es gelungen
die Wandeldekoration zu vermeiden, indem er die Stämme
des heiligen Waldes zu einem Spitzbogen zusammenbiegt
und den Hintergrund allmählich in eine Baumallee um-
wandelt, die zur Pforte des Gralstempels führt. Seine
»Blumenau« hat jedoch zu viel Kulissenwirkung und zu
wenig Stimmung.
H. Lefler, der die Bühnenbilder für Frankfurt schuf,
leitet durch eine sehr geschickte Wandeldekoration vom
heiligen Wald zum Tempel über, der als stimmungsvoller
Kuppelbau gedacht ist. Allzu süßlich sind dagegen der
Zaubergarten und die Figurinen. Wildermann-Köln sucht
durch kühle, fast nüchterne Farben zu wirken. Es mag
sein, daß das Rampenlicht den frostigen Eindruck der
Skizzen mildert. Auch nähert er sich zu sehr naturalistischen
Landschaftsbildern zum Schaden der Symbolik. Von Robert
Engels interessieren die Figurinen weit mehr als die Bühnen-
bilder, die noch stark im Banne der alten Theaterkonvention
stehen. Groß und monumental hat Dülberg die Hamburger
Bühne gestaltet. Aber es scheint doch zweifelhaft, ob diese
an Hodler gemahnende Monumentalität für den Parsifal
angebracht ist.
Es ist interessant, zu beobachten, wie innerlich fremd
die ausländischen Theatermaler dem Parsifal gegenüber-
156