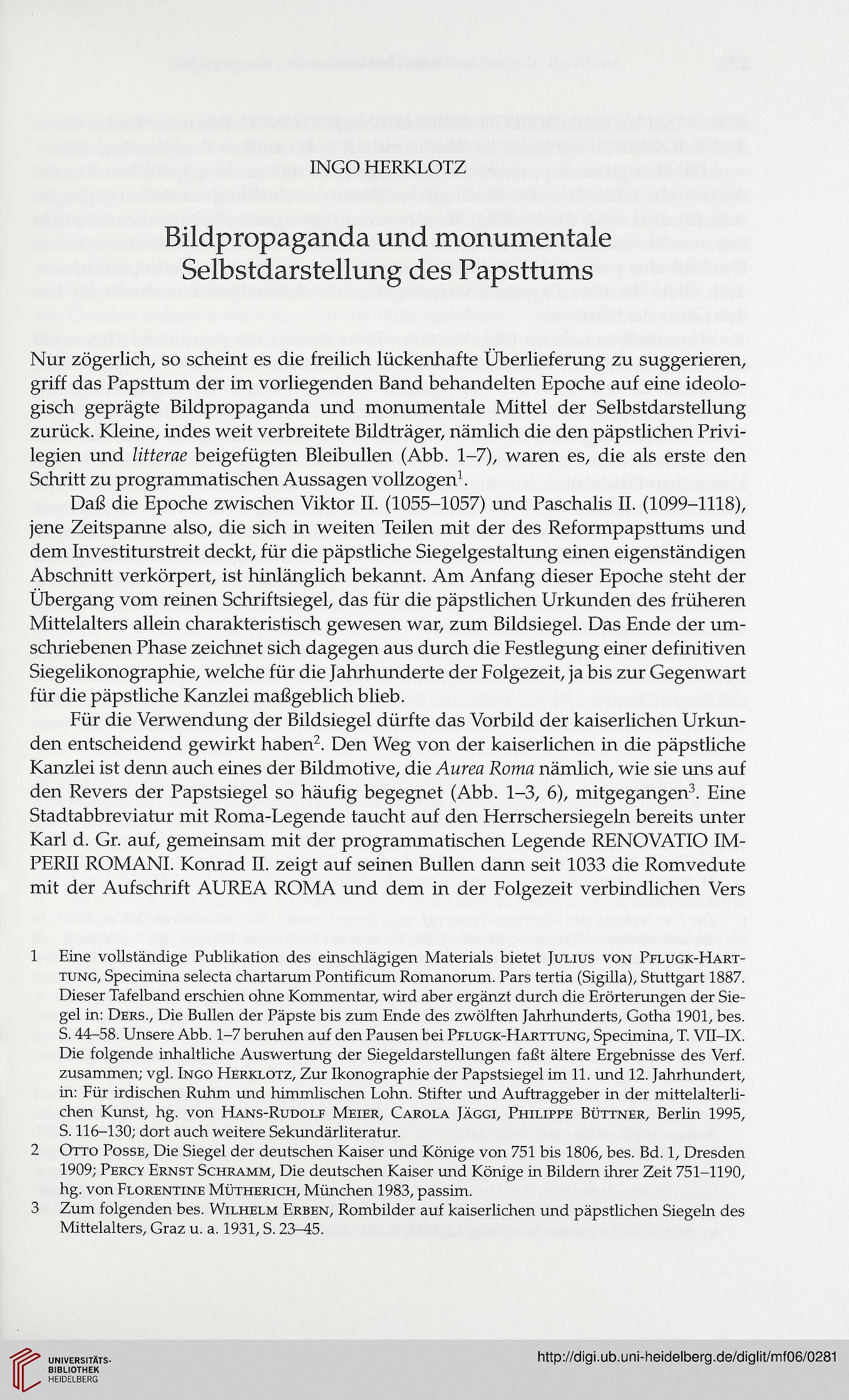INGO HERKLOTZ
Bildpropaganda und monumentale
Selbstdarstellung des Papsttums
Nur zögerlich, so scheint es die freilich lückenhafte Überlieferung zu suggerieren,
griff das Papsttum der im vorliegenden Band behandelten Epoche auf eine ideolo-
gisch geprägte Bildpropaganda und monumentale Mittel der Selbstdarstellung
zurück. Kleine, indes weit verbreitete Bildträger, nämlich die den päpstlichen Privi-
legien und litterae beigefügten Bleibullen (Abb. 1-7), waren es, die als erste den
Schritt zu programmatischen Aussagen vollzogen1.
Daß die Epoche zwischen Viktor II. (1055-1057) und Paschalis II. (1099-1118),
jene Zeitspanne also, die sich in weiten Teilen mit der des Reformpapsttums und
dem Investiturstreit deckt, für die päpstliche Siegelgestaltung einen eigenständigen
Abschnitt verkörpert, ist hinlänglich bekannt. Am Anfang dieser Epoche steht der
Übergang vom reinen Schriftsiegel, das für die päpstlichen Urkunden des früheren
Mittelalters allein charakteristisch gewesen war, zum Bildsiegel. Das Ende der um-
schriebenen Phase zeichnet sich dagegen aus durch die Festlegung einer definitiven
Siegelikonographie, welche für die Jahrhunderte der Folgezeit, ja bis zur Gegenwart
für die päpstliche Kanzlei maßgeblich blieb.
Für die Verwendung der Bildsiegel dürfte das Vorbild der kaiserlichen Urkun-
den entscheidend gewirkt haben2. Den Weg von der kaiserlichen in die päpstliche
Kanzlei ist denn auch eines der Bildmotive, die Aurea Roma nämlich, wie sie uns auf
den Revers der Papstsiegel so häufig begegnet (Abb. 1-3, 6), mitgegangen3. Eine
Stadtabbreviatur mit Roma-Legende taucht auf den Herrschersiegeln bereits unter
Karl d. Gr. auf, gemeinsam mit der programmatischen Legende RENOVATIO IM-
PERII ROMANI. Konrad II. zeigt auf seinen Bullen dann seit 1033 die Romvedute
mit der Aufschrift AUREA ROMA und dem in der Folgezeit verbindlichen Vers
1 Eine vollständige Publikation des einschlägigen Materials bietet Julius von Pflugk-Hart-
tung, Specimina selecta chartarum Pontificum Romanorum. Pars tertia (Sigilla), Stuttgart 1887.
Dieser Tafelband erschien ohne Kommentar, wird aber ergänzt durch die Erörterungen der Sie-
gel in: Ders., Die Bullen der Päpste bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, Gotha 1901, bes.
S. 44—58. Unsere Abb. 1-7 beruhen auf den Pausen bei Pflugk-Harttung, Specimina, T. VTI-IX.
Die folgende inhaltliche Auswertung der Siegeldarstellungen faßt ältere Ergebnisse des Verf.
zusammen; vgl. Ingo Herklotz, Zur Ikonographie der Papstsiegel im 11. und 12. Jahrhundert,
in: Für irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in der mittelalterli-
chen Kunst, hg. von Hans-Rudolf Meier, Carola Jäggi, Philippe Büttner, Berlin 1995,
S. 116-130; dort auch weitere Sekundärliteratur.
2 Otto Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806, bes. Bd. 1, Dresden
1909; Percy Ernst Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 751-1190,
hg. von Florentine Mütherich, München 1983, passim.
3 Zum folgenden bes. Wilhelm Erben, Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln des
Mittelalters, Graz u. a. 1931, S. 23-45.
Bildpropaganda und monumentale
Selbstdarstellung des Papsttums
Nur zögerlich, so scheint es die freilich lückenhafte Überlieferung zu suggerieren,
griff das Papsttum der im vorliegenden Band behandelten Epoche auf eine ideolo-
gisch geprägte Bildpropaganda und monumentale Mittel der Selbstdarstellung
zurück. Kleine, indes weit verbreitete Bildträger, nämlich die den päpstlichen Privi-
legien und litterae beigefügten Bleibullen (Abb. 1-7), waren es, die als erste den
Schritt zu programmatischen Aussagen vollzogen1.
Daß die Epoche zwischen Viktor II. (1055-1057) und Paschalis II. (1099-1118),
jene Zeitspanne also, die sich in weiten Teilen mit der des Reformpapsttums und
dem Investiturstreit deckt, für die päpstliche Siegelgestaltung einen eigenständigen
Abschnitt verkörpert, ist hinlänglich bekannt. Am Anfang dieser Epoche steht der
Übergang vom reinen Schriftsiegel, das für die päpstlichen Urkunden des früheren
Mittelalters allein charakteristisch gewesen war, zum Bildsiegel. Das Ende der um-
schriebenen Phase zeichnet sich dagegen aus durch die Festlegung einer definitiven
Siegelikonographie, welche für die Jahrhunderte der Folgezeit, ja bis zur Gegenwart
für die päpstliche Kanzlei maßgeblich blieb.
Für die Verwendung der Bildsiegel dürfte das Vorbild der kaiserlichen Urkun-
den entscheidend gewirkt haben2. Den Weg von der kaiserlichen in die päpstliche
Kanzlei ist denn auch eines der Bildmotive, die Aurea Roma nämlich, wie sie uns auf
den Revers der Papstsiegel so häufig begegnet (Abb. 1-3, 6), mitgegangen3. Eine
Stadtabbreviatur mit Roma-Legende taucht auf den Herrschersiegeln bereits unter
Karl d. Gr. auf, gemeinsam mit der programmatischen Legende RENOVATIO IM-
PERII ROMANI. Konrad II. zeigt auf seinen Bullen dann seit 1033 die Romvedute
mit der Aufschrift AUREA ROMA und dem in der Folgezeit verbindlichen Vers
1 Eine vollständige Publikation des einschlägigen Materials bietet Julius von Pflugk-Hart-
tung, Specimina selecta chartarum Pontificum Romanorum. Pars tertia (Sigilla), Stuttgart 1887.
Dieser Tafelband erschien ohne Kommentar, wird aber ergänzt durch die Erörterungen der Sie-
gel in: Ders., Die Bullen der Päpste bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, Gotha 1901, bes.
S. 44—58. Unsere Abb. 1-7 beruhen auf den Pausen bei Pflugk-Harttung, Specimina, T. VTI-IX.
Die folgende inhaltliche Auswertung der Siegeldarstellungen faßt ältere Ergebnisse des Verf.
zusammen; vgl. Ingo Herklotz, Zur Ikonographie der Papstsiegel im 11. und 12. Jahrhundert,
in: Für irdischen Ruhm und himmlischen Lohn. Stifter und Auftraggeber in der mittelalterli-
chen Kunst, hg. von Hans-Rudolf Meier, Carola Jäggi, Philippe Büttner, Berlin 1995,
S. 116-130; dort auch weitere Sekundärliteratur.
2 Otto Posse, Die Siegel der deutschen Kaiser und Könige von 751 bis 1806, bes. Bd. 1, Dresden
1909; Percy Ernst Schramm, Die deutschen Kaiser und Könige in Bildern ihrer Zeit 751-1190,
hg. von Florentine Mütherich, München 1983, passim.
3 Zum folgenden bes. Wilhelm Erben, Rombilder auf kaiserlichen und päpstlichen Siegeln des
Mittelalters, Graz u. a. 1931, S. 23-45.