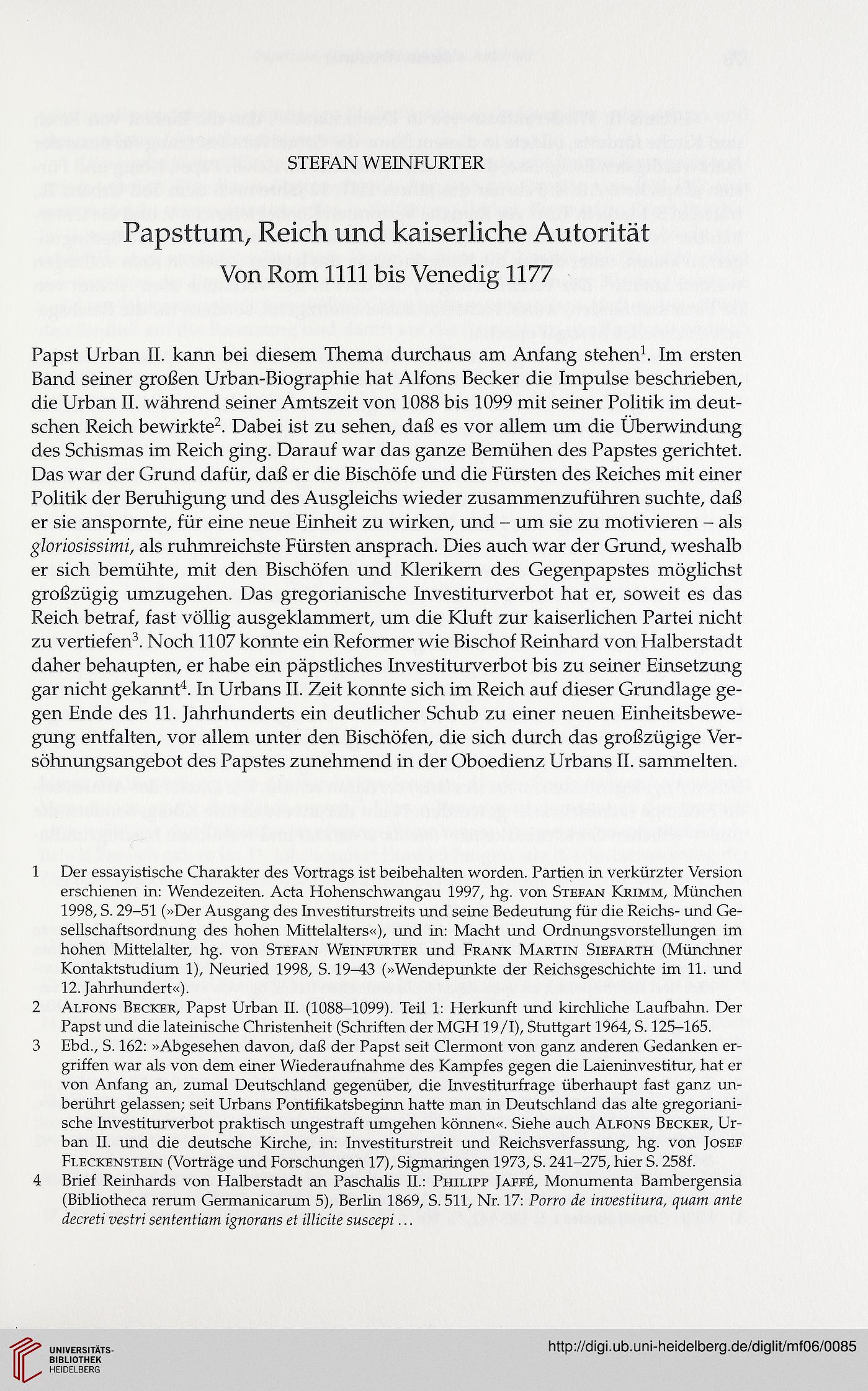STEFAN WEINFURTER
Papsttum, Reich und kaiserliche Autorität
Von Rom 1111 bis Venedig 1177
Papst Urban II. kann bei diesem Thema durchaus am Anfang stehen1. Im ersten
Band seiner großen Urban-Biographie hat Alfons Becker die Impulse beschrieben,
die Urban II. während seiner Amtszeit von 1088 bis 1099 mit seiner Politik im deut-
schen Reich bewirkte2. Dabei ist zu sehen, daß es vor allem um die Überwindung
des Schismas im Reich ging. Darauf war das ganze Bemühen des Papstes gerichtet.
Das war der Grund dafür, daß er die Bischöfe und die Fürsten des Reiches mit einer
Politik der Beruhigung und des Ausgleichs wieder zusammenzuführen suchte, daß
er sie anspornte, für eine neue Einheit zu wirken, und - um sie zu motivieren - als
gloriosissimi, als ruhmreichste Fürsten ansprach. Dies auch war der Grund, weshalb
er sich bemühte, mit den Bischöfen und Klerikern des Gegenpapstes möglichst
großzügig umzugehen. Das gregorianische Investiturverbot hat er, soweit es das
Reich betraf, fast völlig ausgeklammert, um die Kluft zur kaiserlichen Partei nicht
zu vertiefen3. Noch 1107 konnte ein Reformer wie Bischof Reinhard von Halberstadt
daher behaupten, er habe ein päpstliches Investiturverbot bis zu seiner Einsetzung
gar nicht gekannt4. In Urbans II. Zeit konnte sich im Reich auf dieser Grundlage ge-
gen Ende des 11. Jahrhunderts ein deutlicher Schub zu einer neuen Einheitsbewe-
gung entfalten, vor allem unter den Bischöfen, die sich durch das großzügige Ver-
söhnungsangebot des Papstes zunehmend in der Oboedienz Urbans II. sammelten.
1 Der essayistische Charakter des Vortrags ist beibehalten worden. Partien in verkürzter Version
erschienen in: Wendezeiten. Acta Hohenschwangau 1997, hg. von Stefan Krimm, München
1998, S. 29-51 (»Der Ausgang des Investiturstreits und seine Bedeutung für die Reichs- und Ge-
sellschaftsordnung des hohen Mittelalters«), und in: Macht und Ordnungsvorstellungen im
hohen Mittelalter, hg. von Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth (Münchner
Kontaktstudium 1), Neuried 1998, S. 19M3 (»Wendepunkte der Reichsgeschichte im 11. und
12. Jahrhundert«).
2 Alfons Becker, Papst Urban II. (1088-1099). Teil 1: Herkunft und kirchliche Laufbahn. Der
Papst und die lateinische Christenheit (Schriften der MGH 19/1), Stuttgart 1964, S. 125-165.
3 Ebd., S. 162: »Abgesehen davon, daß der Papst seit Clermont von ganz anderen Gedanken er-
griffen war als von dem einer Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Laieninvestitur, hat er
von Anfang an, zumal Deutschland gegenüber, die Investiturfrage überhaupt fast ganz un-
berührt gelassen; seit Urbans Pontifikatsbeginn hatte man in Deutschland das alte gregoriani-
sche Investiturverbot praktisch ungestraft umgehen können«. Siehe auch Alfons Becker, Ur-
ban II. und die deutsche Kirche, in: Investiturstreit und Reichsverfassung, hg. von Josef
Fleckenstein (Vorträge und Forschungen 17), Sigmaringen 1973, S. 241-275, hier S. 258f.
4 Brief Reinhards von Halberstadt an Paschalis II.: Philipp Jaffe, Monumenta Bambergensia
(Bibliotheca rerum Germanicarum 5), Berlin 1869, S. 511, Nr. 17: Porro de investitura, quam ante
decreti vestri sententiam ignorans et illicite suscepi...
Papsttum, Reich und kaiserliche Autorität
Von Rom 1111 bis Venedig 1177
Papst Urban II. kann bei diesem Thema durchaus am Anfang stehen1. Im ersten
Band seiner großen Urban-Biographie hat Alfons Becker die Impulse beschrieben,
die Urban II. während seiner Amtszeit von 1088 bis 1099 mit seiner Politik im deut-
schen Reich bewirkte2. Dabei ist zu sehen, daß es vor allem um die Überwindung
des Schismas im Reich ging. Darauf war das ganze Bemühen des Papstes gerichtet.
Das war der Grund dafür, daß er die Bischöfe und die Fürsten des Reiches mit einer
Politik der Beruhigung und des Ausgleichs wieder zusammenzuführen suchte, daß
er sie anspornte, für eine neue Einheit zu wirken, und - um sie zu motivieren - als
gloriosissimi, als ruhmreichste Fürsten ansprach. Dies auch war der Grund, weshalb
er sich bemühte, mit den Bischöfen und Klerikern des Gegenpapstes möglichst
großzügig umzugehen. Das gregorianische Investiturverbot hat er, soweit es das
Reich betraf, fast völlig ausgeklammert, um die Kluft zur kaiserlichen Partei nicht
zu vertiefen3. Noch 1107 konnte ein Reformer wie Bischof Reinhard von Halberstadt
daher behaupten, er habe ein päpstliches Investiturverbot bis zu seiner Einsetzung
gar nicht gekannt4. In Urbans II. Zeit konnte sich im Reich auf dieser Grundlage ge-
gen Ende des 11. Jahrhunderts ein deutlicher Schub zu einer neuen Einheitsbewe-
gung entfalten, vor allem unter den Bischöfen, die sich durch das großzügige Ver-
söhnungsangebot des Papstes zunehmend in der Oboedienz Urbans II. sammelten.
1 Der essayistische Charakter des Vortrags ist beibehalten worden. Partien in verkürzter Version
erschienen in: Wendezeiten. Acta Hohenschwangau 1997, hg. von Stefan Krimm, München
1998, S. 29-51 (»Der Ausgang des Investiturstreits und seine Bedeutung für die Reichs- und Ge-
sellschaftsordnung des hohen Mittelalters«), und in: Macht und Ordnungsvorstellungen im
hohen Mittelalter, hg. von Stefan Weinfurter und Frank Martin Siefarth (Münchner
Kontaktstudium 1), Neuried 1998, S. 19M3 (»Wendepunkte der Reichsgeschichte im 11. und
12. Jahrhundert«).
2 Alfons Becker, Papst Urban II. (1088-1099). Teil 1: Herkunft und kirchliche Laufbahn. Der
Papst und die lateinische Christenheit (Schriften der MGH 19/1), Stuttgart 1964, S. 125-165.
3 Ebd., S. 162: »Abgesehen davon, daß der Papst seit Clermont von ganz anderen Gedanken er-
griffen war als von dem einer Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Laieninvestitur, hat er
von Anfang an, zumal Deutschland gegenüber, die Investiturfrage überhaupt fast ganz un-
berührt gelassen; seit Urbans Pontifikatsbeginn hatte man in Deutschland das alte gregoriani-
sche Investiturverbot praktisch ungestraft umgehen können«. Siehe auch Alfons Becker, Ur-
ban II. und die deutsche Kirche, in: Investiturstreit und Reichsverfassung, hg. von Josef
Fleckenstein (Vorträge und Forschungen 17), Sigmaringen 1973, S. 241-275, hier S. 258f.
4 Brief Reinhards von Halberstadt an Paschalis II.: Philipp Jaffe, Monumenta Bambergensia
(Bibliotheca rerum Germanicarum 5), Berlin 1869, S. 511, Nr. 17: Porro de investitura, quam ante
decreti vestri sententiam ignorans et illicite suscepi...