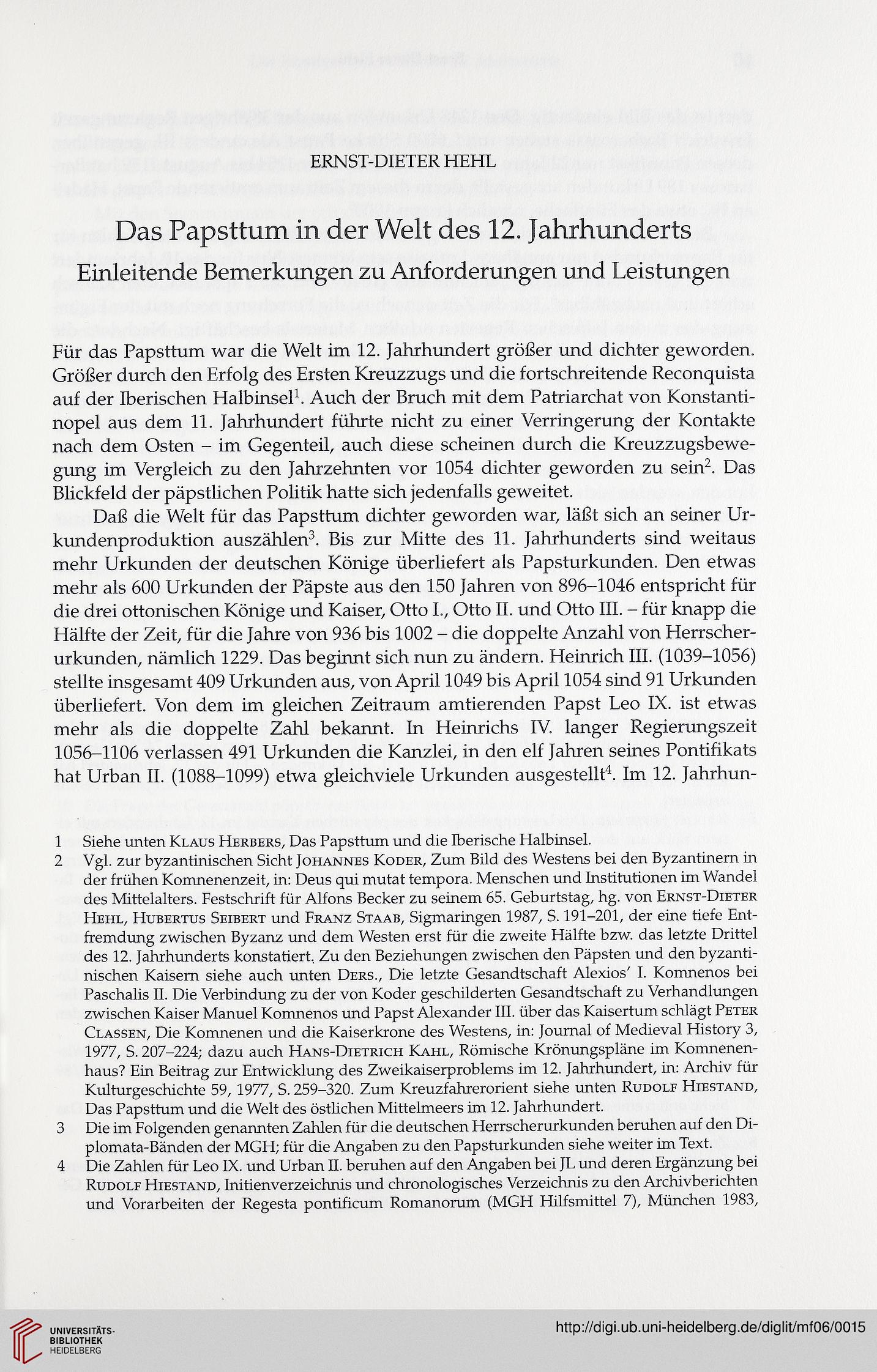ERNST-DIETER HEHL
Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts
Einleitende Bemerkungen zu Anforderungen und Leistungen
Für das Papsttum war die Welt im 12. Jahrhundert größer und dichter geworden.
Größer durch den Erfolg des Ersten Kreuzzugs und die fortschreitende Reconquista
auf der Iberischen Halbinsel1. Auch der Bruch mit dem Patriarchat von Konstanti-
nopel aus dem 11. Jahrhundert führte nicht zu einer Verringerung der Kontakte
nach dem Osten - im Gegenteil, auch diese scheinen durch die Kreuzzugsbewe-
gung im Vergleich zu den Jahrzehnten vor 1054 dichter geworden zu sein2. Das
Blickfeld der päpstlichen Politik hatte sich jedenfalls geweitet.
Daß die Welt für das Papsttum dichter geworden war, läßt sich an seiner Ur-
kundenproduktion auszählen3. Bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts sind weitaus
mehr Urkunden der deutschen Könige überliefert als Papsturkunden. Den etwas
mehr als 600 Urkunden der Päpste aus den 150 Jahren von 896-1046 entspricht für
die drei ottonischen Könige und Kaiser, Otto I., Otto II. und Otto III. - für knapp die
Hälfte der Zeit, für die Jahre von 936 bis 1002 - die doppelte Anzahl von Herrscher-
urkunden, nämlich 1229. Das beginnt sich nun zu ändern. Heinrich III. (1039-1056)
stellte insgesamt 409 Urkunden aus, von April 1049 bis April 1054 sind 91 Urkunden
überliefert. Von dem im gleichen Zeitraum amtierenden Papst Leo IX. ist etwas
mehr als die doppelte Zahl bekannt. In Heinrichs IV. langer Regierungszeit
1056-1106 verlassen 491 Urkunden die Kanzlei, in den elf Jahren seines Pontifikats
hat Urban II. (1088-1099) etwa gleichviel Urkunden ausgestellt4. Im 12. Jahrhun-
1 Siehe unten Klaus Herbers, Das Papsttum und die Iberische Halbinsel.
2 Vgl. zur byzantinischen Sicht Johannes Koder, Zum Bild des Westens bei den Byzantinern in
der frühen Komnenenzeit, in: Deus qui mutat tempora. Menschen und Institutionen im Wandel
des Mittelalters. Festschrift für Alfons Becker zu seinem 65. Geburtstag, hg. von Ernst-Dieter
Hehl, Hubertus Seibert und Franz Staab, Sigmaringen 1987, S. 191-201, der eine tiefe Ent-
fremdung zwischen Byzanz und dem Westen erst für die zweite Hälfte bzw. das letzte Drittel
des 12. Jahrhunderts konstatiert, Zu den Beziehungen zwischen den Päpsten und den byzanti-
nischen Kaisern siehe auch unten Ders., Die letzte Gesandtschaft Alexios' I. Komnenos bei
Paschalis II. Die Verbindung zu der von Koder geschilderten Gesandtschaft zu Verhandlungen
zwischen Kaiser Manuel Komnenos und Papst Alexander III. über das Kaisertum schlägt Peter
Classen, Die Komnenen und die Kaiserkrone des Westens, in: Journal of Medieval History 3,
1977, S. 207-224; dazu auch Hans-Dietrich Kahl, Römische Krönungspläne im Komnenen-
haus? Ein Beitrag zur Entwicklung des Zweikaiserproblems im 12. Jahrhundert, in: Archiv für
Kulturgeschichte 59, 1977, S. 259-320. Zum Kreuzfahrerorient siehe unten Rudolf Hiestand,
Das Papsttum und die Welt des östlichen Mittelmeers im 12. Jahrhundert.
3 Die im Folgenden genannten Zahlen für die deutschen Herrscherurkunden beruhen auf den Di-
plomata-Bänden der MGH; für die Angaben zu den Papsturkunden siehe weiter im Text.
4 Die Zahlen für Leo IX. und Urban II. beruhen auf den Angaben bei JL und deren Ergänzung bei
Rudolf Hiestand, Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den Archivberichten
und Vorarbeiten der Regesta pontificum Romanorum (MGH Hilfsmittel 7), München 1983,
Das Papsttum in der Welt des 12. Jahrhunderts
Einleitende Bemerkungen zu Anforderungen und Leistungen
Für das Papsttum war die Welt im 12. Jahrhundert größer und dichter geworden.
Größer durch den Erfolg des Ersten Kreuzzugs und die fortschreitende Reconquista
auf der Iberischen Halbinsel1. Auch der Bruch mit dem Patriarchat von Konstanti-
nopel aus dem 11. Jahrhundert führte nicht zu einer Verringerung der Kontakte
nach dem Osten - im Gegenteil, auch diese scheinen durch die Kreuzzugsbewe-
gung im Vergleich zu den Jahrzehnten vor 1054 dichter geworden zu sein2. Das
Blickfeld der päpstlichen Politik hatte sich jedenfalls geweitet.
Daß die Welt für das Papsttum dichter geworden war, läßt sich an seiner Ur-
kundenproduktion auszählen3. Bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts sind weitaus
mehr Urkunden der deutschen Könige überliefert als Papsturkunden. Den etwas
mehr als 600 Urkunden der Päpste aus den 150 Jahren von 896-1046 entspricht für
die drei ottonischen Könige und Kaiser, Otto I., Otto II. und Otto III. - für knapp die
Hälfte der Zeit, für die Jahre von 936 bis 1002 - die doppelte Anzahl von Herrscher-
urkunden, nämlich 1229. Das beginnt sich nun zu ändern. Heinrich III. (1039-1056)
stellte insgesamt 409 Urkunden aus, von April 1049 bis April 1054 sind 91 Urkunden
überliefert. Von dem im gleichen Zeitraum amtierenden Papst Leo IX. ist etwas
mehr als die doppelte Zahl bekannt. In Heinrichs IV. langer Regierungszeit
1056-1106 verlassen 491 Urkunden die Kanzlei, in den elf Jahren seines Pontifikats
hat Urban II. (1088-1099) etwa gleichviel Urkunden ausgestellt4. Im 12. Jahrhun-
1 Siehe unten Klaus Herbers, Das Papsttum und die Iberische Halbinsel.
2 Vgl. zur byzantinischen Sicht Johannes Koder, Zum Bild des Westens bei den Byzantinern in
der frühen Komnenenzeit, in: Deus qui mutat tempora. Menschen und Institutionen im Wandel
des Mittelalters. Festschrift für Alfons Becker zu seinem 65. Geburtstag, hg. von Ernst-Dieter
Hehl, Hubertus Seibert und Franz Staab, Sigmaringen 1987, S. 191-201, der eine tiefe Ent-
fremdung zwischen Byzanz und dem Westen erst für die zweite Hälfte bzw. das letzte Drittel
des 12. Jahrhunderts konstatiert, Zu den Beziehungen zwischen den Päpsten und den byzanti-
nischen Kaisern siehe auch unten Ders., Die letzte Gesandtschaft Alexios' I. Komnenos bei
Paschalis II. Die Verbindung zu der von Koder geschilderten Gesandtschaft zu Verhandlungen
zwischen Kaiser Manuel Komnenos und Papst Alexander III. über das Kaisertum schlägt Peter
Classen, Die Komnenen und die Kaiserkrone des Westens, in: Journal of Medieval History 3,
1977, S. 207-224; dazu auch Hans-Dietrich Kahl, Römische Krönungspläne im Komnenen-
haus? Ein Beitrag zur Entwicklung des Zweikaiserproblems im 12. Jahrhundert, in: Archiv für
Kulturgeschichte 59, 1977, S. 259-320. Zum Kreuzfahrerorient siehe unten Rudolf Hiestand,
Das Papsttum und die Welt des östlichen Mittelmeers im 12. Jahrhundert.
3 Die im Folgenden genannten Zahlen für die deutschen Herrscherurkunden beruhen auf den Di-
plomata-Bänden der MGH; für die Angaben zu den Papsturkunden siehe weiter im Text.
4 Die Zahlen für Leo IX. und Urban II. beruhen auf den Angaben bei JL und deren Ergänzung bei
Rudolf Hiestand, Initienverzeichnis und chronologisches Verzeichnis zu den Archivberichten
und Vorarbeiten der Regesta pontificum Romanorum (MGH Hilfsmittel 7), München 1983,