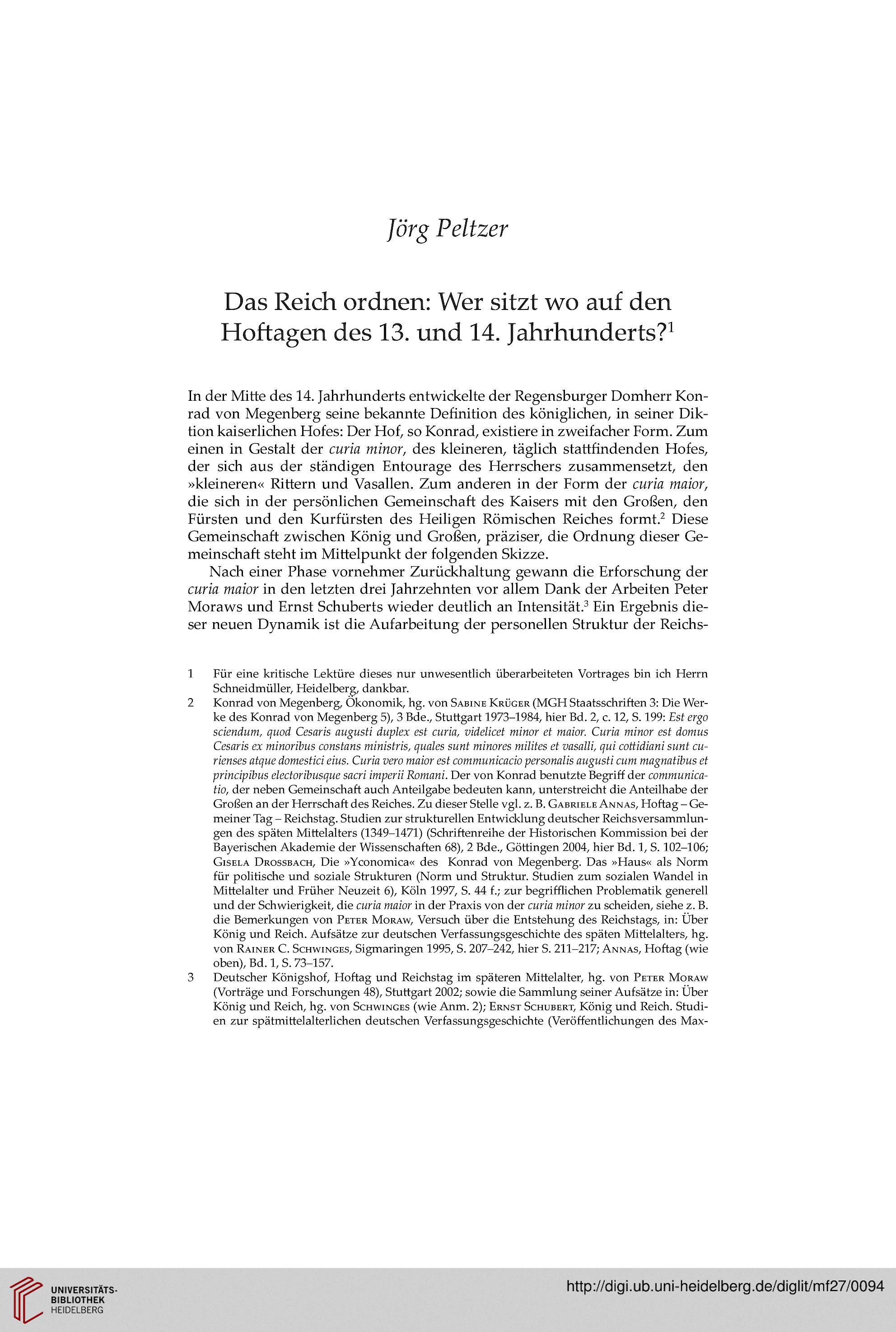Jörg Peltzer
Das Reich ordnen: Wer sitzt wo auf den
Hoftagen des 13. und 14. Jahrhunderts?1
In der Mitte des 14. Jahrhunderts entwickelte der Regensburger Domherr Kon-
rad von Megenberg seine bekannte Definition des königlichen, in seiner Dik-
tion kaiserlichen Hofes: Der Hof, so Konrad, existiere in zweifacher Form. Zum
einen in Gestalt der curia minor, des kleineren, täglich stattfindenden Hofes,
der sich aus der ständigen Entourage des Herrschers zusammensetzt, den
»kleineren« Rittern und Vasallen. Zum anderen in der Form der curia maior,
die sich in der persönlichen Gemeinschaft des Kaisers mit den Großen, den
Fürsten und den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches formt.2 Diese
Gemeinschaft zwischen König und Großen, präziser, die Ordnung dieser Ge-
meinschaft steht im Mittelpunkt der folgenden Skizze.
Nach einer Phase vornehmer Zurückhaltung gewann die Erforschung der
curia maior in den letzten drei Jahrzehnten vor allem Dank der Arbeiten Peter
Moraws und Ernst Schuberts wieder deutlich an Intensität.3 Ein Ergebnis die-
ser neuen Dynamik ist die Aufarbeitung der personellen Struktur der Reichs-
1 Für eine kritische Lektüre dieses nur unwesentlich überarbeiteten Vortrages bin ich Herrn
Schneidmüller, Heidelberg, dankbar.
2 Konrad von Megenberg, Ökonomik, hg. von Sabine Krüger (MGH Staatsschriften 3: Die Wer-
ke des Konrad von Megenberg 5), 3 Bde., Stuttgart 1973-1984, hier Bd. 2, c. 12, S. 199: Est ergo
sciendum, quod Cesaris augusti duplex est curia, videlicet minor et maior. Curia minor est domus
Cesaris ex minoribus constans ministris, quales sunt minores milites et vasalli, qui cottidiani sunt cu-
rienses atque domestici eius. Curia vero maior est communicacio personalis augusti cum magnatibus et
principibus electoribusque sacri imperii Romani. Der von Konrad benutzte Begriff der communica-
tio, der neben Gemeinschaft auch Anteilgabe bedeuten kann, unterstreicht die Anteilhabe der
Großen an der Herrschaft des Reiches. Zu dieser Stelle vgl. z. B. Gabriele Annas, Hoftag - Ge-
meiner Tag - Reichstag. Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher Reichsversammlun-
gen des späten Mittelalters (1349-1471) (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 68), 2 Bde., Göttingen 2004, hier Bd. 1, S. 102-106;
Gisela Drossbach, Die »Yconomica« des Konrad von Megenberg. Das »Haus« als Norm
für politische und soziale Strukturen (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittelalter und Früher Neuzeit 6), Köln 1997, S. 44 f.; zur begrifflichen Problematik generell
und der Schwierigkeit, die curia maior in der Praxis von der curia minor zu scheiden, siehe z. B.
die Bemerkungen von Peter Moraw, Versuch über die Entstehung des Reichstags, in: Über
König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, hg.
von Rainer C. Schwinges, Sigmaringen 1995, S. 207-242, hier S. 211-217; Annas, Hoftag (wie
oben), Bd. 1, S. 73-157.
3 Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg. von Peter Moraw
(Vorträge und Forschungen 48), Stuttgart 2002; sowie die Sammlung seiner Aufsätze in: Über
König und Reich, hg. von Schwinges (wie Anm. 2); Ernst Schubert, König und Reich. Studi-
en zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte (Veröffentlichungen des Max-
Das Reich ordnen: Wer sitzt wo auf den
Hoftagen des 13. und 14. Jahrhunderts?1
In der Mitte des 14. Jahrhunderts entwickelte der Regensburger Domherr Kon-
rad von Megenberg seine bekannte Definition des königlichen, in seiner Dik-
tion kaiserlichen Hofes: Der Hof, so Konrad, existiere in zweifacher Form. Zum
einen in Gestalt der curia minor, des kleineren, täglich stattfindenden Hofes,
der sich aus der ständigen Entourage des Herrschers zusammensetzt, den
»kleineren« Rittern und Vasallen. Zum anderen in der Form der curia maior,
die sich in der persönlichen Gemeinschaft des Kaisers mit den Großen, den
Fürsten und den Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches formt.2 Diese
Gemeinschaft zwischen König und Großen, präziser, die Ordnung dieser Ge-
meinschaft steht im Mittelpunkt der folgenden Skizze.
Nach einer Phase vornehmer Zurückhaltung gewann die Erforschung der
curia maior in den letzten drei Jahrzehnten vor allem Dank der Arbeiten Peter
Moraws und Ernst Schuberts wieder deutlich an Intensität.3 Ein Ergebnis die-
ser neuen Dynamik ist die Aufarbeitung der personellen Struktur der Reichs-
1 Für eine kritische Lektüre dieses nur unwesentlich überarbeiteten Vortrages bin ich Herrn
Schneidmüller, Heidelberg, dankbar.
2 Konrad von Megenberg, Ökonomik, hg. von Sabine Krüger (MGH Staatsschriften 3: Die Wer-
ke des Konrad von Megenberg 5), 3 Bde., Stuttgart 1973-1984, hier Bd. 2, c. 12, S. 199: Est ergo
sciendum, quod Cesaris augusti duplex est curia, videlicet minor et maior. Curia minor est domus
Cesaris ex minoribus constans ministris, quales sunt minores milites et vasalli, qui cottidiani sunt cu-
rienses atque domestici eius. Curia vero maior est communicacio personalis augusti cum magnatibus et
principibus electoribusque sacri imperii Romani. Der von Konrad benutzte Begriff der communica-
tio, der neben Gemeinschaft auch Anteilgabe bedeuten kann, unterstreicht die Anteilhabe der
Großen an der Herrschaft des Reiches. Zu dieser Stelle vgl. z. B. Gabriele Annas, Hoftag - Ge-
meiner Tag - Reichstag. Studien zur strukturellen Entwicklung deutscher Reichsversammlun-
gen des späten Mittelalters (1349-1471) (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 68), 2 Bde., Göttingen 2004, hier Bd. 1, S. 102-106;
Gisela Drossbach, Die »Yconomica« des Konrad von Megenberg. Das »Haus« als Norm
für politische und soziale Strukturen (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in
Mittelalter und Früher Neuzeit 6), Köln 1997, S. 44 f.; zur begrifflichen Problematik generell
und der Schwierigkeit, die curia maior in der Praxis von der curia minor zu scheiden, siehe z. B.
die Bemerkungen von Peter Moraw, Versuch über die Entstehung des Reichstags, in: Über
König und Reich. Aufsätze zur deutschen Verfassungsgeschichte des späten Mittelalters, hg.
von Rainer C. Schwinges, Sigmaringen 1995, S. 207-242, hier S. 211-217; Annas, Hoftag (wie
oben), Bd. 1, S. 73-157.
3 Deutscher Königshof, Hoftag und Reichstag im späteren Mittelalter, hg. von Peter Moraw
(Vorträge und Forschungen 48), Stuttgart 2002; sowie die Sammlung seiner Aufsätze in: Über
König und Reich, hg. von Schwinges (wie Anm. 2); Ernst Schubert, König und Reich. Studi-
en zur spätmittelalterlichen deutschen Verfassungsgeschichte (Veröffentlichungen des Max-