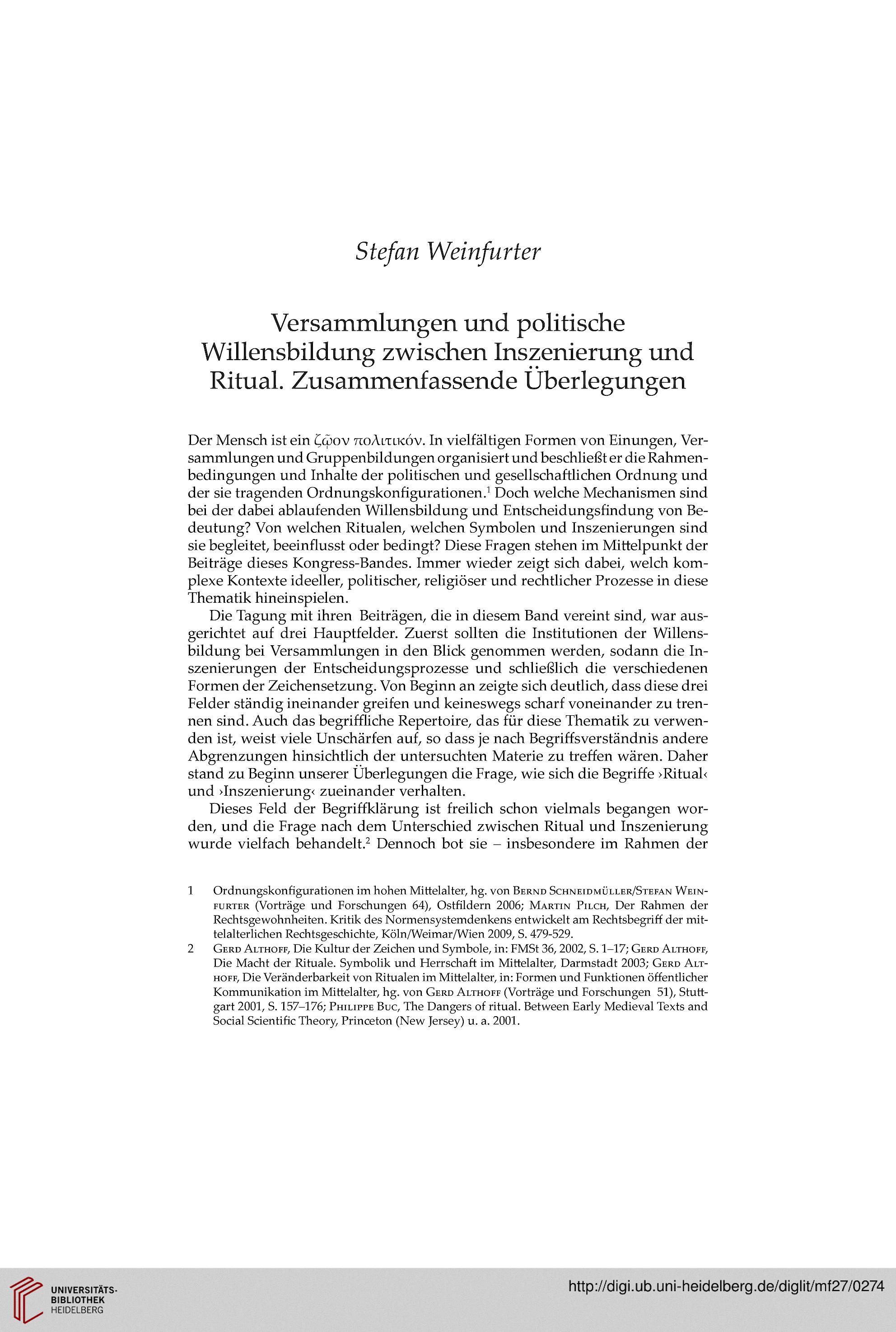Stefan Weinfurter
Versammlungen und politische
Willensbildung zwischen Inszenierung und
Ritual. Zusammenfassende Überlegungen
Der Mensch ist ein Ccoov tioAltlköv. In vielfältigen Formen von Einungen, Ver-
sammlungen und Gruppenbildungen organisiert und beschließt er die Rahmen-
bedingungen und Inhalte der politischen und gesellschaftlichen Ordnung und
der sie tragenden Ordnungskonfigurationen.1 Doch welche Mechanismen sind
bei der dabei ablaufenden Willensbildung und Entscheidungsfindung von Be-
deutung? Von welchen Ritualen, welchen Symbolen und Inszenierungen sind
sie begleitet, beeinflusst oder bedingt? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der
Beiträge dieses Kongress-Bandes. Immer wieder zeigt sich dabei, welch kom-
plexe Kontexte ideeller, politischer, religiöser und rechtlicher Prozesse in diese
Thematik hineinspielen.
Die Tagung mit ihren Beiträgen, die in diesem Band vereint sind, war aus-
gerichtet auf drei Hauptfelder. Zuerst sollten die Institutionen der Willens-
bildung bei Versammlungen in den Blick genommen werden, sodann die In-
szenierungen der Entscheidungsprozesse und schließlich die verschiedenen
Formen der Zeichensetzung. Von Beginn an zeigte sich deutlich, dass diese drei
Felder ständig ineinander greifen und keineswegs scharf voneinander zu tren-
nen sind. Auch das begriffliche Repertoire, das für diese Thematik zu verwen-
den ist, weist viele Unschärfen auf, so dass je nach Begriffsverständnis andere
Abgrenzungen hinsichtlich der untersuchten Materie zu treffen wären. Daher
stand zu Beginn unserer Überlegungen die Frage, wie sich die Begriffe >Ritual<
und >Inszenierung< zueinander verhalten.
Dieses Feld der Begriffklärung ist freilich schon vielmals begangen wor-
den, und die Frage nach dem Unterschied zwischen Ritual und Inszenierung
wurde vielfach behandelt.2 Dennoch bot sie - insbesondere im Rahmen der
1 Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, hg. von Bernd Schneidmüller/Stefan Wein-
furter (Vorträge und Forschungen 64), Ostfildern 2006; Martin Pilch, Der Rahmen der
Rechtsgewohnheiten. Kritik des Normensystemdenkens entwickelt am Rechtsbegrifi der mit-
telalterlichen Rechtsgeschichte, Köln/Weimar/Wien 2009, S. 479-529.
2 Gerd Althoff, Die Kultur der Zeichen und Symbole, in: FMSt 36, 2002, S. 1-17; Gerd Althoff,
Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003; Gerd Alt-
hoff, Die Veränderbarkeit von Ritualen im Mittelalter, in: Formen und Funktionen öffentlicher
Kommunikation im Mittelalter, hg. von Gerd Althoff (Vorträge und Forschungen 51), Stutt-
gart 2001, S. 157-176; Philippe Buc, The Dangers of ritual. Between Early Medieval Texts and
Social Scientific Theory, Princeton (New Jersey) u. a. 2001.
Versammlungen und politische
Willensbildung zwischen Inszenierung und
Ritual. Zusammenfassende Überlegungen
Der Mensch ist ein Ccoov tioAltlköv. In vielfältigen Formen von Einungen, Ver-
sammlungen und Gruppenbildungen organisiert und beschließt er die Rahmen-
bedingungen und Inhalte der politischen und gesellschaftlichen Ordnung und
der sie tragenden Ordnungskonfigurationen.1 Doch welche Mechanismen sind
bei der dabei ablaufenden Willensbildung und Entscheidungsfindung von Be-
deutung? Von welchen Ritualen, welchen Symbolen und Inszenierungen sind
sie begleitet, beeinflusst oder bedingt? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der
Beiträge dieses Kongress-Bandes. Immer wieder zeigt sich dabei, welch kom-
plexe Kontexte ideeller, politischer, religiöser und rechtlicher Prozesse in diese
Thematik hineinspielen.
Die Tagung mit ihren Beiträgen, die in diesem Band vereint sind, war aus-
gerichtet auf drei Hauptfelder. Zuerst sollten die Institutionen der Willens-
bildung bei Versammlungen in den Blick genommen werden, sodann die In-
szenierungen der Entscheidungsprozesse und schließlich die verschiedenen
Formen der Zeichensetzung. Von Beginn an zeigte sich deutlich, dass diese drei
Felder ständig ineinander greifen und keineswegs scharf voneinander zu tren-
nen sind. Auch das begriffliche Repertoire, das für diese Thematik zu verwen-
den ist, weist viele Unschärfen auf, so dass je nach Begriffsverständnis andere
Abgrenzungen hinsichtlich der untersuchten Materie zu treffen wären. Daher
stand zu Beginn unserer Überlegungen die Frage, wie sich die Begriffe >Ritual<
und >Inszenierung< zueinander verhalten.
Dieses Feld der Begriffklärung ist freilich schon vielmals begangen wor-
den, und die Frage nach dem Unterschied zwischen Ritual und Inszenierung
wurde vielfach behandelt.2 Dennoch bot sie - insbesondere im Rahmen der
1 Ordnungskonfigurationen im hohen Mittelalter, hg. von Bernd Schneidmüller/Stefan Wein-
furter (Vorträge und Forschungen 64), Ostfildern 2006; Martin Pilch, Der Rahmen der
Rechtsgewohnheiten. Kritik des Normensystemdenkens entwickelt am Rechtsbegrifi der mit-
telalterlichen Rechtsgeschichte, Köln/Weimar/Wien 2009, S. 479-529.
2 Gerd Althoff, Die Kultur der Zeichen und Symbole, in: FMSt 36, 2002, S. 1-17; Gerd Althoff,
Die Macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft im Mittelalter, Darmstadt 2003; Gerd Alt-
hoff, Die Veränderbarkeit von Ritualen im Mittelalter, in: Formen und Funktionen öffentlicher
Kommunikation im Mittelalter, hg. von Gerd Althoff (Vorträge und Forschungen 51), Stutt-
gart 2001, S. 157-176; Philippe Buc, The Dangers of ritual. Between Early Medieval Texts and
Social Scientific Theory, Princeton (New Jersey) u. a. 2001.