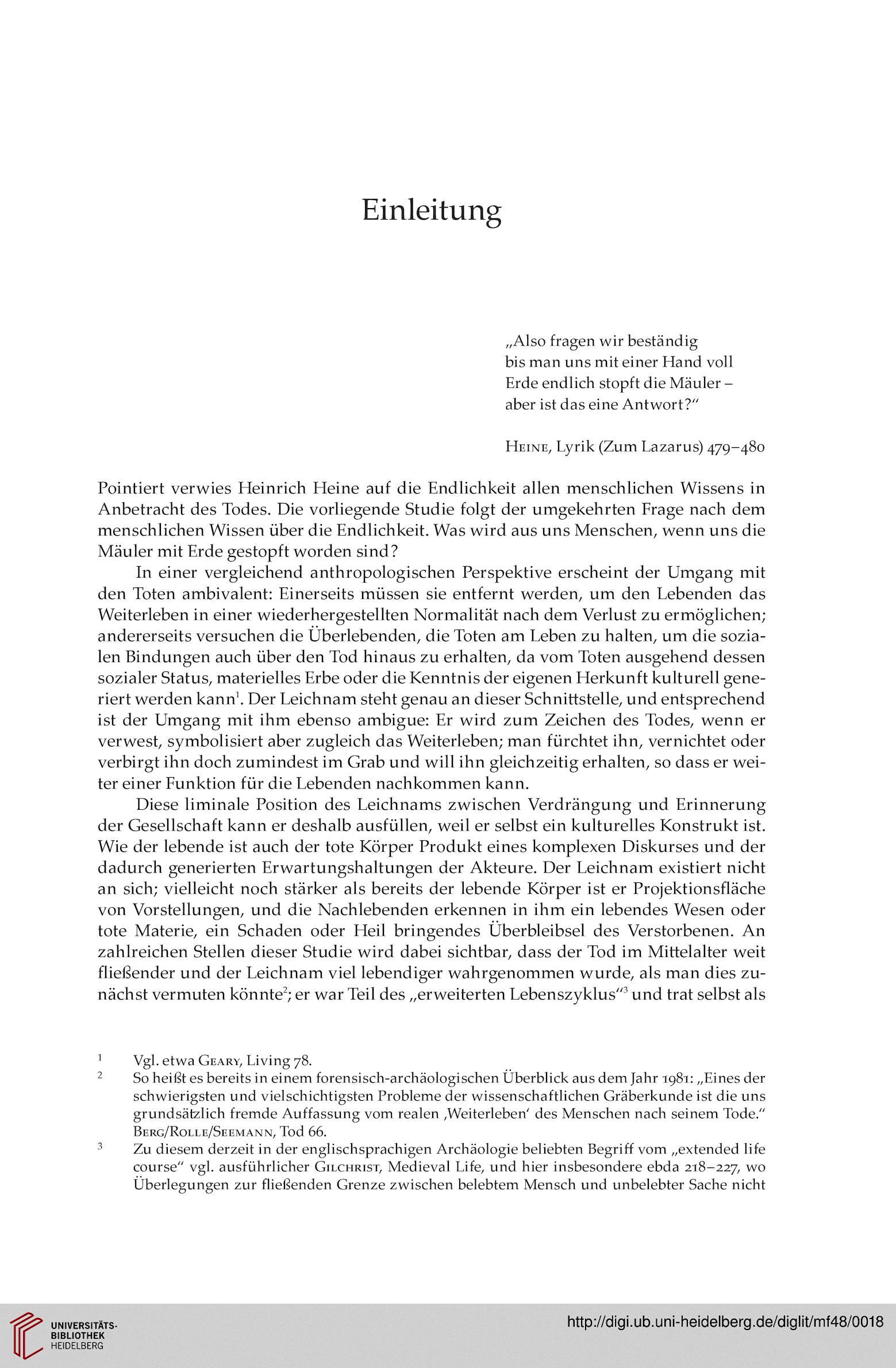Einleitung
„Also fragen wir beständig
bis man uns mit einer Hand voll
Erde endlich stopft die Mäuler -
aber ist das eine Antwort?"
Heine, Lyrik (Zum Lazarus) 479-480
Pointiert verwies Heinrich Heine auf die Endlichkeit allen menschlichen Wissens in
Anbetracht des Todes. Die vorliegende Studie folgt der umgekehrten Frage nach dem
menschlichen Wissen über die Endlichkeit. Was wird aus uns Menschen, wenn uns die
Mäuler mit Erde gestopft worden sind?
In einer vergleichend anthropologischen Perspektive erscheint der Umgang mit
den Toten ambivalent: Einerseits müssen sie entfernt werden, um den Lebenden das
Weiterleben in einer wiederhergestellten Normalität nach dem Verlust zu ermöglichen;
andererseits versuchen die Überlebenden, die Toten am Leben zu halten, um die sozia-
len Bindungen auch über den Tod hinaus zu erhalten, da vom Toten ausgehend dessen
sozialer Status, materielles Erbe oder die Kenntnis der eigenen Herkunft kulturell gene-
riert werden kann1. Der Leichnam steht genau an dieser Schnittstelle, und entsprechend
ist der Umgang mit ihm ebenso ambigue: Er wird zum Zeichen des Todes, wenn er
verwest, symbolisiert aber zugleich das Weiterleben; man fürchtet ihn, vernichtet oder
verbirgt ihn doch zumindest im Grab und will ihn gleichzeitig erhalten, so dass er wei-
ter einer Funktion für die Lebenden nachkommen kann.
Diese liminale Position des Leichnams zwischen Verdrängung und Erinnerung
der Gesellschaft kann er deshalb ausfüllen, weil er selbst ein kulturelles Konstrukt ist.
Wie der lebende ist auch der tote Körper Produkt eines komplexen Diskurses und der
dadurch generierten Erwartungshaltungen der Akteure. Der Leichnam existiert nicht
an sich; vielleicht noch stärker als bereits der lebende Körper ist er Projektionsfläche
von Vorstellungen, und die Nachlebenden erkennen in ihm ein lebendes Wesen oder
tote Materie, ein Schaden oder Heil bringendes Überbleibsel des Verstorbenen. An
zahlreichen Stellen dieser Studie wird dabei sichtbar, dass der Tod im Mittelalter weit
fließender und der Leichnam viel lebendiger wahrgenommen wurde, als man dies zu-
nächst vermuten könnte2; er war Teil des „erweiterten Lebenszyklus"3 und trat selbst als
1 Vgl. etwa Geary, Living 78.
2 So heißt es bereits in einem forensisch-archäologischen Überblick aus dem Jahr 1981: „Eines der
schwierigsten und vielschichtigsten Probleme der wissenschaftlichen Gräberkunde ist die uns
grundsätzlich fremde Auffassung vom realen ,Weiterleben' des Menschen nach seinem Tode."
Berg/Rolle/Seemann, Tod 66.
3 Zu diesem derzeit in der englischsprachigen Archäologie beliebten Begriff vom „extended life
course" vgl. ausführlicher Gilchrist, Medieval Life, und hier insbesondere ebda 218-227, wo
Überlegungen zur fließenden Grenze zwischen belebtem Mensch und unbelebter Sache nicht
„Also fragen wir beständig
bis man uns mit einer Hand voll
Erde endlich stopft die Mäuler -
aber ist das eine Antwort?"
Heine, Lyrik (Zum Lazarus) 479-480
Pointiert verwies Heinrich Heine auf die Endlichkeit allen menschlichen Wissens in
Anbetracht des Todes. Die vorliegende Studie folgt der umgekehrten Frage nach dem
menschlichen Wissen über die Endlichkeit. Was wird aus uns Menschen, wenn uns die
Mäuler mit Erde gestopft worden sind?
In einer vergleichend anthropologischen Perspektive erscheint der Umgang mit
den Toten ambivalent: Einerseits müssen sie entfernt werden, um den Lebenden das
Weiterleben in einer wiederhergestellten Normalität nach dem Verlust zu ermöglichen;
andererseits versuchen die Überlebenden, die Toten am Leben zu halten, um die sozia-
len Bindungen auch über den Tod hinaus zu erhalten, da vom Toten ausgehend dessen
sozialer Status, materielles Erbe oder die Kenntnis der eigenen Herkunft kulturell gene-
riert werden kann1. Der Leichnam steht genau an dieser Schnittstelle, und entsprechend
ist der Umgang mit ihm ebenso ambigue: Er wird zum Zeichen des Todes, wenn er
verwest, symbolisiert aber zugleich das Weiterleben; man fürchtet ihn, vernichtet oder
verbirgt ihn doch zumindest im Grab und will ihn gleichzeitig erhalten, so dass er wei-
ter einer Funktion für die Lebenden nachkommen kann.
Diese liminale Position des Leichnams zwischen Verdrängung und Erinnerung
der Gesellschaft kann er deshalb ausfüllen, weil er selbst ein kulturelles Konstrukt ist.
Wie der lebende ist auch der tote Körper Produkt eines komplexen Diskurses und der
dadurch generierten Erwartungshaltungen der Akteure. Der Leichnam existiert nicht
an sich; vielleicht noch stärker als bereits der lebende Körper ist er Projektionsfläche
von Vorstellungen, und die Nachlebenden erkennen in ihm ein lebendes Wesen oder
tote Materie, ein Schaden oder Heil bringendes Überbleibsel des Verstorbenen. An
zahlreichen Stellen dieser Studie wird dabei sichtbar, dass der Tod im Mittelalter weit
fließender und der Leichnam viel lebendiger wahrgenommen wurde, als man dies zu-
nächst vermuten könnte2; er war Teil des „erweiterten Lebenszyklus"3 und trat selbst als
1 Vgl. etwa Geary, Living 78.
2 So heißt es bereits in einem forensisch-archäologischen Überblick aus dem Jahr 1981: „Eines der
schwierigsten und vielschichtigsten Probleme der wissenschaftlichen Gräberkunde ist die uns
grundsätzlich fremde Auffassung vom realen ,Weiterleben' des Menschen nach seinem Tode."
Berg/Rolle/Seemann, Tod 66.
3 Zu diesem derzeit in der englischsprachigen Archäologie beliebten Begriff vom „extended life
course" vgl. ausführlicher Gilchrist, Medieval Life, und hier insbesondere ebda 218-227, wo
Überlegungen zur fließenden Grenze zwischen belebtem Mensch und unbelebter Sache nicht