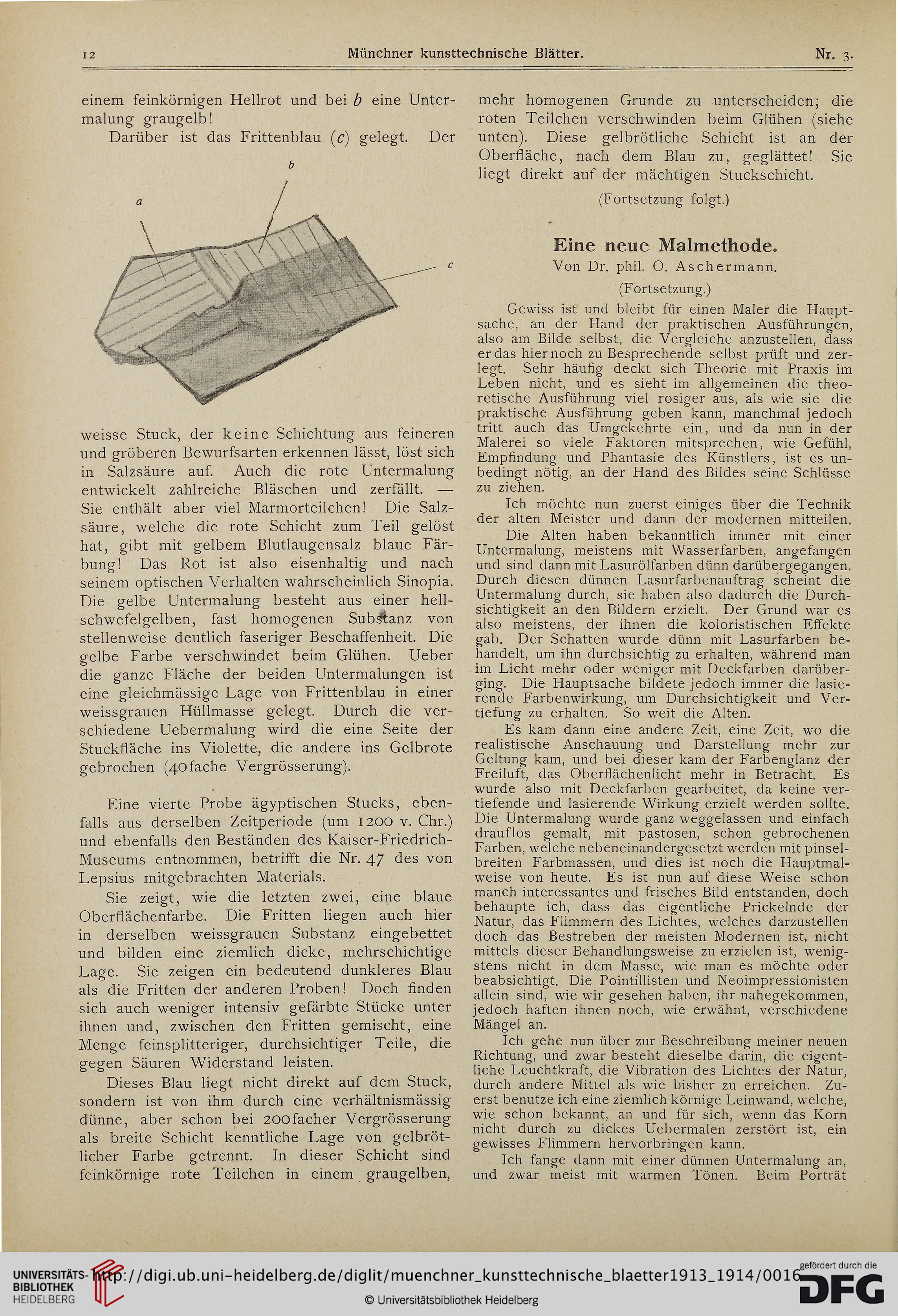12
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. 3.
einem feinkörnigen HeHrot und bei ^ eine Unter-
maiung graugeib!
Darüber ist das Frittenbiau (c) gelegt. Der
&
weisse Stuck, der keine Schichtung aus feineren
und gröberen Bewurfsarten erkennen lässt, löst sich
in Saizsäure auf. Auch die rote Untermalung
entwickelt zahlreiche Bläschen und zerfällt. —
Sie enthält aber viel Marmorteilchen! Die Salz-
säure, welche die rote Schicht zum Teil gelöst
hat, gibt mit gelbem Blutlaugensalz blaue Fär-
bung! Das Rot ist also eisenhaltig und nach
seinem optischen Verhalten wahrscheinlich Sinopia.
Die gelbe Untermalung besteht aus einer hell-
schwefelgelben, fast homogenen Substanz von
stellenweise deutlich faseriger Beschaffenheit. Die
gelbe Farbe verschwindet beim Glühen. Ueber
die ganze Fläche der beiden Untermalungen ist
eine gleichmässige Lage von Frittenblau in einer
weissgrauen Uüllmasse gelegt. Durch die ver-
schiedene Uebermalung wird die eine Seite der
Stuckfläche ins Violette, die andere ins Gelbrote
gebrochen (40 fache Vergrösserung).
Eine vierte Probe ägyptischen Stucks, eben-
falls aus derselben Zeitperiode (um 1200 v. Chr.)
und ebenfalls den Beständen des Kaiser-Friedrich-
Museums entnommen, betrifft die Nr. 47 des von
Lepsius mitgebrachten Materials.
Sie zeigt, wie die letzten zwei, eine blaue
Oberflächenfarbe. Die Fritten liegen auch hier
in derselben weissgrauen Substanz eingebettet
und bilden eine ziemlich dicke, mehrschichtige
Lage. Sie zeigen ein bedeutend dunkleres Blau
als die Fritten der anderen Proben! Doch finden
sich auch weniger intensiv gefärbte Stücke unter
ihnen und, zwischen den Fritten gemischt, eine
Menge feinsplitteriger, durchsichtiger Teile, die
gegen Säuren Widerstand leisten.
Dieses Blau liegt nicht direkt auf dem Stuck,
sondern ist von ihm durch eine verhältnismässig
dünne, aber schon bei 200facher Vergrösserung
als breite Schicht kenntliche Lage von gelbröt-
licher Farbe getrennt. In dieser Schicht sind
feinkörnige rote Teilchen in einem graugelben,
mehr homogenen Grunde zu unterscheiden; die
roten Teilchen verschwinden beim Glühen (siehe
unten). Diese gelbrötliche Schicht ist an der
Oberfläche, nach dem Blau zu, geglättet! Sie
liegt direkt auf der mächtigen Stuckschicht.
(Fortsetzung folgt.)
Eine neue Malmethode.
Von Dr. phil. O. Aschermann.
(Fortsetzung.)
Gewiss ist und bleibt für einen Maler die Haupt-
sache, an der Hand der praktischen Ausführungen,
also am Bilde selbst, die Vergleiche anzustellen, dass
er das hier noch zu Besprechende selbst prüft und zer-
legt. Sehr häufig deckt sich Theorie mit Praxis im
Leben nicht, und es sieht im allgemeinen die theo-
retische Ausführung viel rosiger aus, als wie sie die
praktische Ausführung geben kann, manchmal jedoch
tritt auch das Umgekehrte ein, und da nun in der
Malerei so viele Faktoren mitsprechen, wie Gefühl,
Empfindung und Phantasie des Künstlers, ist es un-
bedingt nötig, an der Hand des Bildes seine Schlüsse
zu ziehen.
Ich möchte nun zuerst einiges über die Technik
der alten Meister und dann der modernen mitteilen.
Die Alten haben bekanntlich immer mit einer
Untermalung, meistens mit Wasserfarben, angefangen
und sind dann mit Lasurölfarben dünn darübergegangen.
Durch diesen dünnen Lasurfarbenauftrag scheint die
Untermalung durch, sie haben also dadurch die Durch-
sichtigkeit an den Bildern erzielt. Der Grund war es
also meistens, der ihnen die koloristischen Effekte
gab. Der Schatten wurde dünn mit Lasurfarben be-
handelt, um ihn durchsichtig zu erhalten, während man
im Licht mehr oder weniger mit Deckfarben darüber-
ging. Die Hauptsache bildete jedoch immer die lasie-
rende Farbenwirkung, um Durchsichtigkeit und Ver-
tiefung zu erhalten. So weit die Alten.
Es kam dann eine andere Zeit, eine Zeit, wo die
realistische Anschauung und Darstellung mehr zur
Geltung kam, und bei dieser kam der Farbenglanz der
Freiluft, das Oberflächenlicht mehr in Betracht. Es
wurde also mit Deckfarben gearbeitet, da keine ver-
tiefende und lasierende Wirkung erzielt werden sollte.
Die Untermalung wurde ganz weggelassen und einfach
drauflos gemalt, mit pastosen, schon gebrochenen
Farben, weiche nebeneinandergesetzt werden mit pinsel-
breiten Farbmassen, und dies ist noch die Hauptmal-
weise von heute. Es ist nun auf diese Weise schon
manch interessantes und frisches Bild entstanden, doch
behaupte ich, dass das eigentliche Prickelnde der
Natur, das Flimmern des Lichtes, welches darzustellen
doch das Bestreben der meisten Modernen ist, nicht
mittels dieser Behandlungsweise zu erzielen ist, wenig-
stens nicht in dem Masse, wie man es möchte oder
beabsichtigt. Die Pointillisten und Neoimpressionisten
allein sind, wie wir gesehen haben, ihr nahegekommen,
jedoch haften ihnen noch, wie erwähnt, verschiedene
Mängel an.
Ich gehe nun über zur Beschreibung meiner neuen
Richtung, und zwar besteht dieselbe darin, die eigent-
liche Leuchtkraft, die Vibration des Lichtes der Natur,
durch andere MitLel als wie bisher zu erreichen. Zu-
erst benutze ich eine ziemlich körnige Leinwand, welche,
wie schon bekannt, an und für sich, wenn das Korn
nicht durch zu dickes Uebermalen zerstört ist, ein
gewisses Flimmern hervorbringen kann.
Ich fange dann mit einer dünnen Untermalung an,
und zwar meist mit warmen Tönen. Beim Porträt
Münchner kunsttechnische Blätter.
Nr. 3.
einem feinkörnigen HeHrot und bei ^ eine Unter-
maiung graugeib!
Darüber ist das Frittenbiau (c) gelegt. Der
&
weisse Stuck, der keine Schichtung aus feineren
und gröberen Bewurfsarten erkennen lässt, löst sich
in Saizsäure auf. Auch die rote Untermalung
entwickelt zahlreiche Bläschen und zerfällt. —
Sie enthält aber viel Marmorteilchen! Die Salz-
säure, welche die rote Schicht zum Teil gelöst
hat, gibt mit gelbem Blutlaugensalz blaue Fär-
bung! Das Rot ist also eisenhaltig und nach
seinem optischen Verhalten wahrscheinlich Sinopia.
Die gelbe Untermalung besteht aus einer hell-
schwefelgelben, fast homogenen Substanz von
stellenweise deutlich faseriger Beschaffenheit. Die
gelbe Farbe verschwindet beim Glühen. Ueber
die ganze Fläche der beiden Untermalungen ist
eine gleichmässige Lage von Frittenblau in einer
weissgrauen Uüllmasse gelegt. Durch die ver-
schiedene Uebermalung wird die eine Seite der
Stuckfläche ins Violette, die andere ins Gelbrote
gebrochen (40 fache Vergrösserung).
Eine vierte Probe ägyptischen Stucks, eben-
falls aus derselben Zeitperiode (um 1200 v. Chr.)
und ebenfalls den Beständen des Kaiser-Friedrich-
Museums entnommen, betrifft die Nr. 47 des von
Lepsius mitgebrachten Materials.
Sie zeigt, wie die letzten zwei, eine blaue
Oberflächenfarbe. Die Fritten liegen auch hier
in derselben weissgrauen Substanz eingebettet
und bilden eine ziemlich dicke, mehrschichtige
Lage. Sie zeigen ein bedeutend dunkleres Blau
als die Fritten der anderen Proben! Doch finden
sich auch weniger intensiv gefärbte Stücke unter
ihnen und, zwischen den Fritten gemischt, eine
Menge feinsplitteriger, durchsichtiger Teile, die
gegen Säuren Widerstand leisten.
Dieses Blau liegt nicht direkt auf dem Stuck,
sondern ist von ihm durch eine verhältnismässig
dünne, aber schon bei 200facher Vergrösserung
als breite Schicht kenntliche Lage von gelbröt-
licher Farbe getrennt. In dieser Schicht sind
feinkörnige rote Teilchen in einem graugelben,
mehr homogenen Grunde zu unterscheiden; die
roten Teilchen verschwinden beim Glühen (siehe
unten). Diese gelbrötliche Schicht ist an der
Oberfläche, nach dem Blau zu, geglättet! Sie
liegt direkt auf der mächtigen Stuckschicht.
(Fortsetzung folgt.)
Eine neue Malmethode.
Von Dr. phil. O. Aschermann.
(Fortsetzung.)
Gewiss ist und bleibt für einen Maler die Haupt-
sache, an der Hand der praktischen Ausführungen,
also am Bilde selbst, die Vergleiche anzustellen, dass
er das hier noch zu Besprechende selbst prüft und zer-
legt. Sehr häufig deckt sich Theorie mit Praxis im
Leben nicht, und es sieht im allgemeinen die theo-
retische Ausführung viel rosiger aus, als wie sie die
praktische Ausführung geben kann, manchmal jedoch
tritt auch das Umgekehrte ein, und da nun in der
Malerei so viele Faktoren mitsprechen, wie Gefühl,
Empfindung und Phantasie des Künstlers, ist es un-
bedingt nötig, an der Hand des Bildes seine Schlüsse
zu ziehen.
Ich möchte nun zuerst einiges über die Technik
der alten Meister und dann der modernen mitteilen.
Die Alten haben bekanntlich immer mit einer
Untermalung, meistens mit Wasserfarben, angefangen
und sind dann mit Lasurölfarben dünn darübergegangen.
Durch diesen dünnen Lasurfarbenauftrag scheint die
Untermalung durch, sie haben also dadurch die Durch-
sichtigkeit an den Bildern erzielt. Der Grund war es
also meistens, der ihnen die koloristischen Effekte
gab. Der Schatten wurde dünn mit Lasurfarben be-
handelt, um ihn durchsichtig zu erhalten, während man
im Licht mehr oder weniger mit Deckfarben darüber-
ging. Die Hauptsache bildete jedoch immer die lasie-
rende Farbenwirkung, um Durchsichtigkeit und Ver-
tiefung zu erhalten. So weit die Alten.
Es kam dann eine andere Zeit, eine Zeit, wo die
realistische Anschauung und Darstellung mehr zur
Geltung kam, und bei dieser kam der Farbenglanz der
Freiluft, das Oberflächenlicht mehr in Betracht. Es
wurde also mit Deckfarben gearbeitet, da keine ver-
tiefende und lasierende Wirkung erzielt werden sollte.
Die Untermalung wurde ganz weggelassen und einfach
drauflos gemalt, mit pastosen, schon gebrochenen
Farben, weiche nebeneinandergesetzt werden mit pinsel-
breiten Farbmassen, und dies ist noch die Hauptmal-
weise von heute. Es ist nun auf diese Weise schon
manch interessantes und frisches Bild entstanden, doch
behaupte ich, dass das eigentliche Prickelnde der
Natur, das Flimmern des Lichtes, welches darzustellen
doch das Bestreben der meisten Modernen ist, nicht
mittels dieser Behandlungsweise zu erzielen ist, wenig-
stens nicht in dem Masse, wie man es möchte oder
beabsichtigt. Die Pointillisten und Neoimpressionisten
allein sind, wie wir gesehen haben, ihr nahegekommen,
jedoch haften ihnen noch, wie erwähnt, verschiedene
Mängel an.
Ich gehe nun über zur Beschreibung meiner neuen
Richtung, und zwar besteht dieselbe darin, die eigent-
liche Leuchtkraft, die Vibration des Lichtes der Natur,
durch andere MitLel als wie bisher zu erreichen. Zu-
erst benutze ich eine ziemlich körnige Leinwand, welche,
wie schon bekannt, an und für sich, wenn das Korn
nicht durch zu dickes Uebermalen zerstört ist, ein
gewisses Flimmern hervorbringen kann.
Ich fange dann mit einer dünnen Untermalung an,
und zwar meist mit warmen Tönen. Beim Porträt