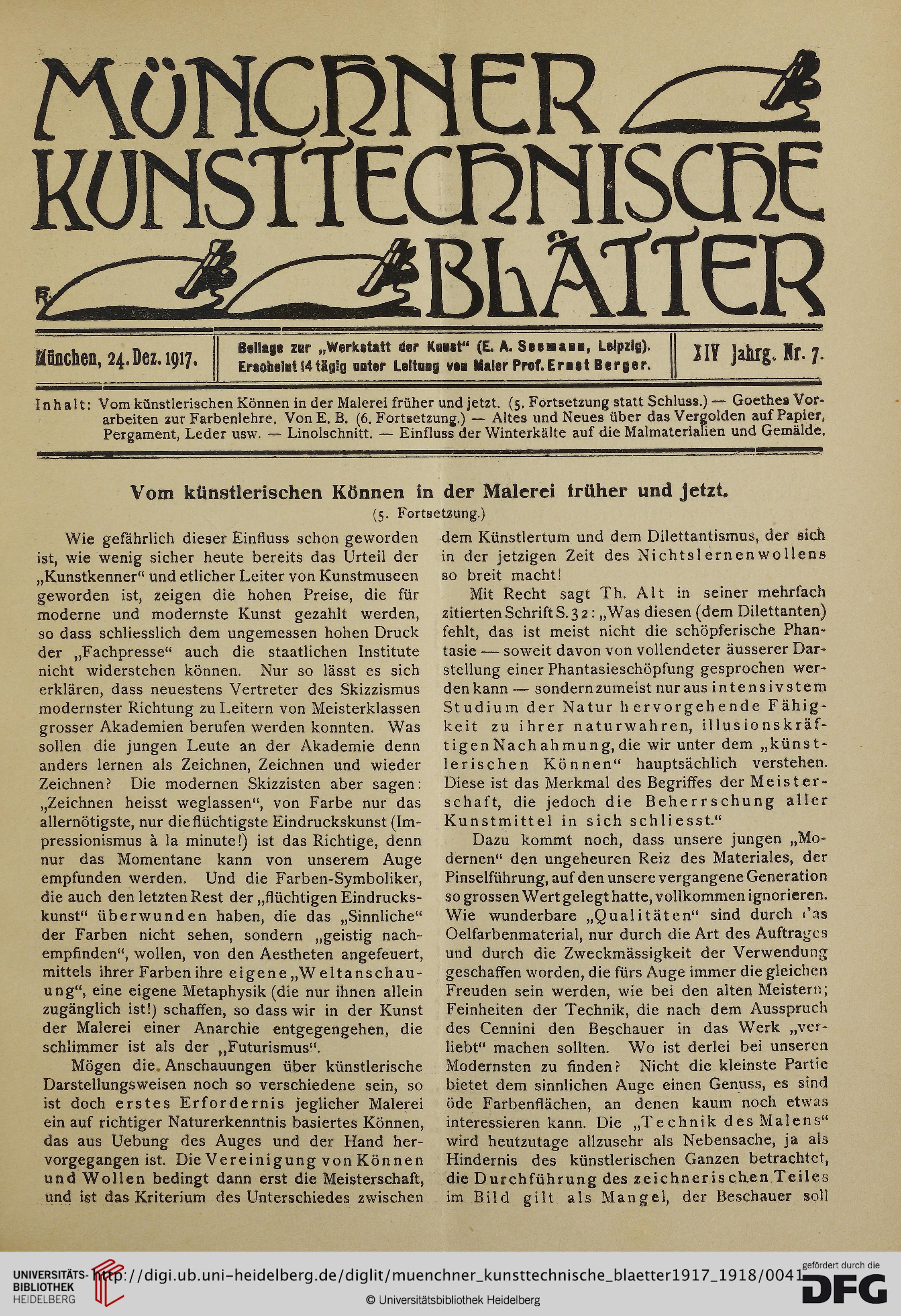Manchen, 24. Dez. 1917.
BeMtge zcr „Werkstatt dar Kant" (E.A.8aaa*aa, Leipzig).
Eraohe!at!4tägig anter Leitaag vaa MaiarPraf.EraatBarger.
HV jahfg. Nf. 7.
Inhalt: Vom künstlerischen Können in der Materei früher und jetzt. ($. Fortsetzung statt Schtuss.) — Goethes Vor*
arbeiten zurFarbentehre. VonE. B. (6. Fortsetzung.) — Attes und Neues über das Vergolden auf Papier,
Pergament, Leder usw. — Linolschnitt. — Einfluss der Winterkälte auf die Matmateriatien und Gemätde.
Vom künstlerischen Können in der Malerei lrüher und jetzt.
($. Fortsetzung.)
Wie gefährlich dieser Einfluss schon geworden
ist, wie wenig sicher heute bereits das Urteil der
„Kunstkenner" und etlicher Leiter von Kunstmuseen
geworden ist, zeigen die hohen Preise, die für
moderne und modernste Kunst gezahlt werden,
so dass schliesslich dem ungemessen hohen Druck
der „Fachpresse" auch die staatlichen Institute
nicht widerstehen können. Nur so lässt es sich
erklären, dass neuestens Vertreter des Skizzismus
modernster Richtung zu Leitern von Meisterklassen
grosser Akademien berufen werden konnten. Was
sollen die jungen Leute an der Akademie denn
anders lernen als Zeichnen, Zeichnen und wieder
Zeichnen? Die modernen Skizzisten aber sagen:
,,Zeichnen heisst weglassen", von Farbe nur das
allernötigste, nur die flüchtigste Eindruckskunst (Im-
pressionismus ä la minute!) ist das Richtige, denn
nur das Momentane kann von unserem Auge
empfunden werden. Und die Farben-Symboliker,
die auch den letzten Rest der „flüchtigen Eindrucks-
kunst" überwunden haben, die das „Sinnliche"
der Farben nicht sehen, sondern „geistig nach-
empfinden", wollen, von den Aestheten angefeuert,
mittels ihrer Farben ihre eigene „Weltanschau-
ung", eine eigene Metaphysik (die nur ihnen allein
zugänglich ist!) schaffen, so dass wir in der Kunst
der Malerei einer Anarchie entgegengehen, die
schlimmer ist als der „Futurismus".
Mögen die. Anschauungen über künstlerische
Darstellungsweisen noch so verschiedene sein, so
ist doch erstes Erfordernis jeglicher Malerei
ein auf richtiger Naturerkenntnis basiertes Können,
das aus Uebung des Auges und der Hand her-
vorgegangen ist. Die Vereinigung von Können
und Wollen bedingt dann erst die Meisterschaft,
und ist das Kriterium des Unterschiedes zwischen
dem Künstlertum und dem Dilettantismus, der sich
in der jetzigen Zeit des NichtslernenwoHens
so breit macht!
Mit Recht sagt Th. Alt in seiner mehrfach
zitierten Schrift S. 3 2: „Was diesen (dem Dilettanten)
fehlt, das ist meist nicht die schöpferische Phan-
tasie — soweit davon von vollendeter äusserer Dar-
stellung einer Phantasieschöpfung gesprochen wer-
denkann — sondern zumeist nur aus intensivstem
Studium der Natur hervorgehende Fähig-
keit zu ihrer naturwahren, illusionskräf-
tigenNachahmung, die wir unter dem „künst-
lerischen Können" hauptsächlich verstehen.
Diese ist das Merkmal des Begriffes der Meister-
schaft, die jedoch die Beherrschung aller
Kunstmittel in sich schliesst."
Dazu kommt noch, dass unsere jungen „Mo-
dernen" den ungeheuren Reiz des Materiales, der
Pinselführung, auf den unsere vergangene Generation
so grossen Wert gelegt hatte, vollkommen ignorieren.
Wie wunderbare „Qualitäten" sind durch <'as
Oelfarbenmaterial, nur durch die Art des Auftrages
und durch die Zweckmässigkeit der Verwendung
geschaffen worden, die fürs Auge immer die gleichen
Freuden sein werden, wie bei den alten Meistern;
Feinheiten der Technik, die nach dem Ausspruch
des Cennini den Beschauer in das Werk „ver-
liebt" machen sollten. Wo ist derlei bei unseren
Modernsten zu finden r Nicht die kleinste Partie
bietet dem sinnlichen Auge einen Genuss, es sind
öde Farbenflächen, an denen kaum noch etwas
interessieren kann. Die „Technik des Malens"
wird heutzutage allzusehr als Nebensache, ja als
Hindernis des künstlerischen Ganzen betrachtet,
die Durchführung des zeichnerischen Teiles
im Bild gilt als Mangel, der Beschauer soll