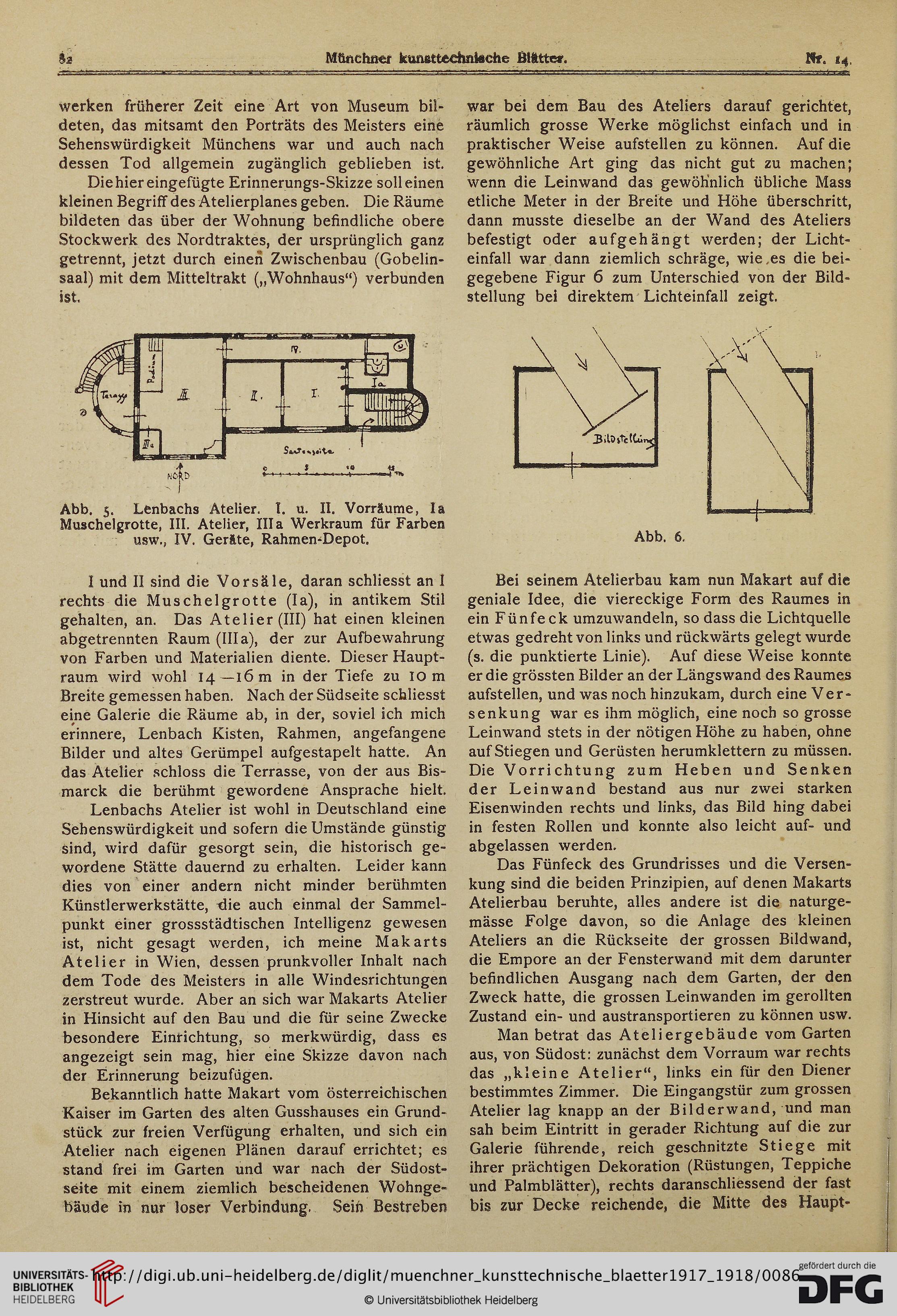Münchner kunEttechnische Blätter.
Nf. t4
Sa
werken früherer Zeit eine Art von Museum bil-
deten, das mitsamt den Porträts des Meisters eine
Sehenswürdigkeit Münchens war und auch nach
dessen Tod allgemein zugänglich geblieben ist.
Die hier eingefügte Erinnerungs-Skizze soll einen
kieinen Begriff des Ateiierpianes geben. Die Räume
bildeten das über der Wohnung befindliche obere
Stockwerk des Nordtraktes, der ursprünglich ganz
getrennt, jetzt durch einen Zwischenbau (Gobelin-
saa!) mit dem Mitteltrakt („Wohnhaus") verbunden
ist.
Abb. 3. Lenbachs Atelier. !. u. II. Vorräume, Ia
Muschelgrotte, III. Atelier, 111a Werkraum für Farben
usw., IV. Geräte, Rahmen-Depot.
I und II sind die Vorsäle, daran schliesst an I
rechts die Muschelgrotte (Ia), in antikem Stil
gehalten, an. Das Atelier (III) hat einen kleinen
abgetrennten Raum (HIa), der zur Aufbewahrung
von Farben und Materialien diente. Dieser Haupt-
raum wird wohl 14—16m in der Tiefe zu IOm
Breite gemessen haben. Nach der Südseite schliesst
eine Galerie die Räume ab, in der, soviel ich mich
erinnere, Lenbach Kisten, Rahmen, angefangene
Bilder und altes Gerümpel aufgestapelt hatte. An
das Atelier schloss die Terrasse, von der aus Bis-
marck die berühmt gewordene Ansprache hielt.
Lenbachs Atelier ist wohl in Deutschland eine
Sehenswürdigkeit und sofern die Umstände günstig
sind, wird dafür gesorgt sein, die historisch ge-
wordene Stätte dauernd zu erhalten. Leider kann
dies von einer andern nicht minder berühmten
Künstlerwerkstätte, die auch einmal der Sammel-
punkt einer grossstädtischen Intelligenz gewesen
ist, nicht gesagt werden, ich meine Makarts
Atelier in Wien, dessen prunkvoller Inhalt nach
dem Tode des Meisters in alle Windesrichtungen
zerstreut wurde. Aber an sich war Makarts Atelier
in Hinsicht auf den Bau und die für seine Zwecke
besondere Einrichtung, so merkwürdig, dass es
angezeigt sein mag, hier eine Skizze davon nach
der Erinnerung beizufügen.
Bekanntlich hatte Makart vom österreichischen
Kaiser im Garten des alten Gusshauses ein Grund-
stück zur freien Verfügung erhalten, und sich ein
Atelier nach eigenen Plänen darauf errichtet; es
stand frei im Garten und war nach der Südost-
seite mit einem ziemlich bescheidenen Wohnge-
bäude in nur loser Verbindung. Seih Bestreben
war bei dem Bau des Ateliers darauf gerichtet,
räumlich grosse Werke möglichst einfach und in
praktischer Weise aufstellen zu können. Auf die
gewöhnliche Art ging das nicht gut zu machen;
wenn die Leinwand das gewöhnlich übliche Mass
etliche Meter in der Breite und Höhe überschritt,
dann musste dieselbe an der Wand des Ateliers
befestigt oder aufgehängt werden; der Licht-
einfall war dann ziemlich schräge, wie es die bei-
gegebene Figur 6 zum Unterschied von der Bild-
stellung bei direktem Lichteinfal! zeigt.
Bei seinem Atelierbau kam nun Makart auf die
geniale Idee, die viereckige Form des Raumes in
ein Fünfeck umzuwandeln, so dass die Lichtquelle
etwas gedreht von links und rückwärts gelegt wurde
(s. die punktierte Linie). Auf diese Weise konnte
er die grössten Bilder an der Längswand des Raumes
aufstellen, und was noch hinzukam, durch eine Ver-
senkung war es ihm möglich, eine noch so grosse
Leinwand stets in der nötigen Höhe zu haben, ohne
auf Stiegen und Gerüsten herumklettern zu müssen.
Die Vorrichtung zum Heben und Senken
der Leinwand bestand aus nur zwei starken
Eisenwinden rechts und links, das Bild hing dabei
in festen Rollen und konnte also leicht auf- und
abgelassen werden.
Das Fünfeck des Grundrisses und die Versen-
kung sind die beiden Prinzipien, auf denen Makarts
Atelierbau beruhte, alles andere ist die naturge-
mässe Folge davon, so die Anlage des kleinen
Ateliers an die Rückseite der grossen Bildwand,
die Empore an der Fensterwand mit dem darunter
befindlichen Ausgang nach dem Garten, der den
Zweck hatte, die grossen Leinwänden im gerollten
Zustand ein- und austransportieren zu können usw.
Man betrat das Ateliergebäude vom Garten
aus, von Südost: zunächst dem Vorraum war rechts
das „kleine Atelier", links ein für den Diener
bestimmtes Zimmer. Die Eingangstür zum grossen
Atelier lag knapp an der Bilderwand, und man
sah beim Eintritt in gerader Richtung auf die zur
Galerie führende, reich geschnitzte Stiege mit
ihrer prächtigen Dekoration (Rüstungen, Teppiche
und Palmblätter), rechts daranschliessend der fast
bis zur Decke reichende, die Mitte des Haupt-
Nf. t4
Sa
werken früherer Zeit eine Art von Museum bil-
deten, das mitsamt den Porträts des Meisters eine
Sehenswürdigkeit Münchens war und auch nach
dessen Tod allgemein zugänglich geblieben ist.
Die hier eingefügte Erinnerungs-Skizze soll einen
kieinen Begriff des Ateiierpianes geben. Die Räume
bildeten das über der Wohnung befindliche obere
Stockwerk des Nordtraktes, der ursprünglich ganz
getrennt, jetzt durch einen Zwischenbau (Gobelin-
saa!) mit dem Mitteltrakt („Wohnhaus") verbunden
ist.
Abb. 3. Lenbachs Atelier. !. u. II. Vorräume, Ia
Muschelgrotte, III. Atelier, 111a Werkraum für Farben
usw., IV. Geräte, Rahmen-Depot.
I und II sind die Vorsäle, daran schliesst an I
rechts die Muschelgrotte (Ia), in antikem Stil
gehalten, an. Das Atelier (III) hat einen kleinen
abgetrennten Raum (HIa), der zur Aufbewahrung
von Farben und Materialien diente. Dieser Haupt-
raum wird wohl 14—16m in der Tiefe zu IOm
Breite gemessen haben. Nach der Südseite schliesst
eine Galerie die Räume ab, in der, soviel ich mich
erinnere, Lenbach Kisten, Rahmen, angefangene
Bilder und altes Gerümpel aufgestapelt hatte. An
das Atelier schloss die Terrasse, von der aus Bis-
marck die berühmt gewordene Ansprache hielt.
Lenbachs Atelier ist wohl in Deutschland eine
Sehenswürdigkeit und sofern die Umstände günstig
sind, wird dafür gesorgt sein, die historisch ge-
wordene Stätte dauernd zu erhalten. Leider kann
dies von einer andern nicht minder berühmten
Künstlerwerkstätte, die auch einmal der Sammel-
punkt einer grossstädtischen Intelligenz gewesen
ist, nicht gesagt werden, ich meine Makarts
Atelier in Wien, dessen prunkvoller Inhalt nach
dem Tode des Meisters in alle Windesrichtungen
zerstreut wurde. Aber an sich war Makarts Atelier
in Hinsicht auf den Bau und die für seine Zwecke
besondere Einrichtung, so merkwürdig, dass es
angezeigt sein mag, hier eine Skizze davon nach
der Erinnerung beizufügen.
Bekanntlich hatte Makart vom österreichischen
Kaiser im Garten des alten Gusshauses ein Grund-
stück zur freien Verfügung erhalten, und sich ein
Atelier nach eigenen Plänen darauf errichtet; es
stand frei im Garten und war nach der Südost-
seite mit einem ziemlich bescheidenen Wohnge-
bäude in nur loser Verbindung. Seih Bestreben
war bei dem Bau des Ateliers darauf gerichtet,
räumlich grosse Werke möglichst einfach und in
praktischer Weise aufstellen zu können. Auf die
gewöhnliche Art ging das nicht gut zu machen;
wenn die Leinwand das gewöhnlich übliche Mass
etliche Meter in der Breite und Höhe überschritt,
dann musste dieselbe an der Wand des Ateliers
befestigt oder aufgehängt werden; der Licht-
einfall war dann ziemlich schräge, wie es die bei-
gegebene Figur 6 zum Unterschied von der Bild-
stellung bei direktem Lichteinfal! zeigt.
Bei seinem Atelierbau kam nun Makart auf die
geniale Idee, die viereckige Form des Raumes in
ein Fünfeck umzuwandeln, so dass die Lichtquelle
etwas gedreht von links und rückwärts gelegt wurde
(s. die punktierte Linie). Auf diese Weise konnte
er die grössten Bilder an der Längswand des Raumes
aufstellen, und was noch hinzukam, durch eine Ver-
senkung war es ihm möglich, eine noch so grosse
Leinwand stets in der nötigen Höhe zu haben, ohne
auf Stiegen und Gerüsten herumklettern zu müssen.
Die Vorrichtung zum Heben und Senken
der Leinwand bestand aus nur zwei starken
Eisenwinden rechts und links, das Bild hing dabei
in festen Rollen und konnte also leicht auf- und
abgelassen werden.
Das Fünfeck des Grundrisses und die Versen-
kung sind die beiden Prinzipien, auf denen Makarts
Atelierbau beruhte, alles andere ist die naturge-
mässe Folge davon, so die Anlage des kleinen
Ateliers an die Rückseite der grossen Bildwand,
die Empore an der Fensterwand mit dem darunter
befindlichen Ausgang nach dem Garten, der den
Zweck hatte, die grossen Leinwänden im gerollten
Zustand ein- und austransportieren zu können usw.
Man betrat das Ateliergebäude vom Garten
aus, von Südost: zunächst dem Vorraum war rechts
das „kleine Atelier", links ein für den Diener
bestimmtes Zimmer. Die Eingangstür zum grossen
Atelier lag knapp an der Bilderwand, und man
sah beim Eintritt in gerader Richtung auf die zur
Galerie führende, reich geschnitzte Stiege mit
ihrer prächtigen Dekoration (Rüstungen, Teppiche
und Palmblätter), rechts daranschliessend der fast
bis zur Decke reichende, die Mitte des Haupt-