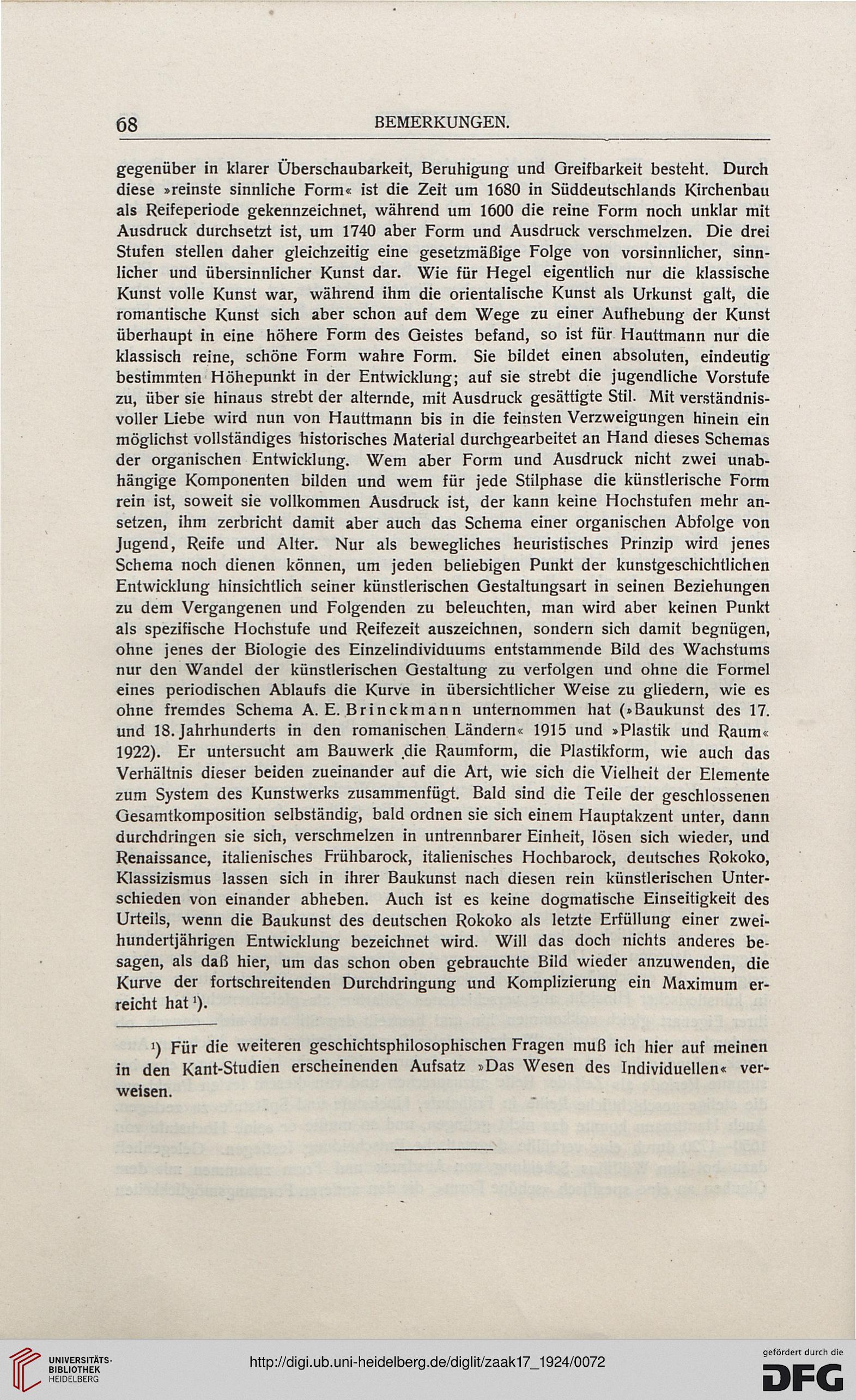68 BEMERKUNGEN.
gegenüber in klarer Überschaubarkeit, Beruhigung und Oreifbarkeit besteht. Durch
diese »reinste sinnliche Form« ist die Zeit um 1680 in Süddeutschlands Kirchenbau
als Reifeperiode gekennzeichnet, während um 1600 die reine Form noch unklar mit
Ausdruck durchsetzt ist, um 1740 aber Form und Ausdruck verschmelzen. Die drei
Stufen stellen daher gleichzeitig eine gesetzmäßige Folge von vorsinnlicher, sinn-
licher und übersinnlicher Kunst dar. Wie für Hegel eigentlich nur die klassische
Kunst volle Kunst war, während ihm die orientalische Kunst als Urkunst galt, die
romantische Kunst sich aber schon auf dem Wege zu einer Aufhebung der Kunst
überhaupt in eine höhere Form des Geistes befand, so ist für Hauttmann nur die
klassisch reine, schöne Form wahre Form. Sie bildet einen absoluten, eindeutig
bestimmten Höhepunkt in der Entwicklung; auf sie strebt die jugendliche Vorstufe
zu, über sie hinaus strebt der alternde, mit Ausdruck gesättigte Stil. Mit verständnis-
voller Liebe wird nun von Hauttmann bis in die feinsten Verzweigungen hinein ein
möglichst vollständiges historisches Material durchgearbeitet an Hand dieses Schemas
der organischen Entwicklung. Wem aber Form und Ausdruck nicht zwei unab-
hängige Komponenten bilden und wem für jede Stilphase die künstlerische Form
rein ist, soweit sie vollkommen Ausdruck ist, der kann keine Hochstufen mehr an-
setzen, ihm zerbricht damit aber auch das Schema einer organischen Abfolge von
Jugend, Reife und Alter. Nur als bewegliches heuristisches Prinzip wird jenes
Schema noch dienen können, um jeden beliebigen Punkt der kunstgeschichtlichen
Entwicklung hinsichtlich seiner künstlerischen Gestaltungsart in seinen Beziehungen
zu dem Vergangenen und Folgenden zu beleuchten, man wird aber keinen Punkt
als spezifische Hochstufe und Reifezeit auszeichnen, sondern sich damit begnügen,
ohne jenes der Biologie des Einzelindividuums entstammende Bild des Wachstums
nur den Wandel der künstlerischen Gestaltung zu verfolgen und ohne die Formel
eines periodischen Ablaufs die Kurve in übersichtlicher Weise zu gliedern, wie es
ohne fremdes Schema A. E. Brinckmann unternommen hat (»Baukunst des 17.
und 18. Jahrhunderts in den romanischen Ländern« 1915 und »Plastik und Raum«
1922). Er untersucht am Bauwerk die Raumform, die Plastikform, wie auch das
Verhältnis dieser beiden zueinander auf die Art, wie sich die Vielheit der Elemente
zum System des Kunstwerks zusammenfügt. Bald sind die Teile der geschlossenen
Gesamtkomposition selbständig, bald ordnen sie sich einem Hauptakzent unter, dann
durchdringen sie sich, verschmelzen in untrennbarer Einheit, lösen sich wieder, und
Renaissance, italienisches Frühbarock, italienisches Hochbarock, deutsches Rokoko,
Klassizismus lassen sich in ihrer Baukunst nach diesen rein künstlerischen Unter-
schieden von einander abheben. Auch ist es keine dogmatische Einseitigkeit des
Urteils, wenn die Baukunst des deutschen Rokoko als letzte Erfüllung einer zwei-
hundertjährigen Entwicklung bezeichnet wird. Will das doch nichts anderes be-
sagen, als daß hier, um das schon oben gebrauchte Bild wieder anzuwenden, die
Kurve der fortschreitenden Durchdringung und Komplizierung ein Maximum er-
reicht hat ')•
») Für die weiteren geschichtsphilosophischen Fragen muß ich hier auf meinen
in den Kant-Studien erscheinenden Aufsatz »Das Wesen des Individuellen« ver-
weisen.
gegenüber in klarer Überschaubarkeit, Beruhigung und Oreifbarkeit besteht. Durch
diese »reinste sinnliche Form« ist die Zeit um 1680 in Süddeutschlands Kirchenbau
als Reifeperiode gekennzeichnet, während um 1600 die reine Form noch unklar mit
Ausdruck durchsetzt ist, um 1740 aber Form und Ausdruck verschmelzen. Die drei
Stufen stellen daher gleichzeitig eine gesetzmäßige Folge von vorsinnlicher, sinn-
licher und übersinnlicher Kunst dar. Wie für Hegel eigentlich nur die klassische
Kunst volle Kunst war, während ihm die orientalische Kunst als Urkunst galt, die
romantische Kunst sich aber schon auf dem Wege zu einer Aufhebung der Kunst
überhaupt in eine höhere Form des Geistes befand, so ist für Hauttmann nur die
klassisch reine, schöne Form wahre Form. Sie bildet einen absoluten, eindeutig
bestimmten Höhepunkt in der Entwicklung; auf sie strebt die jugendliche Vorstufe
zu, über sie hinaus strebt der alternde, mit Ausdruck gesättigte Stil. Mit verständnis-
voller Liebe wird nun von Hauttmann bis in die feinsten Verzweigungen hinein ein
möglichst vollständiges historisches Material durchgearbeitet an Hand dieses Schemas
der organischen Entwicklung. Wem aber Form und Ausdruck nicht zwei unab-
hängige Komponenten bilden und wem für jede Stilphase die künstlerische Form
rein ist, soweit sie vollkommen Ausdruck ist, der kann keine Hochstufen mehr an-
setzen, ihm zerbricht damit aber auch das Schema einer organischen Abfolge von
Jugend, Reife und Alter. Nur als bewegliches heuristisches Prinzip wird jenes
Schema noch dienen können, um jeden beliebigen Punkt der kunstgeschichtlichen
Entwicklung hinsichtlich seiner künstlerischen Gestaltungsart in seinen Beziehungen
zu dem Vergangenen und Folgenden zu beleuchten, man wird aber keinen Punkt
als spezifische Hochstufe und Reifezeit auszeichnen, sondern sich damit begnügen,
ohne jenes der Biologie des Einzelindividuums entstammende Bild des Wachstums
nur den Wandel der künstlerischen Gestaltung zu verfolgen und ohne die Formel
eines periodischen Ablaufs die Kurve in übersichtlicher Weise zu gliedern, wie es
ohne fremdes Schema A. E. Brinckmann unternommen hat (»Baukunst des 17.
und 18. Jahrhunderts in den romanischen Ländern« 1915 und »Plastik und Raum«
1922). Er untersucht am Bauwerk die Raumform, die Plastikform, wie auch das
Verhältnis dieser beiden zueinander auf die Art, wie sich die Vielheit der Elemente
zum System des Kunstwerks zusammenfügt. Bald sind die Teile der geschlossenen
Gesamtkomposition selbständig, bald ordnen sie sich einem Hauptakzent unter, dann
durchdringen sie sich, verschmelzen in untrennbarer Einheit, lösen sich wieder, und
Renaissance, italienisches Frühbarock, italienisches Hochbarock, deutsches Rokoko,
Klassizismus lassen sich in ihrer Baukunst nach diesen rein künstlerischen Unter-
schieden von einander abheben. Auch ist es keine dogmatische Einseitigkeit des
Urteils, wenn die Baukunst des deutschen Rokoko als letzte Erfüllung einer zwei-
hundertjährigen Entwicklung bezeichnet wird. Will das doch nichts anderes be-
sagen, als daß hier, um das schon oben gebrauchte Bild wieder anzuwenden, die
Kurve der fortschreitenden Durchdringung und Komplizierung ein Maximum er-
reicht hat ')•
») Für die weiteren geschichtsphilosophischen Fragen muß ich hier auf meinen
in den Kant-Studien erscheinenden Aufsatz »Das Wesen des Individuellen« ver-
weisen.