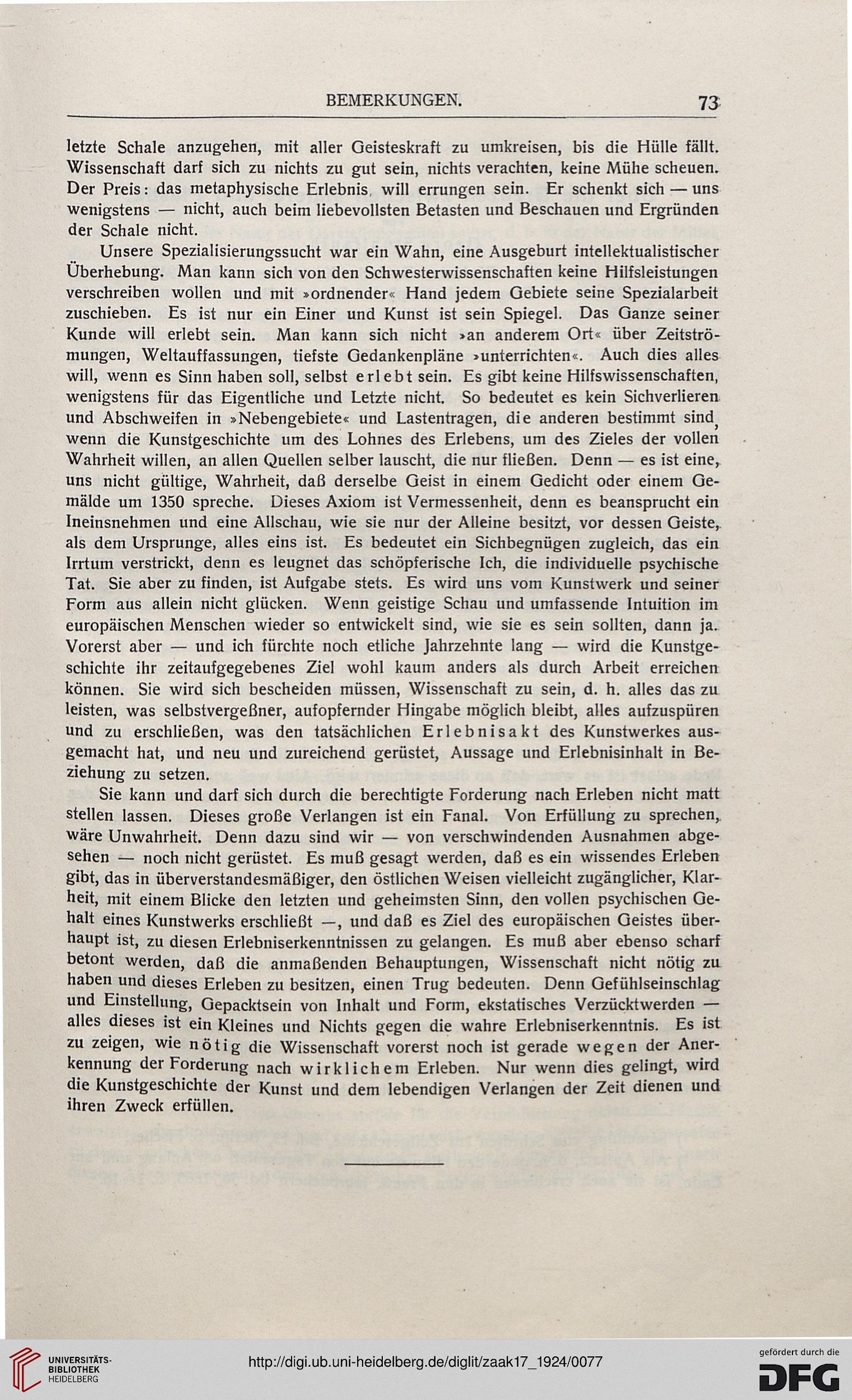BEMERKUNGEN. 73
letzte Schale anzugehen, mit aller Geisteskraft zu umkreisen, bis die Hülle fällt.
Wissenschaft darf sich zu nichts zu gut sein, nichts verachten, keine Mühe scheuen.
Der Preis: das metaphysische Erlebnis, will errungen sein. Er schenkt sich — uns
wenigstens — nicht, auch beim liebevollsten Betasten und Beschauen und Ergründen
der Schale nicht.
Unsere Spezialisierungssucht war ein Wahn, eine Ausgeburt intellektualistischer
Überhebung. Man kann sich von den Schwesterwissenschaften keine Hilfsleistungen
verschreiben wollen und mit »ordnender« Hand jedem Gebiete seine Spezialarbeit
zuschieben. Es ist nur ein Einer und Kunst ist sein Spiegel. Das Ganze seiner
Kunde will erlebt sein. Man kann sich nicht »an anderem Ort« über Zeitströ-
mungen, Weltauffassungen, tiefste Gedankenpläne »unterrichten«. Auch dies alles
will, wenn es Sinn haben soll, selbst erlebt sein. Es gibt keine Hilfswissenschaften,
wenigstens für das Eigentliche und Letzte nicht. So bedeutet es kein Sichverlieren
und Abschweifen in »Nebengebiete« und Lastentragen, die anderen bestimmt sind
wenn die Kunstgeschichte um des Lohnes des Erlebens, um des Zieles der vollen
Wahrheit willen, an allen Quellen selber lauscht, die nur fließen. Denn — es ist eine,
uns nicht gültige, Wahrheit, daß derselbe Geist in einem Gedicht oder einem Ge-
mälde um 1350 spreche. Dieses Axiom ist Vermessenheit, denn es beansprucht ein
Ineinsnehmen und eine Allschau, wie sie nur der Alleine besitzt, vor dessen Geiste,
als dem Ursprünge, alles eins ist. Es bedeutet ein Sichbegnügen zugleich, das ein
Irrtum verstrickt, denn es leugnet das schöpferische Ich, die individuelle psychische
Tat. Sie aber zu finden, ist Aufgabe stets. Es wird uns vom Kunstwerk und seiner
Form aus allein nicht glücken. Wenn geistige Schau und umfassende Intuition im
europäischen Menschen wieder so entwickelt sind, wie sie es sein sollten, dann ja.
Vorerst aber — und ich fürchte noch etliche Jahrzehnte lang — wird die Kunstge-
schichte ihr zeitaufgegebenes Ziel wohl kaum anders als durch Arbeit erreichen
können. Sie wird sich bescheiden müssen, Wissenschaft zu sein, d. h. alles das zu
leisten, was selbstvergeßner, aufopfernder Hingabe möglich bleibt, alles aufzuspüren
und zu erschließen, was den tatsächlichen Erlebnisakt des Kunstwerkes aus-
gemacht hat, und neu und zureichend gerüstet, Aussage und Erlebnisinhalt in Be-
ziehung zu setzen.
Sie kann und darf sich durch die berechtigte Forderung nach Erleben nicht matt
stellen lassen. Dieses große Verlangen ist ein Fanal. Von Erfüllung zu sprechen,
wäre Unwahrheit. Denn dazu sind wir — von verschwindenden Ausnahmen abge-
sehen — noch nicht gerüstet. Es muß gesagt werden, daß es ein wissendes Erleben
gibt, das in überverstandesmäßiger, den östlichen Weisen vielleicht zugänglicher, Klar-
heit, mit einem Blicke den letzten und geheimsten Sinn, den vollen psychischen Ge-
halt eines Kunstwerks erschließt —, und daß es Ziel des europäischen Geistes über-
haupt ist, zu diesen Erlebniserkenntnissen zu gelangen. Es muß aber ebenso scharf
betont werden, daß die anmaßenden Behauptungen, Wissenschaft nicht nötig zu
haben und dieses Erleben zu besitzen, einen Trug bedeuten. Denn Gefühlseinschlag
und Einstellung, Gepacktsein von Inhalt und Form, ekstatisches Verzücktwerden —
alles dieses ist ein Kleines und Nichts gegen die wahre Erlebniserkenntnis. Es ist
zu zeigen, wie nötig die Wissenschaft vorerst noch ist gerade wegen der Aner-
kennung der Forderung nach wirklichem Erleben. Nur wenn dies gelingt, wird
die Kunstgeschichte der Kunst und dem lebendigen Verlangen der Zeit dienen und
ihren Zweck erfüllen.
letzte Schale anzugehen, mit aller Geisteskraft zu umkreisen, bis die Hülle fällt.
Wissenschaft darf sich zu nichts zu gut sein, nichts verachten, keine Mühe scheuen.
Der Preis: das metaphysische Erlebnis, will errungen sein. Er schenkt sich — uns
wenigstens — nicht, auch beim liebevollsten Betasten und Beschauen und Ergründen
der Schale nicht.
Unsere Spezialisierungssucht war ein Wahn, eine Ausgeburt intellektualistischer
Überhebung. Man kann sich von den Schwesterwissenschaften keine Hilfsleistungen
verschreiben wollen und mit »ordnender« Hand jedem Gebiete seine Spezialarbeit
zuschieben. Es ist nur ein Einer und Kunst ist sein Spiegel. Das Ganze seiner
Kunde will erlebt sein. Man kann sich nicht »an anderem Ort« über Zeitströ-
mungen, Weltauffassungen, tiefste Gedankenpläne »unterrichten«. Auch dies alles
will, wenn es Sinn haben soll, selbst erlebt sein. Es gibt keine Hilfswissenschaften,
wenigstens für das Eigentliche und Letzte nicht. So bedeutet es kein Sichverlieren
und Abschweifen in »Nebengebiete« und Lastentragen, die anderen bestimmt sind
wenn die Kunstgeschichte um des Lohnes des Erlebens, um des Zieles der vollen
Wahrheit willen, an allen Quellen selber lauscht, die nur fließen. Denn — es ist eine,
uns nicht gültige, Wahrheit, daß derselbe Geist in einem Gedicht oder einem Ge-
mälde um 1350 spreche. Dieses Axiom ist Vermessenheit, denn es beansprucht ein
Ineinsnehmen und eine Allschau, wie sie nur der Alleine besitzt, vor dessen Geiste,
als dem Ursprünge, alles eins ist. Es bedeutet ein Sichbegnügen zugleich, das ein
Irrtum verstrickt, denn es leugnet das schöpferische Ich, die individuelle psychische
Tat. Sie aber zu finden, ist Aufgabe stets. Es wird uns vom Kunstwerk und seiner
Form aus allein nicht glücken. Wenn geistige Schau und umfassende Intuition im
europäischen Menschen wieder so entwickelt sind, wie sie es sein sollten, dann ja.
Vorerst aber — und ich fürchte noch etliche Jahrzehnte lang — wird die Kunstge-
schichte ihr zeitaufgegebenes Ziel wohl kaum anders als durch Arbeit erreichen
können. Sie wird sich bescheiden müssen, Wissenschaft zu sein, d. h. alles das zu
leisten, was selbstvergeßner, aufopfernder Hingabe möglich bleibt, alles aufzuspüren
und zu erschließen, was den tatsächlichen Erlebnisakt des Kunstwerkes aus-
gemacht hat, und neu und zureichend gerüstet, Aussage und Erlebnisinhalt in Be-
ziehung zu setzen.
Sie kann und darf sich durch die berechtigte Forderung nach Erleben nicht matt
stellen lassen. Dieses große Verlangen ist ein Fanal. Von Erfüllung zu sprechen,
wäre Unwahrheit. Denn dazu sind wir — von verschwindenden Ausnahmen abge-
sehen — noch nicht gerüstet. Es muß gesagt werden, daß es ein wissendes Erleben
gibt, das in überverstandesmäßiger, den östlichen Weisen vielleicht zugänglicher, Klar-
heit, mit einem Blicke den letzten und geheimsten Sinn, den vollen psychischen Ge-
halt eines Kunstwerks erschließt —, und daß es Ziel des europäischen Geistes über-
haupt ist, zu diesen Erlebniserkenntnissen zu gelangen. Es muß aber ebenso scharf
betont werden, daß die anmaßenden Behauptungen, Wissenschaft nicht nötig zu
haben und dieses Erleben zu besitzen, einen Trug bedeuten. Denn Gefühlseinschlag
und Einstellung, Gepacktsein von Inhalt und Form, ekstatisches Verzücktwerden —
alles dieses ist ein Kleines und Nichts gegen die wahre Erlebniserkenntnis. Es ist
zu zeigen, wie nötig die Wissenschaft vorerst noch ist gerade wegen der Aner-
kennung der Forderung nach wirklichem Erleben. Nur wenn dies gelingt, wird
die Kunstgeschichte der Kunst und dem lebendigen Verlangen der Zeit dienen und
ihren Zweck erfüllen.