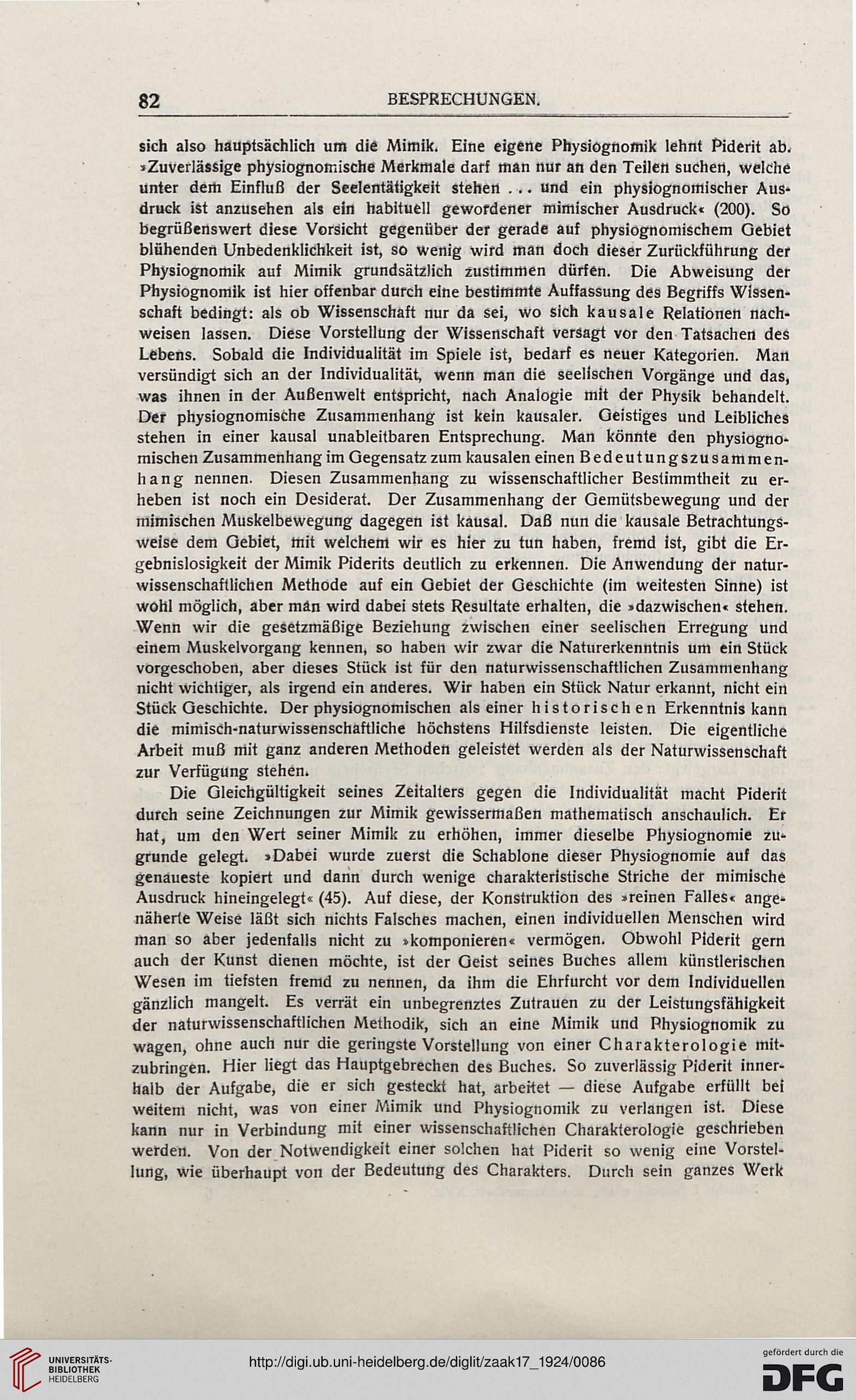82 BESPRECHUNGEN.
sich also hauptsächlich um die Mimik. Eine eigene Physiognomik lehnt Piderit ab.
»Zuverlässige physiognomische Merkmale darf man nur an den Teilen suchen, welche
unter dem Einfluß der Seelentätigkeit stehen . .. und ein physiognomischer Aus-
druck ist anzusehen als ein habituell gewordener mimischer Ausdruck« (200). So
begrüßenswert diese Vorsicht gegenüber der gerade auf physiognomischem Gebiet
blühenden Unbedenklichkeit ist, so wenig wird man doch dieser Zurückführung der
Physiognomik auf Mimik grundsätzlich zustimmen dürfen. Die Abweisung der
Physiognomik ist hier offenbar durch eine bestimmte Auffassung des Begriffs Wissen-
schaft bedingt: als ob Wissenschaft nur da sei, wo sich kausale Relationen nach-
weisen lassen. Diese Vorstellung der Wissenschaft versagt vor den Tatsachen des
Lebens. Sobald die Individualität im Spiele ist, bedarf es neuer Kategorien. Man
versündigt sich an der Individualität, wenn man die seelischen Vorgänge und das,
was ihnen in der Außenwelt entspricht, nach Analogie mit der Physik behandelt.
Der physiognomische Zusammenhang ist kein kausaler. Geistiges und Leibliches
stehen in einer kausal unableitbaren Entsprechung. Man könnte den physiogno-
mischen Zusammenhang im Gegensatz zum kausalen einen Bedeutungszusammen-
hang nennen. Diesen Zusammenhang zu wissenschaftlicher Bestimmtheit zu er-
heben ist noch ein Desiderat. Der Zusammenhang der Gemütsbewegung und der
mimischen Muskelbewegung dagegen ist kausal. Daß nun die kausale Betrachtungs-
weise dem Gebiet, mit welchem wir es hier zu tun haben, fremd ist, gibt die Er-
gebnislosigkeit der Mimik Piderits deutlich zu erkennen. Die Anwendung der natur-
wissenschaftlichen Methode auf ein Gebiet der Geschichte (im weitesten Sinne) ist
wohl möglich, aber man wird dabei stets Resultate erhalten, die »dazwischen« stehen.
Wenn wir die gesetzmäßige Beziehung zwischen einer seelischen Erregung und
einem Muskelvorgang kennen, so haben wir zwar die Naturerkenntnis um ein Stück
vorgeschoben, aber dieses Stück ist für den naturwissenschaftlichen Zusammenhang
nicht wichtiger, als irgend ein anderes. Wir haben ein Stück Natur erkannt, nicht ein
Stück Geschichte. Der physiognomischen als einer historischen Erkenntnis kann
die mimisch-naturwissenschaftliche höchstens Hilfsdienste leisten. Die eigentliche
Arbeit muß mit ganz anderen Methoden geleistet werden als der Naturwissenschaft
zur Verfügung stehen.
Die Gleichgültigkeit seines Zeitalters gegen die Individualität macht Piderit
durch seine Zeichnungen zur Mimik gewissermaßen mathematisch anschaulich. Er
hat, um den Wert seiner Mimik zu erhöhen, immer dieselbe Physiognomie zu-
grunde gelegt. »Dabei wurde zuerst die Schablone dieser Physiognomie auf das
genaueste kopiert und dann durch wenige charakteristische Striche der mimische
Ausdruck hineingelegt« (45). Auf diese, der Konstruktion des »reinen Falles« ange-
näherte Weise läßt sich nichts Falsches machen, einen individuellen Menschen wird
man so aber jedenfalls nicht zu »komponieren« vermögen. Obwohl Piderit gern
auch der Kunst dienen möchte, ist der Geist seines Buches allem künstlerischen
Wesen im tiefsten fremd zu nennen, da ihm die Ehrfurcht vor dem Individuellen
gänzlich mangelt. Es verrät ein unbegrenztes Zutrauen zu der Leistungsfähigkeit
der naturwissenschaftlichen Methodik, sich an eine Mimik und Physiognomik zu
wagen, ohne auch nur die geringste Vorstellung von einer Charakterologie mit-
zubringen. Hier liegt das Hauptgebrechen des Buches. So zuverlässig Piderit inner-
halb der Aufgabe, die er sich gesteckt hat, arbeitet — diese Aufgabe erfüllt bei
weitem nicht, was von einer Mimik und Physiognomik zu verlangen ist. Diese
kann nur in Verbindung mit einer wissenschaftlichen Charakterologie geschrieben
werden. Von der Notwendigkeit einer solchen hat Piderit so wenig eine Vorstel-
lung, wie überhaupt von der Bedeutung des Charakters. Durch sein ganzes Werk
sich also hauptsächlich um die Mimik. Eine eigene Physiognomik lehnt Piderit ab.
»Zuverlässige physiognomische Merkmale darf man nur an den Teilen suchen, welche
unter dem Einfluß der Seelentätigkeit stehen . .. und ein physiognomischer Aus-
druck ist anzusehen als ein habituell gewordener mimischer Ausdruck« (200). So
begrüßenswert diese Vorsicht gegenüber der gerade auf physiognomischem Gebiet
blühenden Unbedenklichkeit ist, so wenig wird man doch dieser Zurückführung der
Physiognomik auf Mimik grundsätzlich zustimmen dürfen. Die Abweisung der
Physiognomik ist hier offenbar durch eine bestimmte Auffassung des Begriffs Wissen-
schaft bedingt: als ob Wissenschaft nur da sei, wo sich kausale Relationen nach-
weisen lassen. Diese Vorstellung der Wissenschaft versagt vor den Tatsachen des
Lebens. Sobald die Individualität im Spiele ist, bedarf es neuer Kategorien. Man
versündigt sich an der Individualität, wenn man die seelischen Vorgänge und das,
was ihnen in der Außenwelt entspricht, nach Analogie mit der Physik behandelt.
Der physiognomische Zusammenhang ist kein kausaler. Geistiges und Leibliches
stehen in einer kausal unableitbaren Entsprechung. Man könnte den physiogno-
mischen Zusammenhang im Gegensatz zum kausalen einen Bedeutungszusammen-
hang nennen. Diesen Zusammenhang zu wissenschaftlicher Bestimmtheit zu er-
heben ist noch ein Desiderat. Der Zusammenhang der Gemütsbewegung und der
mimischen Muskelbewegung dagegen ist kausal. Daß nun die kausale Betrachtungs-
weise dem Gebiet, mit welchem wir es hier zu tun haben, fremd ist, gibt die Er-
gebnislosigkeit der Mimik Piderits deutlich zu erkennen. Die Anwendung der natur-
wissenschaftlichen Methode auf ein Gebiet der Geschichte (im weitesten Sinne) ist
wohl möglich, aber man wird dabei stets Resultate erhalten, die »dazwischen« stehen.
Wenn wir die gesetzmäßige Beziehung zwischen einer seelischen Erregung und
einem Muskelvorgang kennen, so haben wir zwar die Naturerkenntnis um ein Stück
vorgeschoben, aber dieses Stück ist für den naturwissenschaftlichen Zusammenhang
nicht wichtiger, als irgend ein anderes. Wir haben ein Stück Natur erkannt, nicht ein
Stück Geschichte. Der physiognomischen als einer historischen Erkenntnis kann
die mimisch-naturwissenschaftliche höchstens Hilfsdienste leisten. Die eigentliche
Arbeit muß mit ganz anderen Methoden geleistet werden als der Naturwissenschaft
zur Verfügung stehen.
Die Gleichgültigkeit seines Zeitalters gegen die Individualität macht Piderit
durch seine Zeichnungen zur Mimik gewissermaßen mathematisch anschaulich. Er
hat, um den Wert seiner Mimik zu erhöhen, immer dieselbe Physiognomie zu-
grunde gelegt. »Dabei wurde zuerst die Schablone dieser Physiognomie auf das
genaueste kopiert und dann durch wenige charakteristische Striche der mimische
Ausdruck hineingelegt« (45). Auf diese, der Konstruktion des »reinen Falles« ange-
näherte Weise läßt sich nichts Falsches machen, einen individuellen Menschen wird
man so aber jedenfalls nicht zu »komponieren« vermögen. Obwohl Piderit gern
auch der Kunst dienen möchte, ist der Geist seines Buches allem künstlerischen
Wesen im tiefsten fremd zu nennen, da ihm die Ehrfurcht vor dem Individuellen
gänzlich mangelt. Es verrät ein unbegrenztes Zutrauen zu der Leistungsfähigkeit
der naturwissenschaftlichen Methodik, sich an eine Mimik und Physiognomik zu
wagen, ohne auch nur die geringste Vorstellung von einer Charakterologie mit-
zubringen. Hier liegt das Hauptgebrechen des Buches. So zuverlässig Piderit inner-
halb der Aufgabe, die er sich gesteckt hat, arbeitet — diese Aufgabe erfüllt bei
weitem nicht, was von einer Mimik und Physiognomik zu verlangen ist. Diese
kann nur in Verbindung mit einer wissenschaftlichen Charakterologie geschrieben
werden. Von der Notwendigkeit einer solchen hat Piderit so wenig eine Vorstel-
lung, wie überhaupt von der Bedeutung des Charakters. Durch sein ganzes Werk