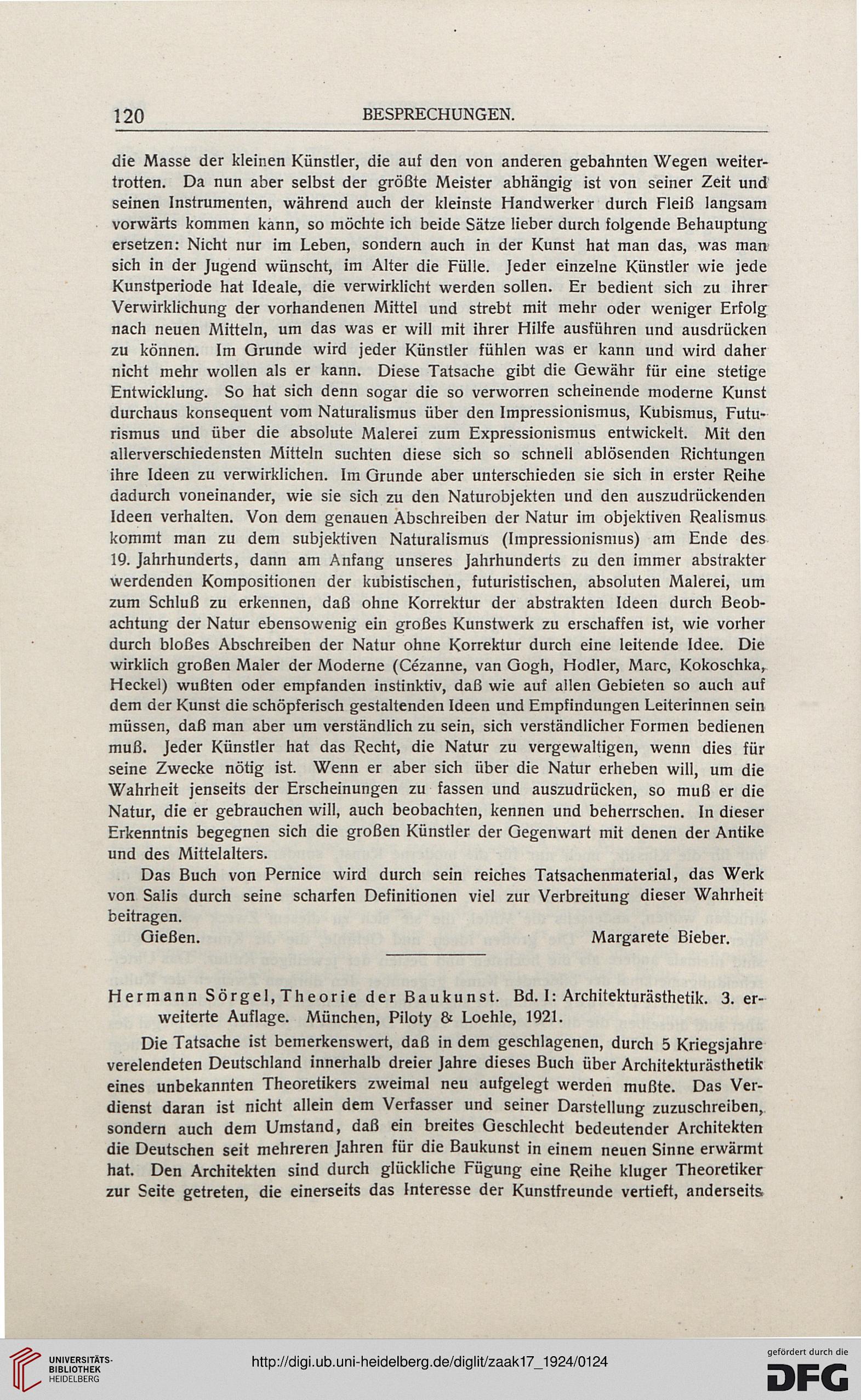120 BESPRECHUNGEN.
die Masse der kleinen Künstler, die auf den von anderen gebahnten Wegen weiter-
trotten. Da nun aber selbst der größte Meister abhängig ist von seiner Zeit und
seinen Instrumenten, während auch der kleinste Handwerker durch Fleiß langsam
vorwärts kommen kann, so möchte ich beide Sätze lieber durch folgende Behauptung
ersetzen: Nicht nur im Leben, sondern auch in der Kunst hat man das, was man
sich in der Jugend wünscht, im Alter die Fülle. Jeder einzelne Künstler wie jede
Kunstperiode hat Ideale, die verwirklicht werden sollen. Er bedient sich zu ihrer
Verwirklichung der vorhandenen Mittel und strebt mit mehr oder weniger Erfolg
nach neuen Mitteln, um das was er will mit ihrer Hilfe ausführen und ausdrücken
zu können. Im Grunde wird jeder Künstler fühlen was er kann und wird daher
nicht mehr wollen als er kann. Diese Tatsache gibt die Gewähr für eine stetige
Entwicklung. So hat sich denn sogar die so verworren scheinende moderne Kunst
durchaus konsequent vom Naturalismus über den Impressionismus, Kubismus, Futu-
rismus und über die absolute Malerei zum Expressionismus entwickelt. Mit den
allerverschiedensten Mitteln suchten diese sich so schnell ablösenden Richtungen
ihre Ideen zu verwirklichen. Im Grunde aber unterschieden sie sich in erster Reihe
dadurch voneinander, wie sie sich zu den Naturobjekten und den auszudrückenden
Ideen verhalten. Von dem genauen Abschreiben der Natur im objektiven Realismus
kommt man zu dem subjektiven Naturalismus (Impressionismus) am Ende des
19. Jahrhunderts, dann am Anfang unseres Jahrhunderts zu den immer abstrakter
werdenden Kompositionen der kubistischen, futuristischen, absoluten Malerei, um
zum Schluß zu erkennen, daß ohne Korrektur der abstrakten Ideen durch Beob-
achtung der Natur ebensowenig ein großes Kunstwerk zu erschaffen ist, wie vorher
durch bloßes Abschreiben der Natur ohne Korrektur durch eine leitende Idee. Die
wirklich großen Maler der Moderne (Cezanne, van Gogh, Hodler, Marc, Kokoschka,
Hecke!) wußten oder empfanden instinktiv, daß wie auf allen Gebieten so auch auf
dem der Kunst die schöpferisch gestaltenden Ideen und Empfindungen Leiterinnen sein
müssen, daß man aber um verständlich zu sein, sich verständlicher Formen bedienen
muß. Jeder Künstler hat das Recht, die Natur zu vergewaltigen, wenn dies für
seine Zwecke nötig ist. Wenn er aber sich über die Natur erheben will, um die
Wahrheit jenseits der Erscheinungen zu fassen und auszudrücken, so muß er die
Natur, die er gebrauchen will, auch beobachten, kennen und beherrschen. In dieser
Erkenntnis begegnen sich die großen Künstler der Gegenwart mit denen der Antike
und des Mittelalters.
Das Buch von Pernice wird durch sein reiches Tatsachenmaterial, das Werk
von Salis durch seine scharfen Definitionen viel zur Verbreitung dieser Wahrheit
beitragen.
Gießen. Margarete Bieber.
Hermann Sörgel, Theorie der Baukunst. Bd. I: Architekturästhetik. 3. er-
weiterte Auflage. München, Piloty & Loehle, 1921.
Die Tatsache ist bemerkenswert, daß in dem geschlagenen, durch 5 Kriegsjahre
verelendeten Deutschland innerhalb dreier Jahre dieses Buch über Architekturästhetik
eines unbekannten Theoretikers zweimal neu aufgelegt werden mußte. Das Ver-
dienst daran ist nicht allein dem Verfasser und seiner Darstellung zuzuschreiben,
sondern auch dem Umstand, daß ein breites Geschlecht bedeutender Architekten
die Deutschen seit mehreren Jahren für die Baukunst in einem neuen Sinne erwärmt
hat. Den Architekten sind durch glückliche Fügung eine Reihe kluger Theoretiker
zur Seite getreten, die einerseits das Interesse der Kunstfreunde vertieft, anderseits
die Masse der kleinen Künstler, die auf den von anderen gebahnten Wegen weiter-
trotten. Da nun aber selbst der größte Meister abhängig ist von seiner Zeit und
seinen Instrumenten, während auch der kleinste Handwerker durch Fleiß langsam
vorwärts kommen kann, so möchte ich beide Sätze lieber durch folgende Behauptung
ersetzen: Nicht nur im Leben, sondern auch in der Kunst hat man das, was man
sich in der Jugend wünscht, im Alter die Fülle. Jeder einzelne Künstler wie jede
Kunstperiode hat Ideale, die verwirklicht werden sollen. Er bedient sich zu ihrer
Verwirklichung der vorhandenen Mittel und strebt mit mehr oder weniger Erfolg
nach neuen Mitteln, um das was er will mit ihrer Hilfe ausführen und ausdrücken
zu können. Im Grunde wird jeder Künstler fühlen was er kann und wird daher
nicht mehr wollen als er kann. Diese Tatsache gibt die Gewähr für eine stetige
Entwicklung. So hat sich denn sogar die so verworren scheinende moderne Kunst
durchaus konsequent vom Naturalismus über den Impressionismus, Kubismus, Futu-
rismus und über die absolute Malerei zum Expressionismus entwickelt. Mit den
allerverschiedensten Mitteln suchten diese sich so schnell ablösenden Richtungen
ihre Ideen zu verwirklichen. Im Grunde aber unterschieden sie sich in erster Reihe
dadurch voneinander, wie sie sich zu den Naturobjekten und den auszudrückenden
Ideen verhalten. Von dem genauen Abschreiben der Natur im objektiven Realismus
kommt man zu dem subjektiven Naturalismus (Impressionismus) am Ende des
19. Jahrhunderts, dann am Anfang unseres Jahrhunderts zu den immer abstrakter
werdenden Kompositionen der kubistischen, futuristischen, absoluten Malerei, um
zum Schluß zu erkennen, daß ohne Korrektur der abstrakten Ideen durch Beob-
achtung der Natur ebensowenig ein großes Kunstwerk zu erschaffen ist, wie vorher
durch bloßes Abschreiben der Natur ohne Korrektur durch eine leitende Idee. Die
wirklich großen Maler der Moderne (Cezanne, van Gogh, Hodler, Marc, Kokoschka,
Hecke!) wußten oder empfanden instinktiv, daß wie auf allen Gebieten so auch auf
dem der Kunst die schöpferisch gestaltenden Ideen und Empfindungen Leiterinnen sein
müssen, daß man aber um verständlich zu sein, sich verständlicher Formen bedienen
muß. Jeder Künstler hat das Recht, die Natur zu vergewaltigen, wenn dies für
seine Zwecke nötig ist. Wenn er aber sich über die Natur erheben will, um die
Wahrheit jenseits der Erscheinungen zu fassen und auszudrücken, so muß er die
Natur, die er gebrauchen will, auch beobachten, kennen und beherrschen. In dieser
Erkenntnis begegnen sich die großen Künstler der Gegenwart mit denen der Antike
und des Mittelalters.
Das Buch von Pernice wird durch sein reiches Tatsachenmaterial, das Werk
von Salis durch seine scharfen Definitionen viel zur Verbreitung dieser Wahrheit
beitragen.
Gießen. Margarete Bieber.
Hermann Sörgel, Theorie der Baukunst. Bd. I: Architekturästhetik. 3. er-
weiterte Auflage. München, Piloty & Loehle, 1921.
Die Tatsache ist bemerkenswert, daß in dem geschlagenen, durch 5 Kriegsjahre
verelendeten Deutschland innerhalb dreier Jahre dieses Buch über Architekturästhetik
eines unbekannten Theoretikers zweimal neu aufgelegt werden mußte. Das Ver-
dienst daran ist nicht allein dem Verfasser und seiner Darstellung zuzuschreiben,
sondern auch dem Umstand, daß ein breites Geschlecht bedeutender Architekten
die Deutschen seit mehreren Jahren für die Baukunst in einem neuen Sinne erwärmt
hat. Den Architekten sind durch glückliche Fügung eine Reihe kluger Theoretiker
zur Seite getreten, die einerseits das Interesse der Kunstfreunde vertieft, anderseits