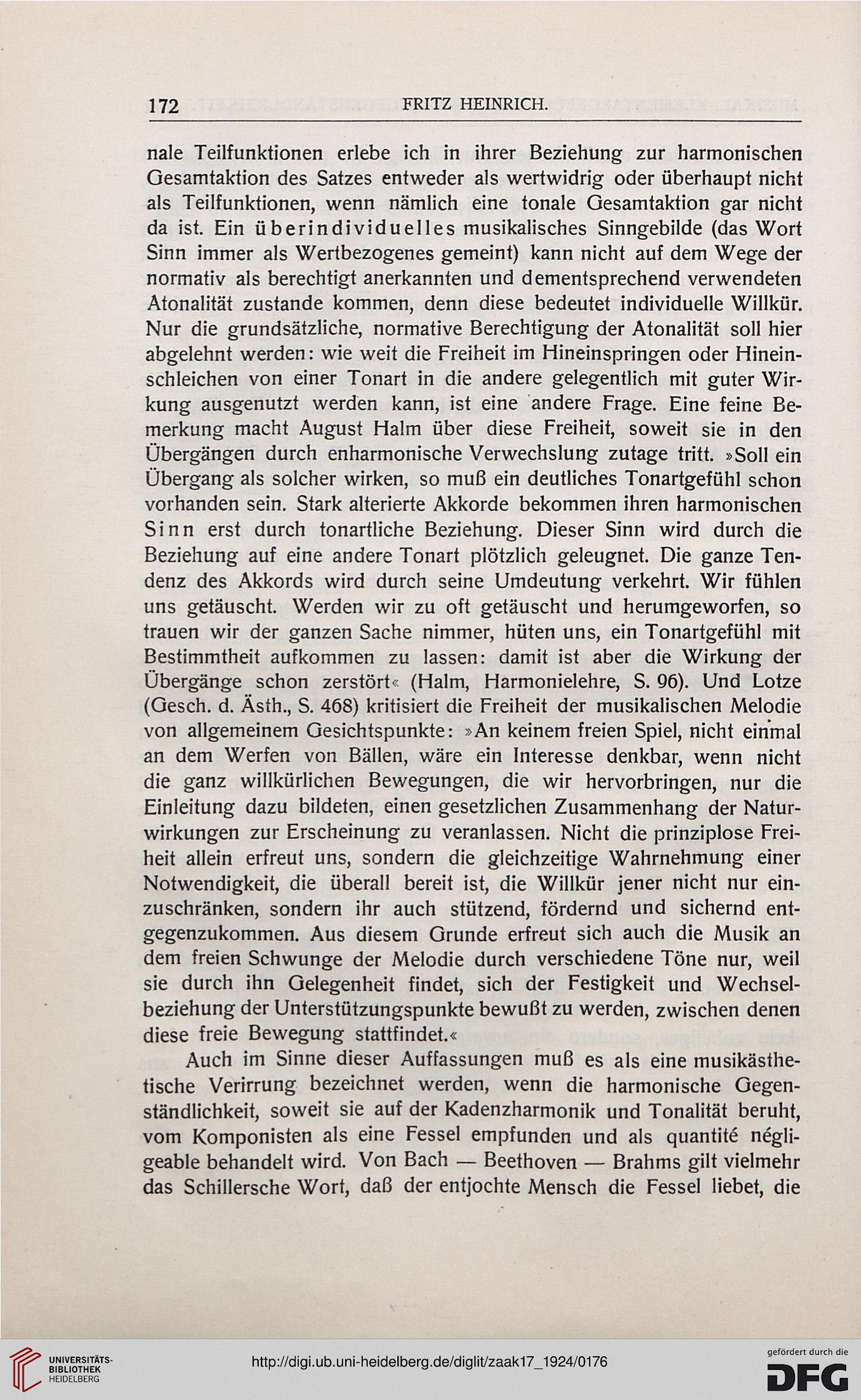172 FRITZ HEINRICH.
nale Teilfunktionen erlebe ich in ihrer Beziehung zur harmonischen
Gesamtaktion des Satzes entweder als wertwidrig oder überhaupt nicht
als Teilfunktionen, wenn nämlich eine tonale Gesamtaktion gar nicht
da ist. Ein überindividuelles musikalisches Sinngebilde (das Wort
Sinn immer als Wertbezogenes gemeint) kann nicht auf dem Wege der
normativ als berechtigt anerkannten und dementsprechend verwendeten
Atonalität zustande kommen, denn diese bedeutet individuelle Willkür.
Nur die grundsätzliche, normative Berechtigung der Atonalität soll hier
abgelehnt werden: wie weit die Freiheit im Hineinspringen oder Hinein-
schleichen von einer Tonart in die andere gelegentlich mit guter Wir-
kung ausgenutzt werden kann, ist eine andere Frage. Eine feine Be-
merkung macht August Halm über diese Freiheit, soweit sie in den
Übergängen durch enharmonische Verwechslung zutage tritt. »Soll ein
Übergang als solcher wirken, so muß ein deutliches Tonartgefühl schon
vorhanden sein. Stark alterierte Akkorde bekommen ihren harmonischen
Sinn erst durch tonartliche Beziehung. Dieser Sinn wird durch die
Beziehung auf eine andere Tonart plötzlich geleugnet. Die ganze Ten-
denz des Akkords wird durch seine Umdeutung verkehrt. Wir fühlen
uns getäuscht. Werden wir zu oft getäuscht und herumgeworfen, so
trauen wir der ganzen Sache nimmer, hüten uns, ein Tonartgefühl mit
Bestimmtheit aufkommen zu lassen: damit ist aber die Wirkung der
Übergänge schon zerstört« (Halm, Harmonielehre, S. Q6). Und Lotze
(Gesch. d. Ästh., S. 468) kritisiert die Freiheit der musikalischen Melodie
von allgemeinem Gesichtspunkte: »An keinem freien Spiel, nicht einmal
an dem Werfen von Bällen, wäre ein Interesse denkbar, wenn nicht
die ganz willkürlichen Bewegungen, die wir hervorbringen, nur die
Einleitung dazu bildeten, einen gesetzlichen Zusammenhang der Natur-
wirkungen zur Erscheinung zu veranlassen. Nicht die prinziplose Frei-
heit allein erfreut uns, sondern die gleichzeitige Wahrnehmung einer
Notwendigkeit, die überall bereit ist, die Willkür jener nicht nur ein-
zuschränken, sondern ihr auch stützend, fördernd und sichernd ent-
gegenzukommen. Aus diesem Grunde erfreut sich auch die Musik an
dem freien Schwünge der Melodie durch verschiedene Töne nur, weil
sie durch ihn Gelegenheit findet, sich der Festigkeit und Wechsel-
beziehung der Unterstützungspunkte bewußt zu werden, zwischen denen
diese freie Bewegung stattfindet.«
Auch im Sinne dieser Auffassungen muß es als eine musikästhe-
tische Verirrung bezeichnet werden, wenn die harmonische Gegen-
ständlichkeit, soweit sie auf der Kadenzharmonik und Tonalität beruht,
vom Komponisten als eine Fessel empfunden und als quantite negli-
geable behandelt wird. Von Bach — Beethoven — Brahms gilt vielmehr
das Schillersche Wort, daß der entjochte Mensch die Fessel liebet, die
nale Teilfunktionen erlebe ich in ihrer Beziehung zur harmonischen
Gesamtaktion des Satzes entweder als wertwidrig oder überhaupt nicht
als Teilfunktionen, wenn nämlich eine tonale Gesamtaktion gar nicht
da ist. Ein überindividuelles musikalisches Sinngebilde (das Wort
Sinn immer als Wertbezogenes gemeint) kann nicht auf dem Wege der
normativ als berechtigt anerkannten und dementsprechend verwendeten
Atonalität zustande kommen, denn diese bedeutet individuelle Willkür.
Nur die grundsätzliche, normative Berechtigung der Atonalität soll hier
abgelehnt werden: wie weit die Freiheit im Hineinspringen oder Hinein-
schleichen von einer Tonart in die andere gelegentlich mit guter Wir-
kung ausgenutzt werden kann, ist eine andere Frage. Eine feine Be-
merkung macht August Halm über diese Freiheit, soweit sie in den
Übergängen durch enharmonische Verwechslung zutage tritt. »Soll ein
Übergang als solcher wirken, so muß ein deutliches Tonartgefühl schon
vorhanden sein. Stark alterierte Akkorde bekommen ihren harmonischen
Sinn erst durch tonartliche Beziehung. Dieser Sinn wird durch die
Beziehung auf eine andere Tonart plötzlich geleugnet. Die ganze Ten-
denz des Akkords wird durch seine Umdeutung verkehrt. Wir fühlen
uns getäuscht. Werden wir zu oft getäuscht und herumgeworfen, so
trauen wir der ganzen Sache nimmer, hüten uns, ein Tonartgefühl mit
Bestimmtheit aufkommen zu lassen: damit ist aber die Wirkung der
Übergänge schon zerstört« (Halm, Harmonielehre, S. Q6). Und Lotze
(Gesch. d. Ästh., S. 468) kritisiert die Freiheit der musikalischen Melodie
von allgemeinem Gesichtspunkte: »An keinem freien Spiel, nicht einmal
an dem Werfen von Bällen, wäre ein Interesse denkbar, wenn nicht
die ganz willkürlichen Bewegungen, die wir hervorbringen, nur die
Einleitung dazu bildeten, einen gesetzlichen Zusammenhang der Natur-
wirkungen zur Erscheinung zu veranlassen. Nicht die prinziplose Frei-
heit allein erfreut uns, sondern die gleichzeitige Wahrnehmung einer
Notwendigkeit, die überall bereit ist, die Willkür jener nicht nur ein-
zuschränken, sondern ihr auch stützend, fördernd und sichernd ent-
gegenzukommen. Aus diesem Grunde erfreut sich auch die Musik an
dem freien Schwünge der Melodie durch verschiedene Töne nur, weil
sie durch ihn Gelegenheit findet, sich der Festigkeit und Wechsel-
beziehung der Unterstützungspunkte bewußt zu werden, zwischen denen
diese freie Bewegung stattfindet.«
Auch im Sinne dieser Auffassungen muß es als eine musikästhe-
tische Verirrung bezeichnet werden, wenn die harmonische Gegen-
ständlichkeit, soweit sie auf der Kadenzharmonik und Tonalität beruht,
vom Komponisten als eine Fessel empfunden und als quantite negli-
geable behandelt wird. Von Bach — Beethoven — Brahms gilt vielmehr
das Schillersche Wort, daß der entjochte Mensch die Fessel liebet, die