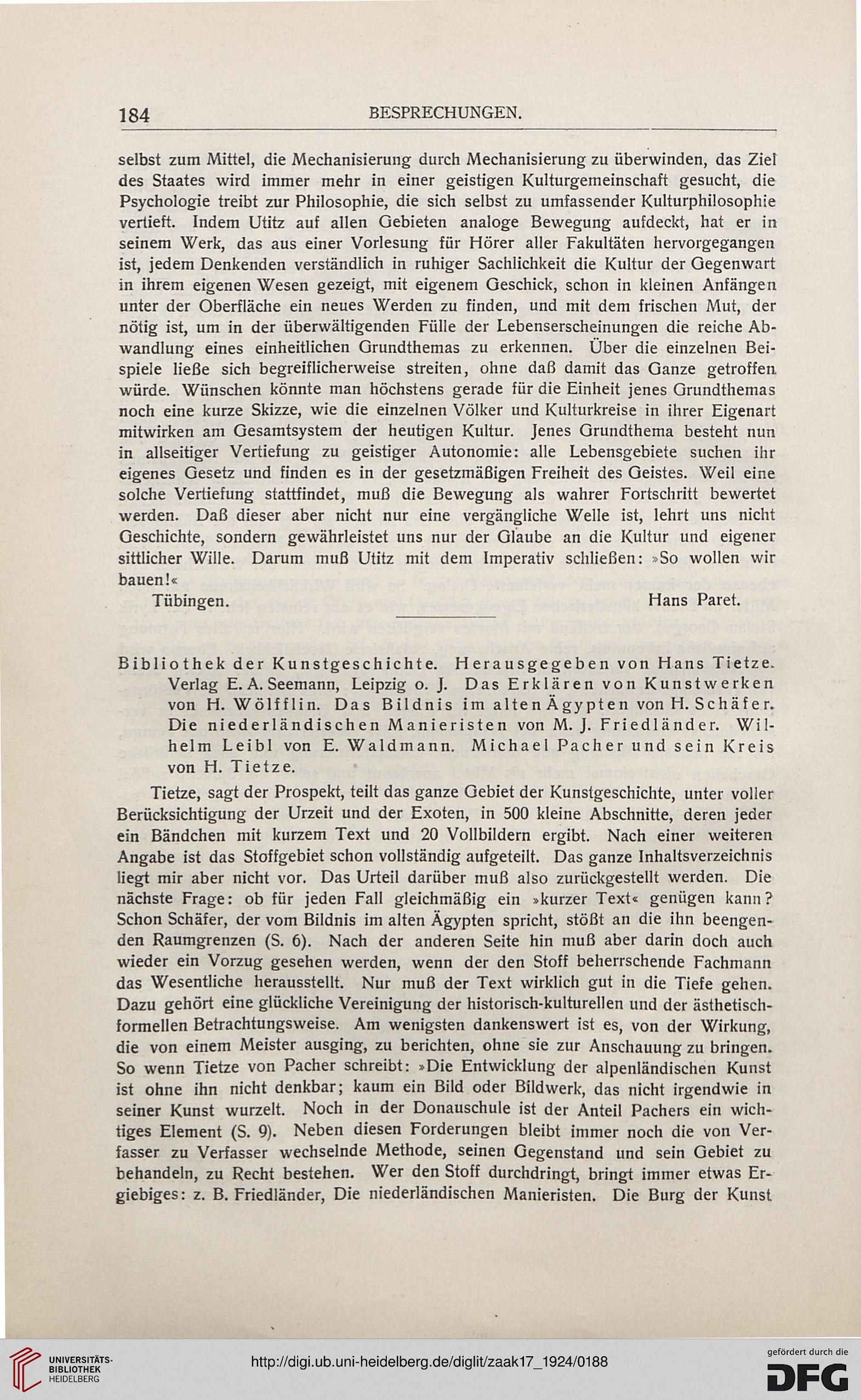184 BESPRECHUNGEN.
selbst zum Mittel, die Mechanisierung durch Mechanisierung zu überwinden, das Ziel
des Staates wird immer mehr in einer geistigen Kulturgemeinschaft gesucht, die
Psychologie treibt zur Philosophie, die sich selbst zu umfassender Kulturphilosophie
vertieft. Indem Utitz auf allen Gebieten analoge Bewegung aufdeckt, hat er in
seinem Werk, das aus einer Vorlesung für Hörer aller Fakultäten hervorgegangen
ist, jedem Denkenden verständlich in ruhiger Sachlichkeit die Kultur der Gegenwart
in ihrem eigenen Wesen gezeigt, mit eigenem Geschick, schon in kleinen Anfängen
unter der Oberfläche ein neues Werden zu finden, und mit dem frischen Mut, der
nötig ist, um in der überwältigenden Fülle der Lebenserscheinungen die reiche Ab-
wandlung eines einheitlichen Grundthemas zu erkennen. Über die einzelnen Bei-
spiele ließe sich begreiflicherweise streiten, ohne daß damit das Ganze getroffen
würde. Wünschen könnte man höchstens gerade für die Einheit jenes Grundthemas
noch eine kurze Skizze, wie die einzelnen Völker und Kulturkreise in ihrer Eigenart
mitwirken am Gesamtsystem der heutigen Kultur. Jenes Grundthema besteht nun
in allseitiger Vertiefung zu geistiger Autonomie: alle Lebensgebiete suchen ihr
eigenes Gesetz und finden es in der gesetzmäßigen Freiheit des Geistes. Weil eine
solche Vertiefung stattfindet, muß die Bewegung als wahrer Fortschritt bewertet
werden. Daß dieser aber nicht nur eine vergängliche Welle ist, lehrt uns nicht
Geschichte, sondern gewährleistet uns nur der Glaube an die Kultur und eigener
sittlicher Wille. Darum muß Utitz mit dem Imperativ schließen: »So wollen wir
bauen!«
Tübingen. Hans Paret.
Bibliothek der Kunstgeschichte. Herausgegeben von Hans Tietze.
Verlag E.A.Seemann, Leipzig o. J. Das Erklären von Kunstwerken
von H. Wölfflin. Das Bildnis im alten Ägypten von H. Schaf e r.
Die niederländischen Manieristen von M. J. Friedländer. Wil-
helm Leibl von E. Waldmann. Michael Pacher und sein Kreis
von H. Tietze.
Tietze, sagt der Prospekt, teilt das ganze Gebiet der Kunstgeschichte, unter voller
Berücksichtigung der Urzeit und der Exoten, in 500 kleine Abschnitte, deren jeder
ein Bändchen mit kurzem Text und 20 Vollbildern ergibt. Nach einer weiteren
Angabe ist das Stoffgebiet schon vollständig aufgeteilt. Das ganze Inhaltsverzeichnis
liegt mir aber nicht vor. Das Urteil darüber muß also zurückgestellt werden. Die
nächste Frage: ob für jeden Fall gleichmäßig ein »kurzer Text« genügen kann?
Schon Schäfer, der vom Bildnis im alten Ägypten spricht, stößt an die ihn beengen-
den Raumgrenzen (S. 6). Nach der anderen Seite hin muß aber darin doch auch
wieder ein Vorzug gesehen werden, wenn der den Stoff beherrschende Fachmann
das Wesentliche herausstellt. Nur muß der Text wirklich gut in die Tiefe gehen.
Dazu gehört eine glückliche Vereinigung der historisch-kulturellen und der ästhetisch-
formellen Betrachtungsweise. Am wenigsten dankenswert ist es, von der Wirkung,
die von einem Meister ausging, zu berichten, ohne sie zur Anschauung zu bringen.
So wenn Tietze von Pacher schreibt: »Die Entwicklung der alpenländischen Kunst
ist ohne ihn nicht denkbar; kaum ein Bild oder Bildwerk, das nicht irgendwie in
seiner Kunst wurzelt. Noch in der Donauschule ist der Anteil Pachers ein wich-
tiges Element (S. 9). Neben diesen Forderungen bleibt immer noch die von Ver-
fasser zu Verfasser wechselnde Methode, seinen Gegenstand und sein Gebiet zu
behandeln, zu Recht bestehen. Wer den Stoff durchdringt, bringt immer etwas Er-
giebiges: z. B. Friedländer, Die niederländischen Manieristen. Die Burg der Kunst
selbst zum Mittel, die Mechanisierung durch Mechanisierung zu überwinden, das Ziel
des Staates wird immer mehr in einer geistigen Kulturgemeinschaft gesucht, die
Psychologie treibt zur Philosophie, die sich selbst zu umfassender Kulturphilosophie
vertieft. Indem Utitz auf allen Gebieten analoge Bewegung aufdeckt, hat er in
seinem Werk, das aus einer Vorlesung für Hörer aller Fakultäten hervorgegangen
ist, jedem Denkenden verständlich in ruhiger Sachlichkeit die Kultur der Gegenwart
in ihrem eigenen Wesen gezeigt, mit eigenem Geschick, schon in kleinen Anfängen
unter der Oberfläche ein neues Werden zu finden, und mit dem frischen Mut, der
nötig ist, um in der überwältigenden Fülle der Lebenserscheinungen die reiche Ab-
wandlung eines einheitlichen Grundthemas zu erkennen. Über die einzelnen Bei-
spiele ließe sich begreiflicherweise streiten, ohne daß damit das Ganze getroffen
würde. Wünschen könnte man höchstens gerade für die Einheit jenes Grundthemas
noch eine kurze Skizze, wie die einzelnen Völker und Kulturkreise in ihrer Eigenart
mitwirken am Gesamtsystem der heutigen Kultur. Jenes Grundthema besteht nun
in allseitiger Vertiefung zu geistiger Autonomie: alle Lebensgebiete suchen ihr
eigenes Gesetz und finden es in der gesetzmäßigen Freiheit des Geistes. Weil eine
solche Vertiefung stattfindet, muß die Bewegung als wahrer Fortschritt bewertet
werden. Daß dieser aber nicht nur eine vergängliche Welle ist, lehrt uns nicht
Geschichte, sondern gewährleistet uns nur der Glaube an die Kultur und eigener
sittlicher Wille. Darum muß Utitz mit dem Imperativ schließen: »So wollen wir
bauen!«
Tübingen. Hans Paret.
Bibliothek der Kunstgeschichte. Herausgegeben von Hans Tietze.
Verlag E.A.Seemann, Leipzig o. J. Das Erklären von Kunstwerken
von H. Wölfflin. Das Bildnis im alten Ägypten von H. Schaf e r.
Die niederländischen Manieristen von M. J. Friedländer. Wil-
helm Leibl von E. Waldmann. Michael Pacher und sein Kreis
von H. Tietze.
Tietze, sagt der Prospekt, teilt das ganze Gebiet der Kunstgeschichte, unter voller
Berücksichtigung der Urzeit und der Exoten, in 500 kleine Abschnitte, deren jeder
ein Bändchen mit kurzem Text und 20 Vollbildern ergibt. Nach einer weiteren
Angabe ist das Stoffgebiet schon vollständig aufgeteilt. Das ganze Inhaltsverzeichnis
liegt mir aber nicht vor. Das Urteil darüber muß also zurückgestellt werden. Die
nächste Frage: ob für jeden Fall gleichmäßig ein »kurzer Text« genügen kann?
Schon Schäfer, der vom Bildnis im alten Ägypten spricht, stößt an die ihn beengen-
den Raumgrenzen (S. 6). Nach der anderen Seite hin muß aber darin doch auch
wieder ein Vorzug gesehen werden, wenn der den Stoff beherrschende Fachmann
das Wesentliche herausstellt. Nur muß der Text wirklich gut in die Tiefe gehen.
Dazu gehört eine glückliche Vereinigung der historisch-kulturellen und der ästhetisch-
formellen Betrachtungsweise. Am wenigsten dankenswert ist es, von der Wirkung,
die von einem Meister ausging, zu berichten, ohne sie zur Anschauung zu bringen.
So wenn Tietze von Pacher schreibt: »Die Entwicklung der alpenländischen Kunst
ist ohne ihn nicht denkbar; kaum ein Bild oder Bildwerk, das nicht irgendwie in
seiner Kunst wurzelt. Noch in der Donauschule ist der Anteil Pachers ein wich-
tiges Element (S. 9). Neben diesen Forderungen bleibt immer noch die von Ver-
fasser zu Verfasser wechselnde Methode, seinen Gegenstand und sein Gebiet zu
behandeln, zu Recht bestehen. Wer den Stoff durchdringt, bringt immer etwas Er-
giebiges: z. B. Friedländer, Die niederländischen Manieristen. Die Burg der Kunst