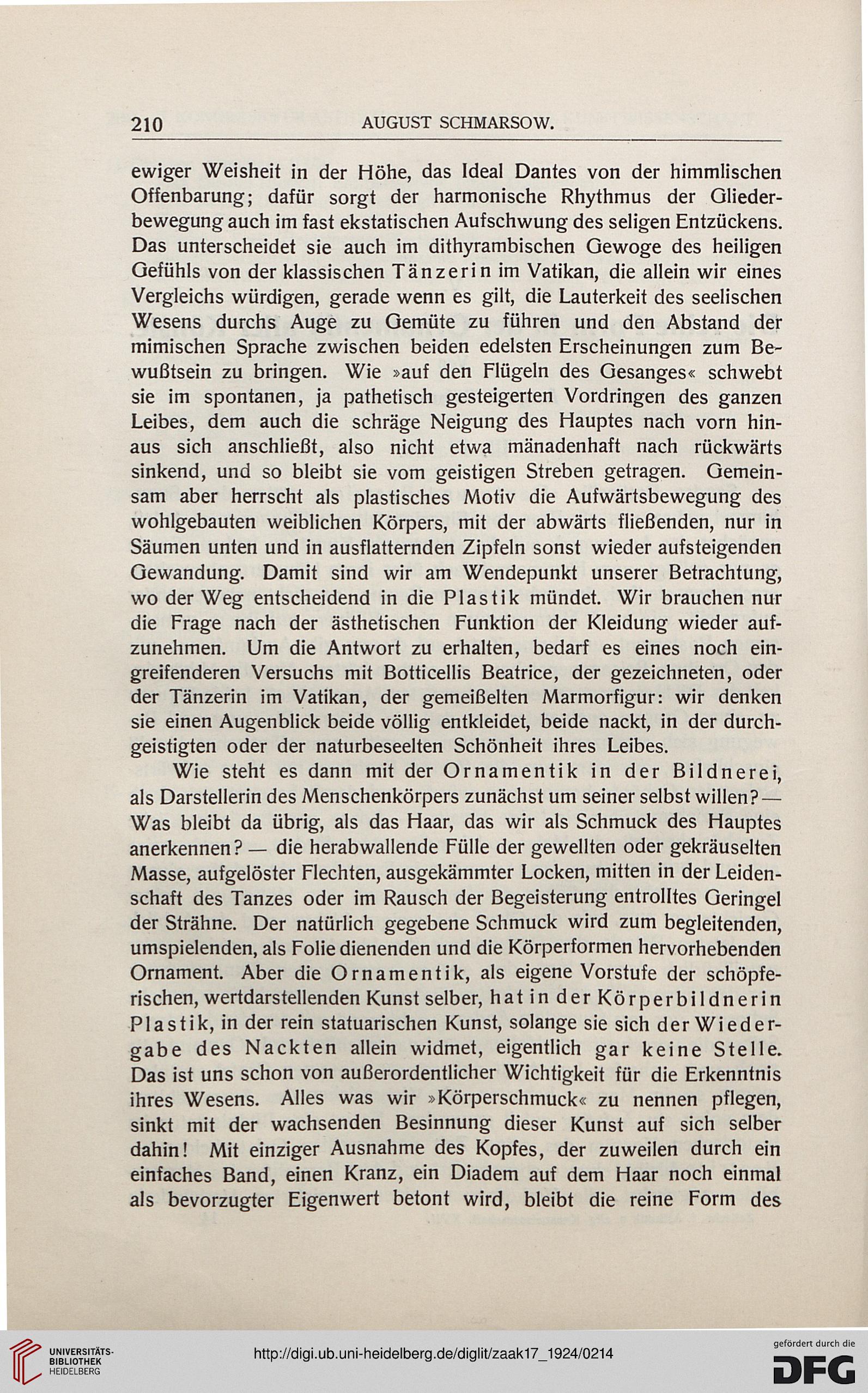210 AUGUST SCHMARSOW.
ewiger Weisheit in der Höhe, das Ideal Dantes von der himmlischen
Offenbarung; dafür sorgt der harmonische Rhythmus der Glieder-
bewegung auch im fast ekstatischen Aufschwung des seligen Entzückens.
Das unterscheidet sie auch im dithyrambischen Gewoge des heiligen
Gefühls von der klassischen Tänzerin im Vatikan, die allein wir eines
Vergleichs würdigen, gerade wenn es gilt, die Lauterkeit des seelischen
Wesens durchs Auge zu Gemüte zu führen und den Abstand der
mimischen Sprache zwischen beiden edelsten Erscheinungen zum Be-
wußtsein zu bringen. Wie »auf den Flügeln des Gesanges« schwebt
sie im spontanen, ja pathetisch gesteigerten Vordringen des ganzen
Leibes, dem auch die schräge Neigung des Hauptes nach vorn hin-
aus sich anschließt, also nicht etwa mänadenhaft nach rückwärts
sinkend, und so bleibt sie vom geistigen Streben getragen. Gemein-
sam aber herrscht als plastisches Motiv die Aufwärtsbewegung des
wohlgebauten weiblichen Körpers, mit der abwärts fließenden, nur in
Säumen unten und in ausflatternden Zipfeln sonst wieder aufsteigenden
Gewandung. Damit sind wir am Wendepunkt unserer Betrachtung,
wo der Weg entscheidend in die Plastik mündet. Wir brauchen nur
die Frage nach der ästhetischen Funktion der Kleidung wieder auf-
zunehmen. Um die Antwort zu erhalten, bedarf es eines noch ein-
greifenderen Versuchs mit Botticellis Beatrice, der gezeichneten, oder
der Tänzerin im Vatikan, der gemeißelten Marmorfigur: wir denken
sie einen Augenblick beide völlig entkleidet, beide nackt, in der durch-
geistigten oder der naturbeseelten Schönheit ihres Leibes.
Wie steht es dann mit der Ornamentik in der Bildnerei,
als Darstellerin des Menschenkörpers zunächst um seiner selbst willen? —
Was bleibt da übrig, als das Haar, das wir als Schmuck des Hauptes
anerkennen? — die herabwallende Fülle der gewellten oder gekräuselten
Masse, aufgelöster Flechten, ausgekämmter Locken, mitten in der Leiden-
schaft des Tanzes oder im Rausch der Begeisterung entrolltes Geringel
der Strähne. Der natürlich gegebene Schmuck wird zum begleitenden,
umspielenden, als Folie dienenden und die Körperformen hervorhebenden
Ornament. Aber die Ornamentik, als eigene Vorstufe der schöpfe-
rischen, wertdarstellenden Kunst selber, hat in der Körperbildnerin
Plastik, in der rein statuarischen Kunst, solange sie sich derWieder-
gabe des Nackten allein widmet, eigentlich gar keine Stelle.
Das ist uns schon von außerordentlicher Wichtigkeit für die Erkenntnis
ihres Wesens. Alles was wir »Körperschmuck« zu nennen pflegen,
sinkt mit der wachsenden Besinnung dieser Kunst auf sich selber
dahin! Mit einziger Ausnahme des Kopfes, der zuweilen durch ein
einfaches Band, einen Kranz, ein Diadem auf dem Haar noch einmal
als bevorzugter Eigenwert betont wird, bleibt die reine Form des
ewiger Weisheit in der Höhe, das Ideal Dantes von der himmlischen
Offenbarung; dafür sorgt der harmonische Rhythmus der Glieder-
bewegung auch im fast ekstatischen Aufschwung des seligen Entzückens.
Das unterscheidet sie auch im dithyrambischen Gewoge des heiligen
Gefühls von der klassischen Tänzerin im Vatikan, die allein wir eines
Vergleichs würdigen, gerade wenn es gilt, die Lauterkeit des seelischen
Wesens durchs Auge zu Gemüte zu führen und den Abstand der
mimischen Sprache zwischen beiden edelsten Erscheinungen zum Be-
wußtsein zu bringen. Wie »auf den Flügeln des Gesanges« schwebt
sie im spontanen, ja pathetisch gesteigerten Vordringen des ganzen
Leibes, dem auch die schräge Neigung des Hauptes nach vorn hin-
aus sich anschließt, also nicht etwa mänadenhaft nach rückwärts
sinkend, und so bleibt sie vom geistigen Streben getragen. Gemein-
sam aber herrscht als plastisches Motiv die Aufwärtsbewegung des
wohlgebauten weiblichen Körpers, mit der abwärts fließenden, nur in
Säumen unten und in ausflatternden Zipfeln sonst wieder aufsteigenden
Gewandung. Damit sind wir am Wendepunkt unserer Betrachtung,
wo der Weg entscheidend in die Plastik mündet. Wir brauchen nur
die Frage nach der ästhetischen Funktion der Kleidung wieder auf-
zunehmen. Um die Antwort zu erhalten, bedarf es eines noch ein-
greifenderen Versuchs mit Botticellis Beatrice, der gezeichneten, oder
der Tänzerin im Vatikan, der gemeißelten Marmorfigur: wir denken
sie einen Augenblick beide völlig entkleidet, beide nackt, in der durch-
geistigten oder der naturbeseelten Schönheit ihres Leibes.
Wie steht es dann mit der Ornamentik in der Bildnerei,
als Darstellerin des Menschenkörpers zunächst um seiner selbst willen? —
Was bleibt da übrig, als das Haar, das wir als Schmuck des Hauptes
anerkennen? — die herabwallende Fülle der gewellten oder gekräuselten
Masse, aufgelöster Flechten, ausgekämmter Locken, mitten in der Leiden-
schaft des Tanzes oder im Rausch der Begeisterung entrolltes Geringel
der Strähne. Der natürlich gegebene Schmuck wird zum begleitenden,
umspielenden, als Folie dienenden und die Körperformen hervorhebenden
Ornament. Aber die Ornamentik, als eigene Vorstufe der schöpfe-
rischen, wertdarstellenden Kunst selber, hat in der Körperbildnerin
Plastik, in der rein statuarischen Kunst, solange sie sich derWieder-
gabe des Nackten allein widmet, eigentlich gar keine Stelle.
Das ist uns schon von außerordentlicher Wichtigkeit für die Erkenntnis
ihres Wesens. Alles was wir »Körperschmuck« zu nennen pflegen,
sinkt mit der wachsenden Besinnung dieser Kunst auf sich selber
dahin! Mit einziger Ausnahme des Kopfes, der zuweilen durch ein
einfaches Band, einen Kranz, ein Diadem auf dem Haar noch einmal
als bevorzugter Eigenwert betont wird, bleibt die reine Form des