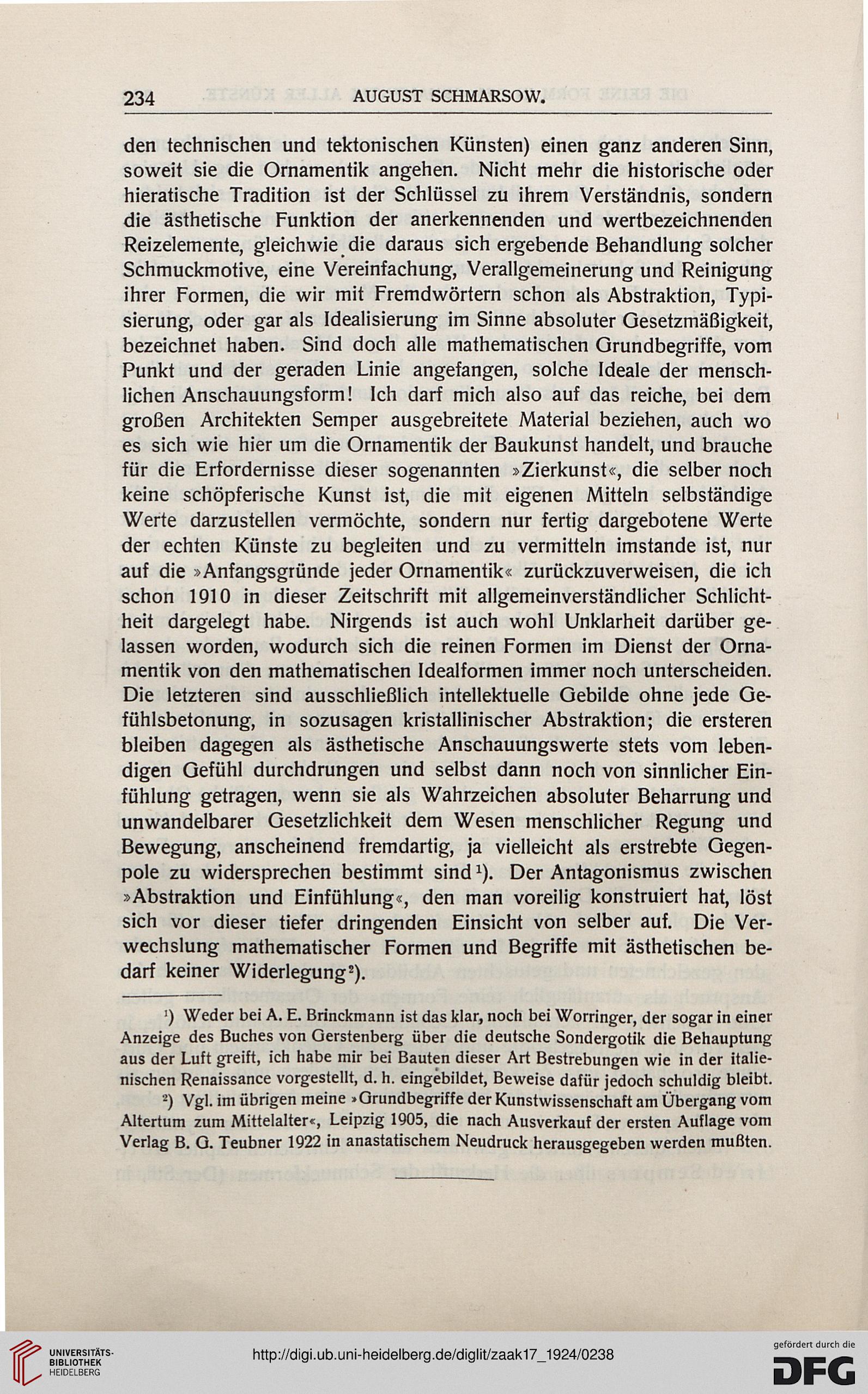234 AUGUST SCHMARSOW.
den technischen und tektonischen Künsten) einen ganz anderen Sinn,
soweit sie die Ornamentik angehen. Nicht mehr die historische oder
hieratische Tradition ist der Schlüssel zu ihrem Verständnis, sondern
die ästhetische Funktion der anerkennenden und wertbezeichnenden
Reizelemente, gleichwie die daraus sich ergebende Behandlung solcher
Schmuckmotive, eine Vereinfachung, Verallgemeinerung und Reinigung
ihrer Formen, die wir mit Fremdwörtern schon als Abstraktion, Typi-
sierung, oder gar als Idealisierung im Sinne absoluter Gesetzmäßigkeit,
bezeichnet haben. Sind doch alle mathematischen Grundbegriffe, vom
Punkt und der geraden Linie angefangen, solche Ideale der mensch-
lichen Anschauungsform! Ich darf mich also auf das reiche, bei dem
großen Architekten Semper ausgebreitete Material beziehen, auch wo
es sich wie hier um die Ornamentik der Baukunst handelt, und brauche
für die Erfordernisse dieser sogenannten »Zierkunst«, die selber noch
keine schöpferische Kunst ist, die mit eigenen Mitteln selbständige
Werte darzustellen vermöchte, sondern nur fertig dargebotene Werte
der echten Künste zu begleiten und zu vermitteln imstande ist, nur
auf die »Anfangsgründe jeder Ornamentik« zurückzuverweisen, die ich
schon 1910 in dieser Zeitschrift mit allgemeinverständlicher Schlicht-
heit dargelegt habe. Nirgends ist auch wohl Unklarheit darüber ge-
lassen worden, wodurch sich die reinen Formen im Dienst der Orna-
mentik von den mathematischen Idealformen immer noch unterscheiden.
Die letzteren sind ausschließlich intellektuelle Gebilde ohne jede Ge-
fühlsbetonung, in sozusagen kristallinischer Abstraktion; die ersteren
bleiben dagegen als ästhetische Anschauungswerte stets vom leben-
digen Gefühl durchdrungen und selbst dann noch von sinnlicher Ein-
fühlung getragen, wenn sie als Wahrzeichen absoluter Beharrung und
unwandelbarer Gesetzlichkeit dem Wesen menschlicher Regung und
Bewegung, anscheinend fremdartig, ja vielleicht als erstrebte Gegen-
pole zu widersprechen bestimmt sind1). Der Antagonismus zwischen
»Abstraktion und Einfühlung«, den man voreilig konstruiert hat, löst
sich vor dieser tiefer dringenden Einsicht von selber auf. Die Ver-
wechslung mathematischer Formen und Begriffe mit ästhetischen be-
darf keiner Widerlegung2).
») Weder bei A. E. Brinckmann ist das klar, noch bei Worringer, der sogar in einer
Anzeige des Buches von Gerstenberg über die deutsche Sondergotik die Behauptung
aus der Luft greift, ich habe mir bei Bauten dieser Art Bestrebungen wie in der italie-
nischen Renaissance vorgestellt, d. h. eingebildet, Beweise dafür jedoch schuldig bleibt.
2) Vgl. im übrigen meine »Grundbegriffe der Kunstwissenschaft am Übergang vom
Altertum zum Mittelalter«, Leipzig 1905, die nach Ausverkauf der ersten Auflage vom
Verlag B. G. Teubner 1922 in anastatischem Neudruck herausgegeben werden mußten.
den technischen und tektonischen Künsten) einen ganz anderen Sinn,
soweit sie die Ornamentik angehen. Nicht mehr die historische oder
hieratische Tradition ist der Schlüssel zu ihrem Verständnis, sondern
die ästhetische Funktion der anerkennenden und wertbezeichnenden
Reizelemente, gleichwie die daraus sich ergebende Behandlung solcher
Schmuckmotive, eine Vereinfachung, Verallgemeinerung und Reinigung
ihrer Formen, die wir mit Fremdwörtern schon als Abstraktion, Typi-
sierung, oder gar als Idealisierung im Sinne absoluter Gesetzmäßigkeit,
bezeichnet haben. Sind doch alle mathematischen Grundbegriffe, vom
Punkt und der geraden Linie angefangen, solche Ideale der mensch-
lichen Anschauungsform! Ich darf mich also auf das reiche, bei dem
großen Architekten Semper ausgebreitete Material beziehen, auch wo
es sich wie hier um die Ornamentik der Baukunst handelt, und brauche
für die Erfordernisse dieser sogenannten »Zierkunst«, die selber noch
keine schöpferische Kunst ist, die mit eigenen Mitteln selbständige
Werte darzustellen vermöchte, sondern nur fertig dargebotene Werte
der echten Künste zu begleiten und zu vermitteln imstande ist, nur
auf die »Anfangsgründe jeder Ornamentik« zurückzuverweisen, die ich
schon 1910 in dieser Zeitschrift mit allgemeinverständlicher Schlicht-
heit dargelegt habe. Nirgends ist auch wohl Unklarheit darüber ge-
lassen worden, wodurch sich die reinen Formen im Dienst der Orna-
mentik von den mathematischen Idealformen immer noch unterscheiden.
Die letzteren sind ausschließlich intellektuelle Gebilde ohne jede Ge-
fühlsbetonung, in sozusagen kristallinischer Abstraktion; die ersteren
bleiben dagegen als ästhetische Anschauungswerte stets vom leben-
digen Gefühl durchdrungen und selbst dann noch von sinnlicher Ein-
fühlung getragen, wenn sie als Wahrzeichen absoluter Beharrung und
unwandelbarer Gesetzlichkeit dem Wesen menschlicher Regung und
Bewegung, anscheinend fremdartig, ja vielleicht als erstrebte Gegen-
pole zu widersprechen bestimmt sind1). Der Antagonismus zwischen
»Abstraktion und Einfühlung«, den man voreilig konstruiert hat, löst
sich vor dieser tiefer dringenden Einsicht von selber auf. Die Ver-
wechslung mathematischer Formen und Begriffe mit ästhetischen be-
darf keiner Widerlegung2).
») Weder bei A. E. Brinckmann ist das klar, noch bei Worringer, der sogar in einer
Anzeige des Buches von Gerstenberg über die deutsche Sondergotik die Behauptung
aus der Luft greift, ich habe mir bei Bauten dieser Art Bestrebungen wie in der italie-
nischen Renaissance vorgestellt, d. h. eingebildet, Beweise dafür jedoch schuldig bleibt.
2) Vgl. im übrigen meine »Grundbegriffe der Kunstwissenschaft am Übergang vom
Altertum zum Mittelalter«, Leipzig 1905, die nach Ausverkauf der ersten Auflage vom
Verlag B. G. Teubner 1922 in anastatischem Neudruck herausgegeben werden mußten.