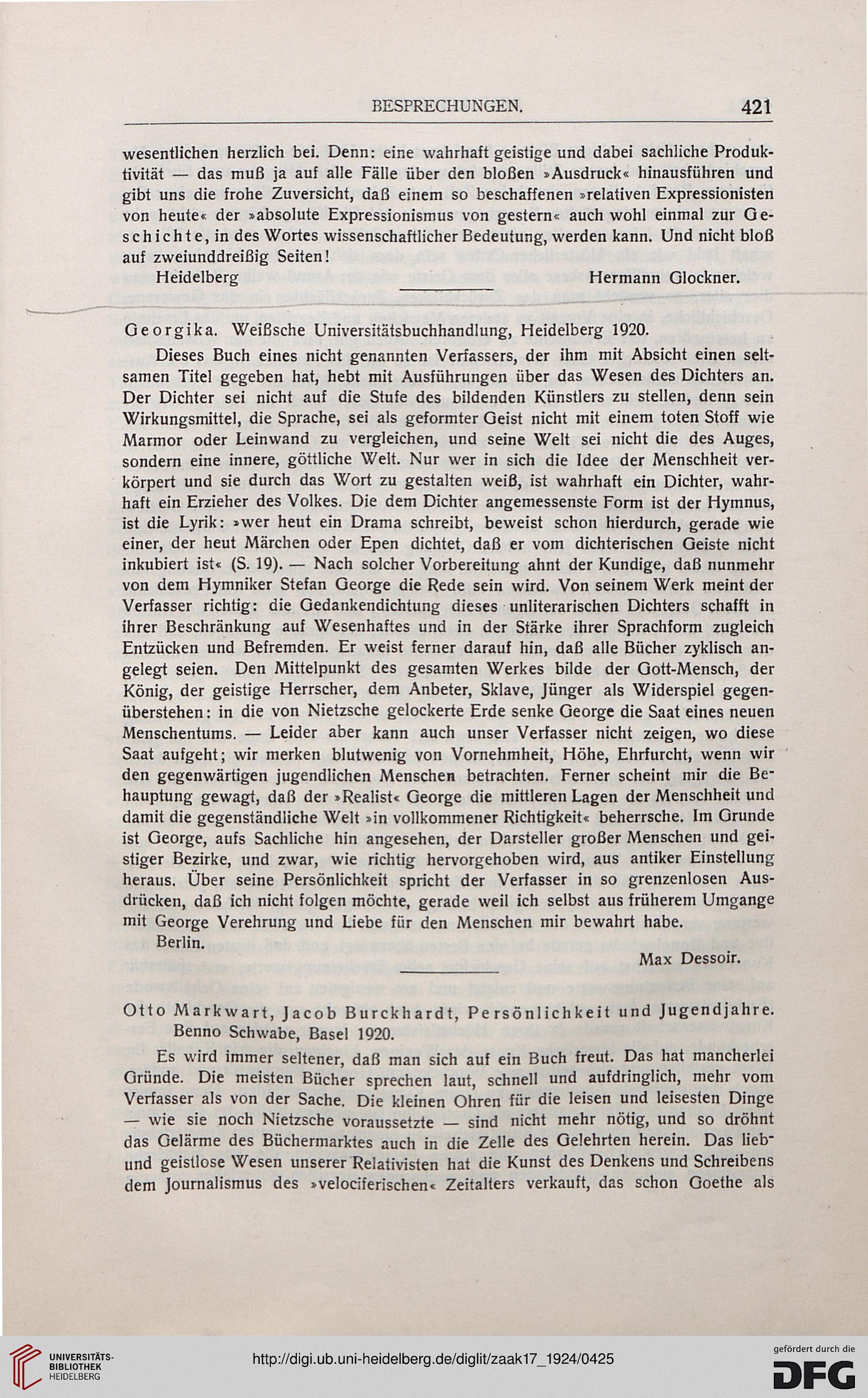BESPRECHUNGEN. 421
wesentlichen herzlich bei. Denn: eine wahrhaft geistige und dabei sachliche Produk-
tivität — das muß ja auf alle Fälle über den bloßen »Ausdruck« hinausführen und
gibt uns die frohe Zuversicht, daß einem so beschaffenen »relativen Expressionisten
von heute« der »absolute Expressionismus von gestern« auch wohl einmal zur Ge-
schichte, in des Wortes wissenschaftlicher Bedeutung, werden kann. Und nicht bloß
auf zweiunddreißig Seiten!
Heidelberg ___________ Hermann Glockner.
Georgika. Weißsche Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1920.
Dieses Buch eines nicht genannten Verfassers, der ihm mit Absicht einen selt-
samen Titel gegeben hat, hebt mit Ausführungen über das Wesen des Dichters an.
Der Dichter sei nicht auf die Stufe des bildenden Künstlers zu stellen, denn sein
Wirkungsmittel, die Sprache, sei als geformter Geist nicht mit einem toten Stoff wie
Marmor oder Leinwand zu vergleichen, und seine Welt sei nicht die des Auges,
sondern eine innere, göttliche Welt. Nur wer in sich die Idee der Menschheit ver-
körpert und sie durch das Wort zu gestalten weiß, ist wahrhaft ein Dichter, wahr-
haft ein Erzieher des Volkes. Die dem Dichter angemessenste Form ist der Hymnus,
ist die Lyrik: »wer heut ein Drama schreibt, beweist schon hierdurch, gerade wie
einer, der heut Märchen oder Epen dichtet, daß er vom dichterischen Geiste nicht
inkubiert ist« (S. 19). — Nach solcher Vorbereitung ahnt der Kundige, daß nunmehr
von dem Hymniker Stefan George die Rede sein wird. Von seinem Werk meint der
Verfasser richtig: die Gedankendichtung dieses unliterarischen Dichters schafft in
ihrer Beschränkung auf Wesenhaftes und in der Stärke ihrer Sprachform zugleich
Entzücken und Befremden. Er weist ferner darauf hin, daß alle Bücher zyklisch an-
gelegt seien. Den Mittelpunkt des gesamten Werkes bilde der Gott-Mensch, der
König, der geistige Herrscher, dem Anbeter, Sklave, Jünger als Widerspiel gegen-
überstehen : in die von Nietzsche gelockerte Erde senke George die Saat eines neuen
Menschentums. — Leider aber kann auch unser Verfasser nicht zeigen, wo diese
Saat aufgeht; wir merken blutwenig von Vornehmheit, Höhe, Ehrfurcht, wenn wir
den gegenwärtigen jugendlichen Menschen betrachten. Ferner scheint mir die Be-
hauptung gewagt, daß der »Realist« George die mittleren Lagen der Menschheit und
damit die gegenständliche Welt »in vollkommener Richtigkeit« beherrsche. Im Grunde
ist George, aufs Sachliche hin angesehen, der Darsteller großer Menschen und gei-
stiger Bezirke, und zwar, wie richtig hervorgehoben wird, aus antiker Einstellung
heraus. Über seine Persönlichkeit spricht der Verfasser in so grenzenlosen Aus-
drücken, daß ich nicht folgen möchte, gerade weil ich selbst aus früherem Umgange
mit George Verehrung und Liebe für den Menschen mir bewahrt habe.
Berlin.
Max Dessoir.
Otto Markwart, Jacob Burckhardt, Persönlichkeit und Jugendjahre.
Benno Schwabe, Basel 1920.
Es wird immer seltener, daß man sich auf ein Buch freut. Das hat mancherlei
Gründe. Die meisten Bücher sprechen laut, schnell und aufdringlich, mehr vom
Verfasser als von der Sache. Die kleinen Ohren für die leisen und leisesten Dinge
— wie sie noch Nietzsche voraussetzte — sind nicht mehr nötig, und so dröhnt
das Gelärme des Büchermarktes auch in die Zelle des Gelehrten herein. Das lieb"
und geistlose Wesen unserer Relativisten hat die Kunst des Denkens und Schreibens
dem Journalismus des »velociferischen« Zeitalters verkauft, das schon Goethe als
wesentlichen herzlich bei. Denn: eine wahrhaft geistige und dabei sachliche Produk-
tivität — das muß ja auf alle Fälle über den bloßen »Ausdruck« hinausführen und
gibt uns die frohe Zuversicht, daß einem so beschaffenen »relativen Expressionisten
von heute« der »absolute Expressionismus von gestern« auch wohl einmal zur Ge-
schichte, in des Wortes wissenschaftlicher Bedeutung, werden kann. Und nicht bloß
auf zweiunddreißig Seiten!
Heidelberg ___________ Hermann Glockner.
Georgika. Weißsche Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1920.
Dieses Buch eines nicht genannten Verfassers, der ihm mit Absicht einen selt-
samen Titel gegeben hat, hebt mit Ausführungen über das Wesen des Dichters an.
Der Dichter sei nicht auf die Stufe des bildenden Künstlers zu stellen, denn sein
Wirkungsmittel, die Sprache, sei als geformter Geist nicht mit einem toten Stoff wie
Marmor oder Leinwand zu vergleichen, und seine Welt sei nicht die des Auges,
sondern eine innere, göttliche Welt. Nur wer in sich die Idee der Menschheit ver-
körpert und sie durch das Wort zu gestalten weiß, ist wahrhaft ein Dichter, wahr-
haft ein Erzieher des Volkes. Die dem Dichter angemessenste Form ist der Hymnus,
ist die Lyrik: »wer heut ein Drama schreibt, beweist schon hierdurch, gerade wie
einer, der heut Märchen oder Epen dichtet, daß er vom dichterischen Geiste nicht
inkubiert ist« (S. 19). — Nach solcher Vorbereitung ahnt der Kundige, daß nunmehr
von dem Hymniker Stefan George die Rede sein wird. Von seinem Werk meint der
Verfasser richtig: die Gedankendichtung dieses unliterarischen Dichters schafft in
ihrer Beschränkung auf Wesenhaftes und in der Stärke ihrer Sprachform zugleich
Entzücken und Befremden. Er weist ferner darauf hin, daß alle Bücher zyklisch an-
gelegt seien. Den Mittelpunkt des gesamten Werkes bilde der Gott-Mensch, der
König, der geistige Herrscher, dem Anbeter, Sklave, Jünger als Widerspiel gegen-
überstehen : in die von Nietzsche gelockerte Erde senke George die Saat eines neuen
Menschentums. — Leider aber kann auch unser Verfasser nicht zeigen, wo diese
Saat aufgeht; wir merken blutwenig von Vornehmheit, Höhe, Ehrfurcht, wenn wir
den gegenwärtigen jugendlichen Menschen betrachten. Ferner scheint mir die Be-
hauptung gewagt, daß der »Realist« George die mittleren Lagen der Menschheit und
damit die gegenständliche Welt »in vollkommener Richtigkeit« beherrsche. Im Grunde
ist George, aufs Sachliche hin angesehen, der Darsteller großer Menschen und gei-
stiger Bezirke, und zwar, wie richtig hervorgehoben wird, aus antiker Einstellung
heraus. Über seine Persönlichkeit spricht der Verfasser in so grenzenlosen Aus-
drücken, daß ich nicht folgen möchte, gerade weil ich selbst aus früherem Umgange
mit George Verehrung und Liebe für den Menschen mir bewahrt habe.
Berlin.
Max Dessoir.
Otto Markwart, Jacob Burckhardt, Persönlichkeit und Jugendjahre.
Benno Schwabe, Basel 1920.
Es wird immer seltener, daß man sich auf ein Buch freut. Das hat mancherlei
Gründe. Die meisten Bücher sprechen laut, schnell und aufdringlich, mehr vom
Verfasser als von der Sache. Die kleinen Ohren für die leisen und leisesten Dinge
— wie sie noch Nietzsche voraussetzte — sind nicht mehr nötig, und so dröhnt
das Gelärme des Büchermarktes auch in die Zelle des Gelehrten herein. Das lieb"
und geistlose Wesen unserer Relativisten hat die Kunst des Denkens und Schreibens
dem Journalismus des »velociferischen« Zeitalters verkauft, das schon Goethe als