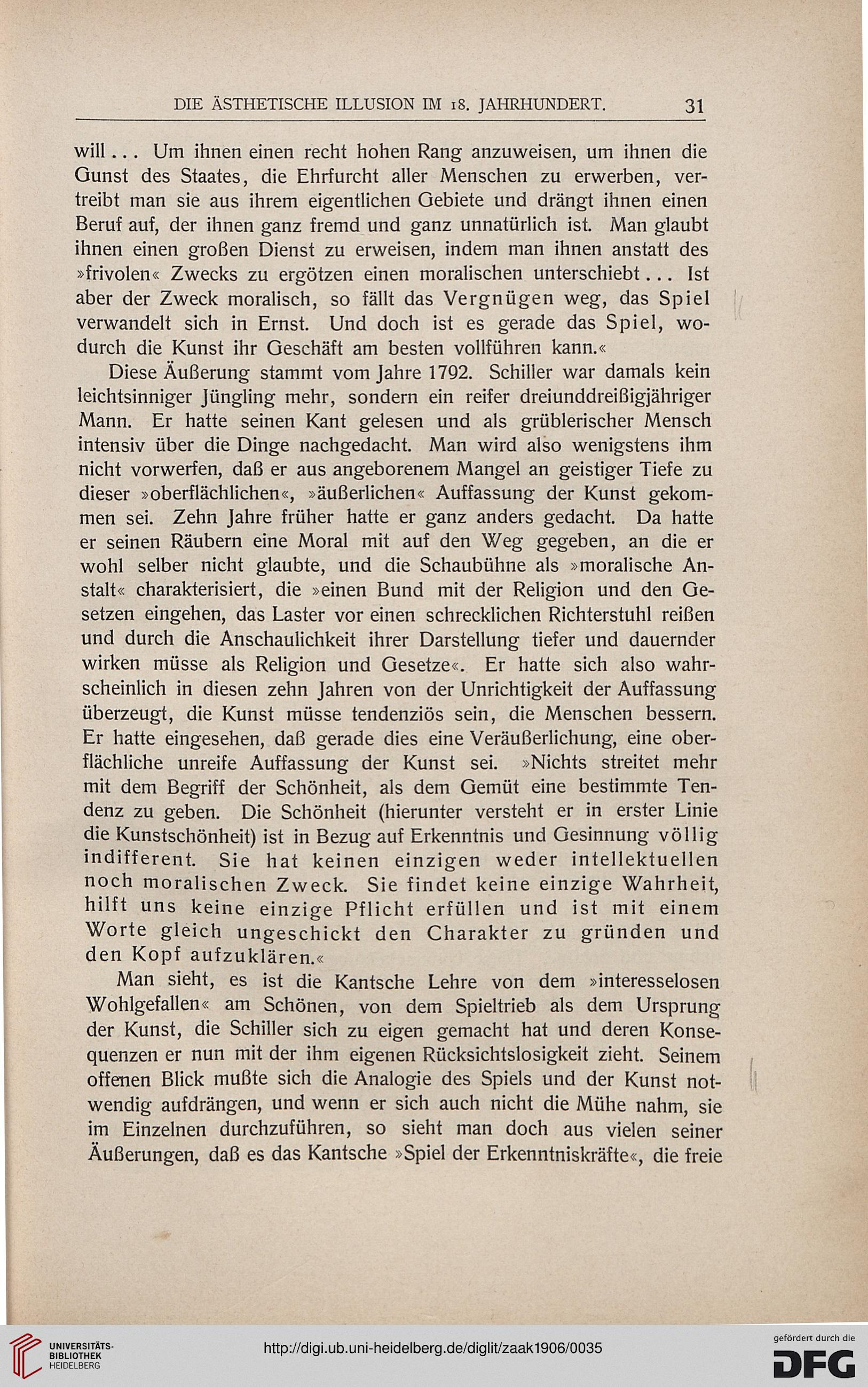DIE ÄSTHETISCHE ILLUSION IM 18. JAHRHUNDERT. 31
will... Um ihnen einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen die
Gunst des Staates, die Ehrfurcht aller Menschen zu erwerben, ver-
treibt man sie aus ihrem eigentlichen Gebiete und drängt ihnen einen
Beruf auf, der ihnen ganz fremd und ganz unnatürlich ist. Man glaubt
ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen anstatt des
»frivolen« Zwecks zu ergötzen einen moralischen unterschiebt... Ist
aber der Zweck moralisch, so fällt das Vergnügen weg, das Spiel
verwandelt sich in Ernst. Und doch ist es gerade das Spiel, wo-
durch die Kunst ihr Geschäft am besten vollführen kann.«
Diese Äußerung stammt vom Jahre 1792. Schiller war damals kein
leichtsinniger Jüngling mehr, sondern ein reifer dreiunddreißigjähriger
Mann. Er hatte seinen Kant gelesen und als grüblerischer Mensch
intensiv über die Dinge nachgedacht. Man wird also wenigstens ihm
nicht vorwerfen, daß er aus angeborenem Mangel an geistiger Tiefe zu
dieser »oberflächlichen«, »äußerlichen« Auffassung der Kunst gekom-
men sei. Zehn Jahre früher hatte er ganz anders gedacht. Da hatte
er seinen Räubern eine Moral mit auf den Weg gegeben, an die er
wohl selber nicht glaubte, und die Schaubühne als »moralische An-
stalt« charakterisiert, die »einen Bund mit der Religion und den Ge-
setzen eingehen, das Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl reißen
und durch die Anschaulichkeit ihrer Darstellung tiefer und dauernder
wirken müsse als Religion und Gesetze«. Er hatte sich also wahr-
scheinlich in diesen zehn Jahren von der Unrichtigkeit der Auffassung
überzeugt, die Kunst müsse tendenziös sein, die Menschen bessern.
Er hatte eingesehen, daß gerade dies eine Veräußerlichung, eine ober-
flächliche unreife Auffassung der Kunst sei. »Nichts streitet mehr
mit dem Begriff der Schönheit, als dem Gemüt eine bestimmte Ten-
denz zu geben. Die Schönheit (hierunter versteht er in erster Linie
die Kunstschönheit) ist in Bezug auf Erkenntnis und Gesinnung völlig
indifferent. Sie hat keinen einzigen weder intellektuellen
noch moralischen Zweck. Sie findet keine einzige Wahrheit,
hilft uns keine einzige Pflicht erfüllen und ist mit einem
Worte gleich ungeschickt den Charakter zu gründen und
den Kopf aufzuklären.«
Man sieht, es ist die Kantsche Lehre von dem »interesselosen
Wohlgefallen« am Schönen, von dem Spieltrieb als dem Ursprung
der Kunst, die Schiller sich zu eigen gemacht hat und deren Konse-
quenzen er nun mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit zieht. Seinem
offenen Blick mußte sich die Analogie des Spiels und der Kunst not-
wendig aufdrängen, und wenn er sich auch nicht die Mühe nahm, sie
im Einzelnen durchzuführen, so sieht man doch aus vielen seiner
Äußerungen, daß es das Kantsche »Spiel der Erkenntniskräfte«, die freie
will... Um ihnen einen recht hohen Rang anzuweisen, um ihnen die
Gunst des Staates, die Ehrfurcht aller Menschen zu erwerben, ver-
treibt man sie aus ihrem eigentlichen Gebiete und drängt ihnen einen
Beruf auf, der ihnen ganz fremd und ganz unnatürlich ist. Man glaubt
ihnen einen großen Dienst zu erweisen, indem man ihnen anstatt des
»frivolen« Zwecks zu ergötzen einen moralischen unterschiebt... Ist
aber der Zweck moralisch, so fällt das Vergnügen weg, das Spiel
verwandelt sich in Ernst. Und doch ist es gerade das Spiel, wo-
durch die Kunst ihr Geschäft am besten vollführen kann.«
Diese Äußerung stammt vom Jahre 1792. Schiller war damals kein
leichtsinniger Jüngling mehr, sondern ein reifer dreiunddreißigjähriger
Mann. Er hatte seinen Kant gelesen und als grüblerischer Mensch
intensiv über die Dinge nachgedacht. Man wird also wenigstens ihm
nicht vorwerfen, daß er aus angeborenem Mangel an geistiger Tiefe zu
dieser »oberflächlichen«, »äußerlichen« Auffassung der Kunst gekom-
men sei. Zehn Jahre früher hatte er ganz anders gedacht. Da hatte
er seinen Räubern eine Moral mit auf den Weg gegeben, an die er
wohl selber nicht glaubte, und die Schaubühne als »moralische An-
stalt« charakterisiert, die »einen Bund mit der Religion und den Ge-
setzen eingehen, das Laster vor einen schrecklichen Richterstuhl reißen
und durch die Anschaulichkeit ihrer Darstellung tiefer und dauernder
wirken müsse als Religion und Gesetze«. Er hatte sich also wahr-
scheinlich in diesen zehn Jahren von der Unrichtigkeit der Auffassung
überzeugt, die Kunst müsse tendenziös sein, die Menschen bessern.
Er hatte eingesehen, daß gerade dies eine Veräußerlichung, eine ober-
flächliche unreife Auffassung der Kunst sei. »Nichts streitet mehr
mit dem Begriff der Schönheit, als dem Gemüt eine bestimmte Ten-
denz zu geben. Die Schönheit (hierunter versteht er in erster Linie
die Kunstschönheit) ist in Bezug auf Erkenntnis und Gesinnung völlig
indifferent. Sie hat keinen einzigen weder intellektuellen
noch moralischen Zweck. Sie findet keine einzige Wahrheit,
hilft uns keine einzige Pflicht erfüllen und ist mit einem
Worte gleich ungeschickt den Charakter zu gründen und
den Kopf aufzuklären.«
Man sieht, es ist die Kantsche Lehre von dem »interesselosen
Wohlgefallen« am Schönen, von dem Spieltrieb als dem Ursprung
der Kunst, die Schiller sich zu eigen gemacht hat und deren Konse-
quenzen er nun mit der ihm eigenen Rücksichtslosigkeit zieht. Seinem
offenen Blick mußte sich die Analogie des Spiels und der Kunst not-
wendig aufdrängen, und wenn er sich auch nicht die Mühe nahm, sie
im Einzelnen durchzuführen, so sieht man doch aus vielen seiner
Äußerungen, daß es das Kantsche »Spiel der Erkenntniskräfte«, die freie