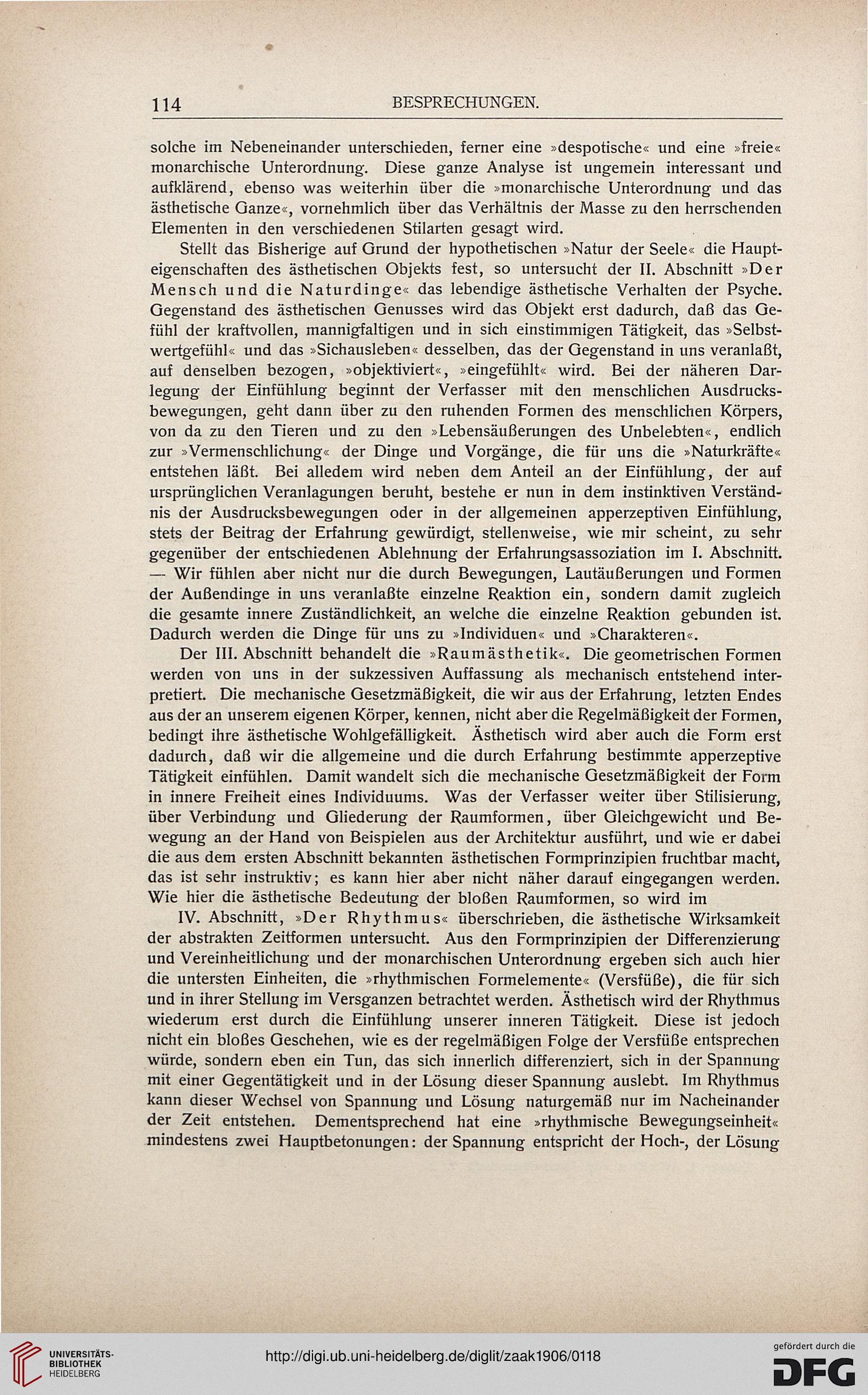114 BESPRECHUNGEN.
solche im Nebeneinander unterschieden, ferner eine »despotische« und eine »freie«
monarchische Unterordnung. Diese ganze Analyse ist ungemein interessant und
aufklärend, ebenso was weiterhin über die »monarchische Unterordnung und das
ästhetische Ganze«, vornehmlich über das Verhältnis der Masse zu den herrschenden
Elementen in den verschiedenen Stilarten gesagt wird.
Stellt das Bisherige auf Grund der hypothetischen »Natur der Seele« die Haupt-
eigenschaften des ästhetischen Objekts fest, so untersucht der II. Abschnitt »Der
Mensch und die Naturdinge« das lebendige ästhetische Verhalten der Psyche.
Gegenstand des ästhetischen Genusses wird das Objekt erst dadurch, daß das Ge-
fühl der kraftvollen, mannigfaltigen und in sich einstimmigen Tätigkeit, das »Selbst-
wertgefühl« und das »Sichausleben« desselben, das der Gegenstand in uns veranlaßt,
auf denselben bezogen, »objektiviert«, »eingefühlt« wird. Bei der näheren Dar-
legung der Einfühlung beginnt der Verfasser mit den menschlichen Ausdrucks-
bewegungen, geht dann über zu den ruhenden Formen des menschlichen Körpers,
von da zu den Tieren und zu den »Lebensäußerungen des Unbelebten«, endlich
zur »Vermenschlichung« der Dinge und Vorgänge, die für uns die »Naturkräfte«
entstehen läßt. Bei alledem wird neben dem Anteil an der Einfühlung, der auf
ursprünglichen Veranlagungen beruht, bestehe er nun in dem instinktiven Verständ-
nis der Ausdrucksbewegungen oder in der allgemeinen apperzeptiven Einfühlung,
stets der Beitrag der Erfahrung gewürdigt, stellenweise, wie mir scheint, zu sehr
gegenüber der entschiedenen Ablehnung der Erfahrungsassoziation im I. Abschnitt.
— Wir fühlen aber nicht nur die durch Bewegungen, Lautäußerungen und Formen
der Außendinge in uns veranlaßte einzelne Reaktion ein, sondern damit zugleich
die gesamte innere Zuständlichkeit, an welche die einzelne Reaktion gebunden ist.
Dadurch werden die Dinge für uns zu »Individuen« und »Charakteren«.
Der III. Abschnitt behandelt die »Raumästhetik«. Die geometrischen Formen
werden von uns in der sukzessiven Auffassung als mechanisch entstehend inter-
pretiert. Die mechanische Gesetzmäßigkeit, die wir aus der Erfahrung, letzten Endes
aus der an unserem eigenen Körper, kennen, nicht aber die Regelmäßigkeit der Formen,
bedingt ihre ästhetische Wohlgefälligkeit. Ästhetisch wird aber auch die Form erst
dadurch, daß wir die allgemeine und die durch Erfahrung bestimmte apperzeptive
Tätigkeit einfühlen. Damit wandelt sich die mechanische Gesetzmäßigkeit der Form
in innere Freiheit eines Individuums. Was der Verfasser weiter über Stilisierung,
über Verbindung und Gliederung der Raumformen, über Gleichgewicht und Be-
wegung an der Hand von Beispielen aus der Architektur ausführt, und wie er dabei
die aus dem ersten Abschnitt bekannten ästhetischen Formprinzipien fruchtbar macht,
das ist sehr instruktiv; es kann hier aber nicht näher darauf eingegangen werden.
Wie hier die ästhetische Bedeutung der bloßen Raumformen, so wird im
IV. Abschnitt, »Der Rhythmus« überschrieben, die ästhetische Wirksamkeit
der abstrakten Zeitformen untersucht. Aus den Formprinzipien der Differenzierung
und Vereinheitlichung und der monarchischen Unterordnung ergeben sich auch hier
die untersten Einheiten, die »rhythmischen Formelemente« (Versfüße), die für sich
und in ihrer Stellung im Versganzen betrachtet werden. Ästhetisch wird der Rhythmus
wiederum erst durch die Einfühlung unserer inneren Tätigkeit. Diese ist jedoch
nicht ein bloßes Geschehen, wie es der regelmäßigen Folge der Versfüße entsprechen
würde, sondern eben ein Tun, das sich innerlich differenziert, sich in der Spannung
mit einer Gegentätigkeit und in der Lösung dieser Spannung auslebt. Im Rhythmus
kann dieser Wechsel von Spannung und Lösung naturgemäß nur im Nacheinander
der Zeit entstehen. Dementsprechend hat eine »rhythmische Bewegungseinheit«
mindestens zwei Hauptbetonungen: der Spannung entspricht der Hoch-, der Lösung
solche im Nebeneinander unterschieden, ferner eine »despotische« und eine »freie«
monarchische Unterordnung. Diese ganze Analyse ist ungemein interessant und
aufklärend, ebenso was weiterhin über die »monarchische Unterordnung und das
ästhetische Ganze«, vornehmlich über das Verhältnis der Masse zu den herrschenden
Elementen in den verschiedenen Stilarten gesagt wird.
Stellt das Bisherige auf Grund der hypothetischen »Natur der Seele« die Haupt-
eigenschaften des ästhetischen Objekts fest, so untersucht der II. Abschnitt »Der
Mensch und die Naturdinge« das lebendige ästhetische Verhalten der Psyche.
Gegenstand des ästhetischen Genusses wird das Objekt erst dadurch, daß das Ge-
fühl der kraftvollen, mannigfaltigen und in sich einstimmigen Tätigkeit, das »Selbst-
wertgefühl« und das »Sichausleben« desselben, das der Gegenstand in uns veranlaßt,
auf denselben bezogen, »objektiviert«, »eingefühlt« wird. Bei der näheren Dar-
legung der Einfühlung beginnt der Verfasser mit den menschlichen Ausdrucks-
bewegungen, geht dann über zu den ruhenden Formen des menschlichen Körpers,
von da zu den Tieren und zu den »Lebensäußerungen des Unbelebten«, endlich
zur »Vermenschlichung« der Dinge und Vorgänge, die für uns die »Naturkräfte«
entstehen läßt. Bei alledem wird neben dem Anteil an der Einfühlung, der auf
ursprünglichen Veranlagungen beruht, bestehe er nun in dem instinktiven Verständ-
nis der Ausdrucksbewegungen oder in der allgemeinen apperzeptiven Einfühlung,
stets der Beitrag der Erfahrung gewürdigt, stellenweise, wie mir scheint, zu sehr
gegenüber der entschiedenen Ablehnung der Erfahrungsassoziation im I. Abschnitt.
— Wir fühlen aber nicht nur die durch Bewegungen, Lautäußerungen und Formen
der Außendinge in uns veranlaßte einzelne Reaktion ein, sondern damit zugleich
die gesamte innere Zuständlichkeit, an welche die einzelne Reaktion gebunden ist.
Dadurch werden die Dinge für uns zu »Individuen« und »Charakteren«.
Der III. Abschnitt behandelt die »Raumästhetik«. Die geometrischen Formen
werden von uns in der sukzessiven Auffassung als mechanisch entstehend inter-
pretiert. Die mechanische Gesetzmäßigkeit, die wir aus der Erfahrung, letzten Endes
aus der an unserem eigenen Körper, kennen, nicht aber die Regelmäßigkeit der Formen,
bedingt ihre ästhetische Wohlgefälligkeit. Ästhetisch wird aber auch die Form erst
dadurch, daß wir die allgemeine und die durch Erfahrung bestimmte apperzeptive
Tätigkeit einfühlen. Damit wandelt sich die mechanische Gesetzmäßigkeit der Form
in innere Freiheit eines Individuums. Was der Verfasser weiter über Stilisierung,
über Verbindung und Gliederung der Raumformen, über Gleichgewicht und Be-
wegung an der Hand von Beispielen aus der Architektur ausführt, und wie er dabei
die aus dem ersten Abschnitt bekannten ästhetischen Formprinzipien fruchtbar macht,
das ist sehr instruktiv; es kann hier aber nicht näher darauf eingegangen werden.
Wie hier die ästhetische Bedeutung der bloßen Raumformen, so wird im
IV. Abschnitt, »Der Rhythmus« überschrieben, die ästhetische Wirksamkeit
der abstrakten Zeitformen untersucht. Aus den Formprinzipien der Differenzierung
und Vereinheitlichung und der monarchischen Unterordnung ergeben sich auch hier
die untersten Einheiten, die »rhythmischen Formelemente« (Versfüße), die für sich
und in ihrer Stellung im Versganzen betrachtet werden. Ästhetisch wird der Rhythmus
wiederum erst durch die Einfühlung unserer inneren Tätigkeit. Diese ist jedoch
nicht ein bloßes Geschehen, wie es der regelmäßigen Folge der Versfüße entsprechen
würde, sondern eben ein Tun, das sich innerlich differenziert, sich in der Spannung
mit einer Gegentätigkeit und in der Lösung dieser Spannung auslebt. Im Rhythmus
kann dieser Wechsel von Spannung und Lösung naturgemäß nur im Nacheinander
der Zeit entstehen. Dementsprechend hat eine »rhythmische Bewegungseinheit«
mindestens zwei Hauptbetonungen: der Spannung entspricht der Hoch-, der Lösung