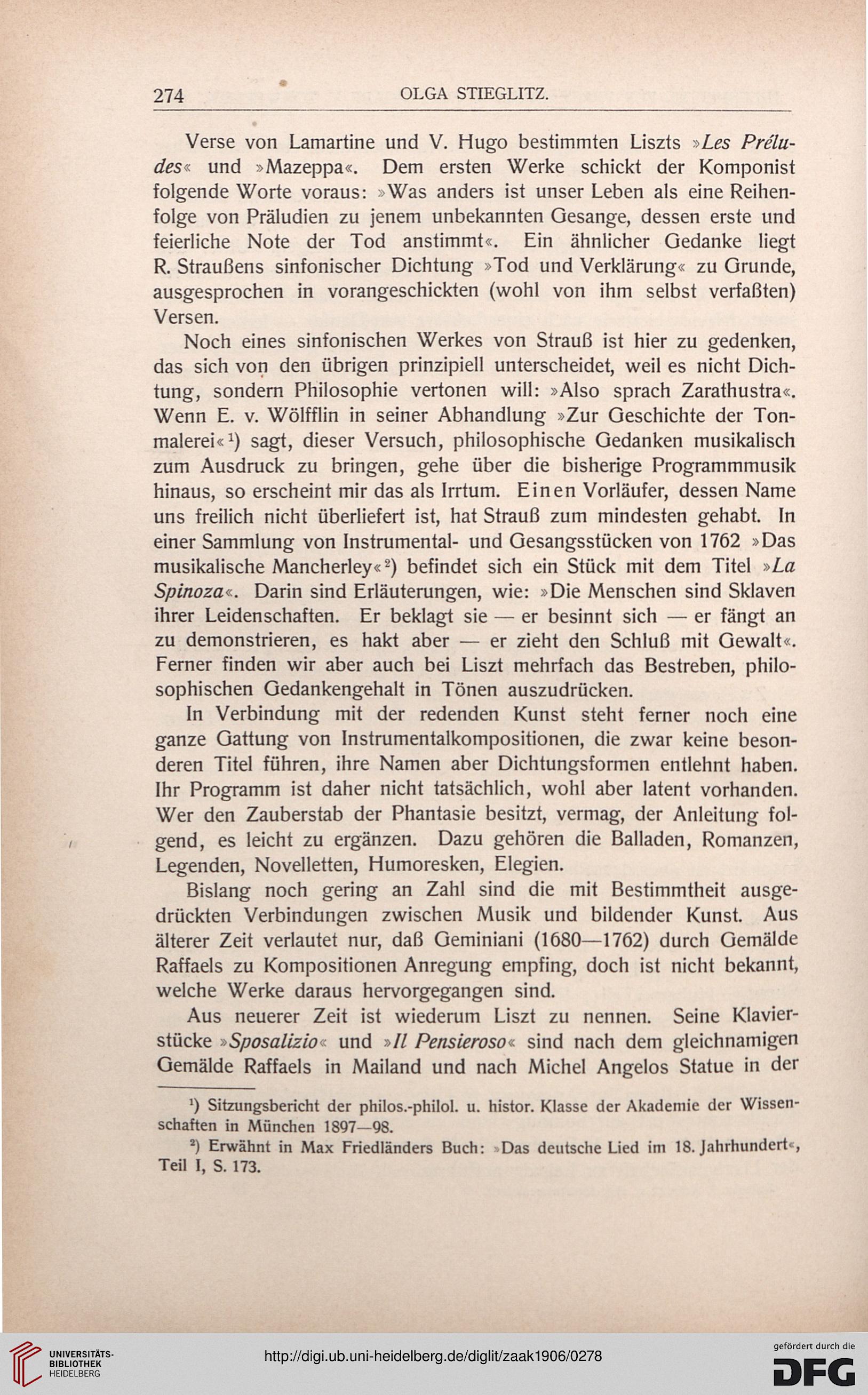274 OLGA STIEGLITZ.
Verse von Lamartine und V. Hugo bestimmten Liszts »Les Prelu-
des< und »Mazeppa«. Dem ersten Werke schickt der Komponist
folgende Worte voraus: »Was anders ist unser Leben als eine Reihen-
folge von Präludien zu jenem unbekannten Gesänge, dessen erste und
feierliche Note der Tod anstimmt«. Ein ähnlicher Gedanke liegt
R. Straußens sinfonischer Dichtung »Tod und Verklärung« zu Grunde,
ausgesprochen in vorangeschickten (wohl von ihm selbst verfaßten)
Versen.
Noch eines sinfonischen Werkes von Strauß ist hier zu gedenken,
das sich von den übrigen prinzipiell unterscheidet, weil es nicht Dich-
tung, sondern Philosophie vertonen will: »Also sprach Zarathustra«.
Wenn E. v. Wölfflin in seiner Abhandlung »Zur Geschichte der Ton-
malerei«1) sagt, dieser Versuch, philosophische Gedanken musikalisch
zum Ausdruck zu bringen, gehe über die bisherige Programmmusik
hinaus, so erscheint mir das als Irrtum. Einen Vorläufer, dessen Name
uns freilich nicht überliefert ist, hat Strauß zum mindesten gehabt. In
einer Sammlung von Instrumental- und Gesangsstücken von 1762 »Das
musikalische Mancherley«2) befindet sich ein Stück mit dem Titel »La
Spinoza«. Darin sind Erläuterungen, wie: »Die Menschen sind Sklaven
ihrer Leidenschaften. Er beklagt sie — er besinnt sich — er fängt an
zu demonstrieren, es hakt aber — er zieht den Schluß mit Gewalt«.
Ferner finden wir aber auch bei Liszt mehrfach das Bestreben, philo-
sophischen Gedankengehalt in Tönen auszudrücken.
In Verbindung mit der redenden Kunst steht ferner noch eine
ganze Gattung von Instrumentalkompositionen, die zwar keine beson-
deren Titel führen, ihre Namen aber Dichtungsformen entlehnt haben.
Ihr Programm ist daher nicht tatsächlich, wohl aber latent vorhanden.
Wer den Zauberstab der Phantasie besitzt, vermag, der Anleitung fol-
gend, es leicht zu ergänzen. Dazu gehören die Balladen, Romanzen,
Legenden, Novelletten, Humoresken, Elegien.
Bislang noch gering an Zahl sind die mit Bestimmtheit ausge-
drückten Verbindungen zwischen Musik und bildender Kunst. Aus
älterer Zeit verlautet nur, daß Geminiani (1680—1762) durch Gemälde
Raffaels zu Kompositionen Anregung empfing, doch ist nicht bekannt,
welche Werke daraus hervorgegangen sind.
Aus neuerer Zeit ist wiederum Liszt zu nennen. Seine Klavier-
stücke »Sposalizio« und »II Pensieroso« sind nach dem gleichnamigen
Gemälde Raffaels in Mailand und nach Michel Angelos Statue in der
') Sitzungsbericht der philos.-philol. u. histor. Klasse der Akademie der Wissen-
schaften in München 1897—98.
2) Erwähnt in Max Friedländers Buch: Das deutsche Lied im 18. Jahrhunderts
Teil I, S. 173.