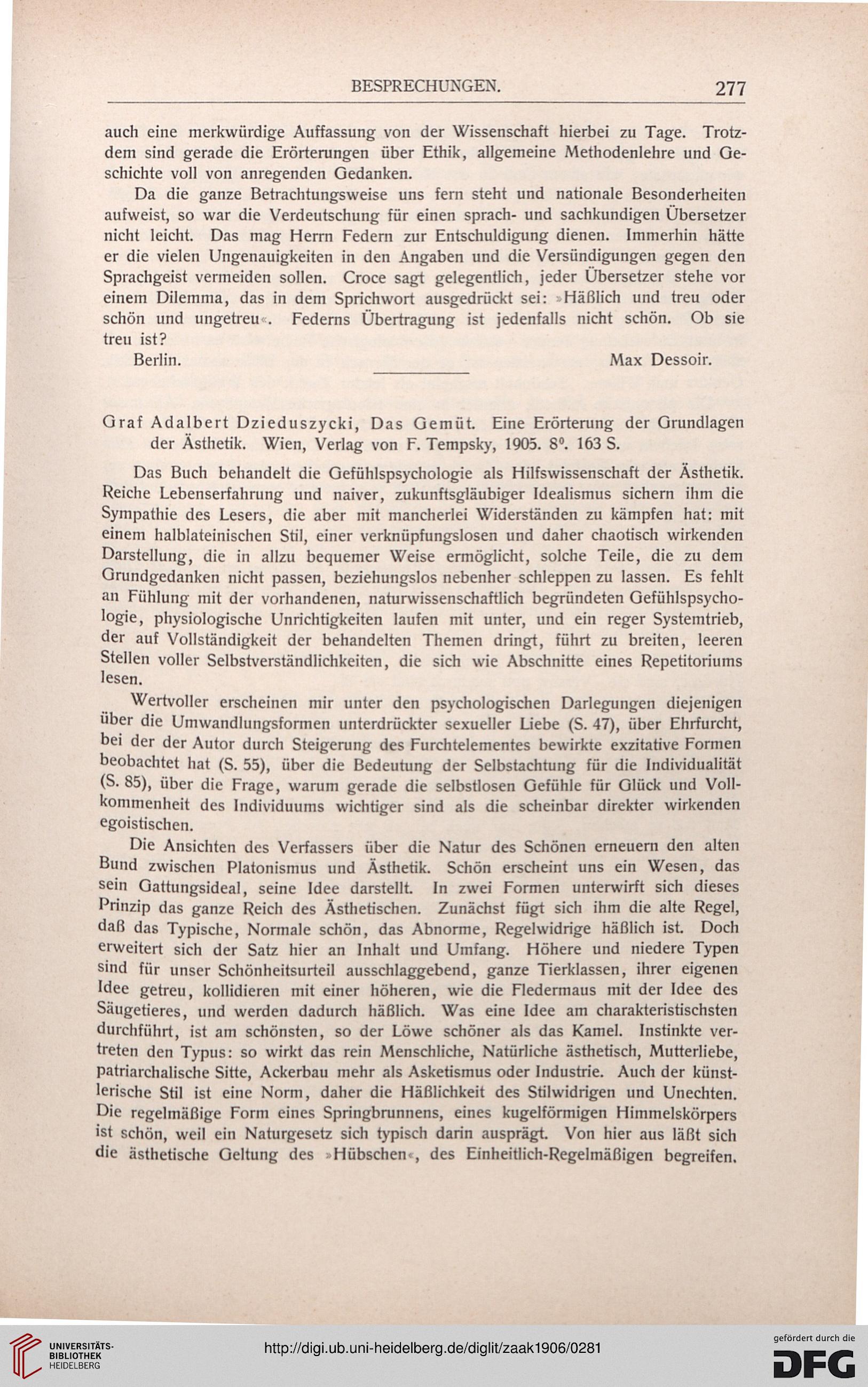BESPRECHUNGEN. 277
auch eine merkwürdige Auffassung von der Wissenschaft hierbei zu Tage. Trotz-
dem sind gerade die Erörterungen über Ethik, allgemeine Methodenlehre und Ge-
schichte voll von anregenden Gedanken.
Da die ganze Betrachtungsweise uns fern steht und nationale Besonderheiten
aufweist, so war die Verdeutschung für einen sprach- und sachkundigen Übersetzer
nicht leicht. Das mag Herrn Federn zur Entschuldigung dienen. Immerhin hätte
er die vielen Ungenauigkeiten in den Angaben und die Versündigungen gegen den
Sprachgeist vermeiden sollen. Croce sagt gelegentlich, jeder Übersetzer stehe vor
einem Dilemma, das in dem Sprichwort ausgedrückt sei: Häßlich und treu oder
schön und ungetreu. Federns Übertragung ist jedenfalls nicht schön. Ob sie
treu ist?
Berlin. Max Dessoir.
Graf Adalbert Dzieduszycki, Das Gemüt. Eine Erörterung der Grundlagen
der Ästhetik. Wien, Verlag von F. Tempsky, 1905. 8°. 163 S.
Das Buch behandelt die Gefühlspsychologie als Hilfswissenschaft der Ästhetik.
Reiche Lebenserfahrung und naiver, zukunftsgläubiger Idealismus sichern ihm die
Sympathie des Lesers, die aber mit mancherlei Widerständen zu kämpfen hat: mit
einem halblateinischen Stil, einer verknüpfungslosen und daher chaotisch wirkenden
Darstellung, die in allzu bequemer Weise ermöglicht, solche Teile, die zu dem
Grundgedanken nicht passen, beziehungslos nebenher schleppen zu lassen. Es fehlt
an Fühlung mit der vorhandenen, naturwissenschaftlich begründeten Gefühlspsycho-
logie, physiologische Unrichtigkeiten laufen mit unter, und ein reger Systemtrieb,
der auf Vollständigkeit der behandelten Themen dringt, führt zu breiten, leeren
Stellen voller Selbstverständlichkeiten, die sich wie Abschnitte eines Repetitoriums
lesen.
Wertvoller erscheinen mir unter den psychologischen Darlegungen diejenigen
über die Umwandlungsformen unterdrückter sexueller Liebe (S. 47), über Ehrfurcht,
bei der der Autor durch Steigerung des Furchtelementes bewirkte exzitative Formen
beobachtet hat (S. 55), über die Bedeutung der Selbstachtung für die Individualität
(S. 85), über die Frage, warum gerade die selbstlosen Gefühle für Glück und Voll-
kommenheit des Individuums wichtiger sind als die scheinbar direkter wirkenden
egoistischen.
Die Ansichten des Verfassers über die Natur des Schönen erneuern den alten
Bund zwischen Piatonismus und Ästhetik. Schön erscheint uns ein Wesen, das
sein Gattungsideal, seine Idee darstellt. In zwei Formen unterwirft sich dieses
Prinzip das ganze Reich des Ästhetischen. Zunächst fügt sich ihm die alte Regel,
daß das Typische, Normale schön, das Abnorme, Regelwidrige häßlich ist. Doch
erweitert sich der Satz hier an Inhalt und Umfang. Höhere und niedere Typen
sind für unser Schönheitsurteil ausschlaggebend, ganze Tierklassen, ihrer eigenen
Idee getreu, kollidieren mit einer höheren, wie die Fledermaus mit der Idee des
Säugetieres, und werden dadurch häßlich. Was eine Idee am charakteristischsten
durchführt, ist am schönsten, so der Löwe schöner als das Kamel. Instinkte ver-
treten den Typus: so wirkt das rein Menschliche, Natürliche ästhetisch, Mutterliebe,
patriarchalische Sitte, Ackerbau mehr als Asketismus oder Industrie. Auch der künst-
lerische Stil ist eine Norm, daher die Häßlichkeit des Stilwidrigen und Unechten.
Die regelmäßige Form eines Springbrunnens, eines kugelförmigen Himmelskörpers
ist schön, weil ein Naturgesetz sich typisch darin ausprägt. Von hier aus läßt sich
die ästhetische Geltung des Hübschen-, des Einheitlich-Regelmäßigen begreifen.
auch eine merkwürdige Auffassung von der Wissenschaft hierbei zu Tage. Trotz-
dem sind gerade die Erörterungen über Ethik, allgemeine Methodenlehre und Ge-
schichte voll von anregenden Gedanken.
Da die ganze Betrachtungsweise uns fern steht und nationale Besonderheiten
aufweist, so war die Verdeutschung für einen sprach- und sachkundigen Übersetzer
nicht leicht. Das mag Herrn Federn zur Entschuldigung dienen. Immerhin hätte
er die vielen Ungenauigkeiten in den Angaben und die Versündigungen gegen den
Sprachgeist vermeiden sollen. Croce sagt gelegentlich, jeder Übersetzer stehe vor
einem Dilemma, das in dem Sprichwort ausgedrückt sei: Häßlich und treu oder
schön und ungetreu. Federns Übertragung ist jedenfalls nicht schön. Ob sie
treu ist?
Berlin. Max Dessoir.
Graf Adalbert Dzieduszycki, Das Gemüt. Eine Erörterung der Grundlagen
der Ästhetik. Wien, Verlag von F. Tempsky, 1905. 8°. 163 S.
Das Buch behandelt die Gefühlspsychologie als Hilfswissenschaft der Ästhetik.
Reiche Lebenserfahrung und naiver, zukunftsgläubiger Idealismus sichern ihm die
Sympathie des Lesers, die aber mit mancherlei Widerständen zu kämpfen hat: mit
einem halblateinischen Stil, einer verknüpfungslosen und daher chaotisch wirkenden
Darstellung, die in allzu bequemer Weise ermöglicht, solche Teile, die zu dem
Grundgedanken nicht passen, beziehungslos nebenher schleppen zu lassen. Es fehlt
an Fühlung mit der vorhandenen, naturwissenschaftlich begründeten Gefühlspsycho-
logie, physiologische Unrichtigkeiten laufen mit unter, und ein reger Systemtrieb,
der auf Vollständigkeit der behandelten Themen dringt, führt zu breiten, leeren
Stellen voller Selbstverständlichkeiten, die sich wie Abschnitte eines Repetitoriums
lesen.
Wertvoller erscheinen mir unter den psychologischen Darlegungen diejenigen
über die Umwandlungsformen unterdrückter sexueller Liebe (S. 47), über Ehrfurcht,
bei der der Autor durch Steigerung des Furchtelementes bewirkte exzitative Formen
beobachtet hat (S. 55), über die Bedeutung der Selbstachtung für die Individualität
(S. 85), über die Frage, warum gerade die selbstlosen Gefühle für Glück und Voll-
kommenheit des Individuums wichtiger sind als die scheinbar direkter wirkenden
egoistischen.
Die Ansichten des Verfassers über die Natur des Schönen erneuern den alten
Bund zwischen Piatonismus und Ästhetik. Schön erscheint uns ein Wesen, das
sein Gattungsideal, seine Idee darstellt. In zwei Formen unterwirft sich dieses
Prinzip das ganze Reich des Ästhetischen. Zunächst fügt sich ihm die alte Regel,
daß das Typische, Normale schön, das Abnorme, Regelwidrige häßlich ist. Doch
erweitert sich der Satz hier an Inhalt und Umfang. Höhere und niedere Typen
sind für unser Schönheitsurteil ausschlaggebend, ganze Tierklassen, ihrer eigenen
Idee getreu, kollidieren mit einer höheren, wie die Fledermaus mit der Idee des
Säugetieres, und werden dadurch häßlich. Was eine Idee am charakteristischsten
durchführt, ist am schönsten, so der Löwe schöner als das Kamel. Instinkte ver-
treten den Typus: so wirkt das rein Menschliche, Natürliche ästhetisch, Mutterliebe,
patriarchalische Sitte, Ackerbau mehr als Asketismus oder Industrie. Auch der künst-
lerische Stil ist eine Norm, daher die Häßlichkeit des Stilwidrigen und Unechten.
Die regelmäßige Form eines Springbrunnens, eines kugelförmigen Himmelskörpers
ist schön, weil ein Naturgesetz sich typisch darin ausprägt. Von hier aus läßt sich
die ästhetische Geltung des Hübschen-, des Einheitlich-Regelmäßigen begreifen.