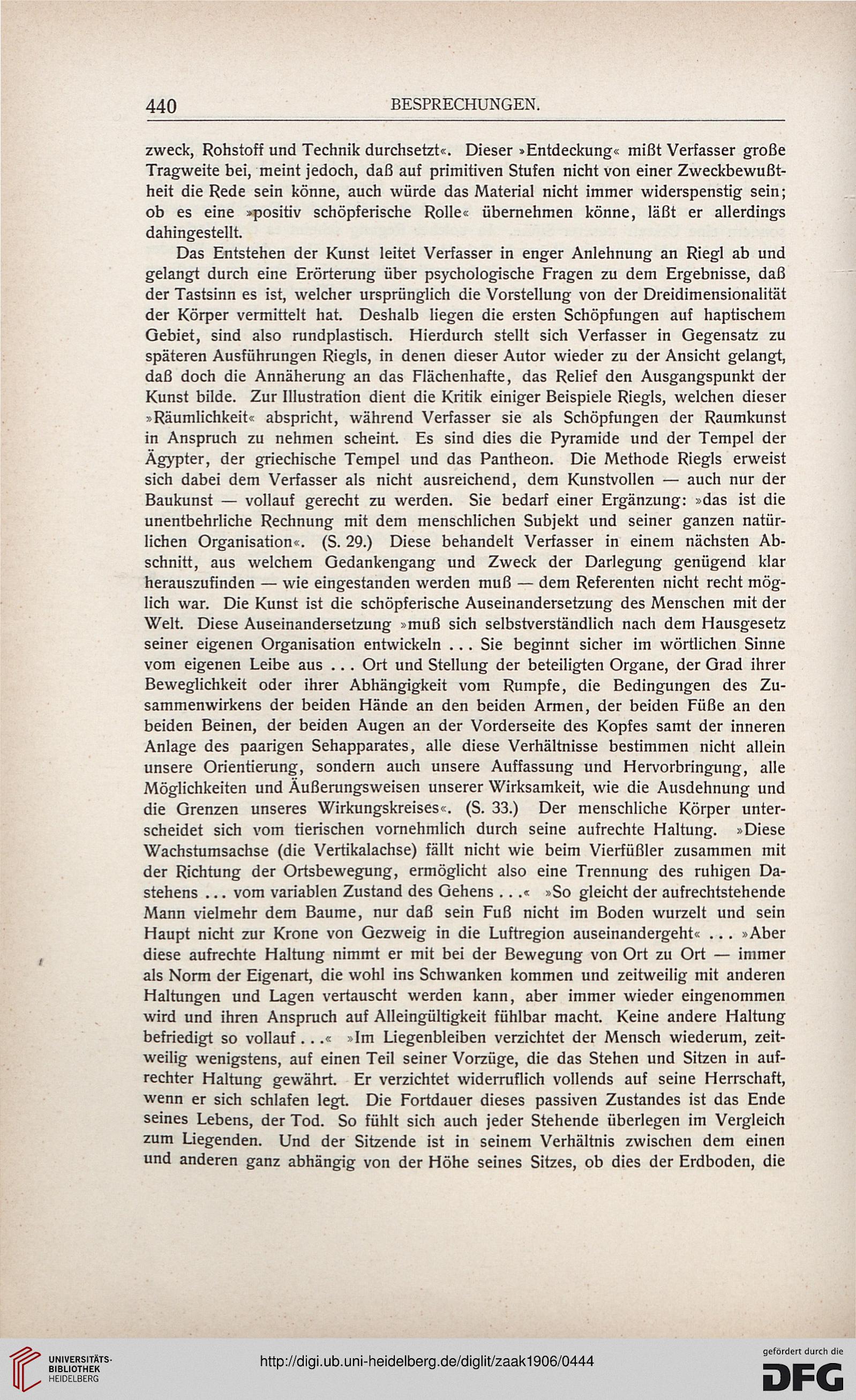440 BESPRECHUNGEN.
zweck, Rohstoff und Technik durchsetzt«. Dieser »Entdeckung« mißt Verfasser große
Tragweite bei, meint jedoch, daß auf primitiven Stufen nicht von einer Zweckbewußt-
heit die Rede sein könne, auch würde das Material nicht immer widerspenstig sein;
ob es eine »positiv schöpferische Rolle« übernehmen könne, läßt er allerdings
dahingestellt.
Das Entstehen der Kunst leitet Verfasser in enger Anlehnung an Riegl ab und
gelangt durch eine Erörterung über psychologische Fragen zu dem Ergebnisse, daß
der Tastsinn es ist, welcher ursprünglich die Vorstellung von der Dreidimensionalität
der Körper vermittelt hat. Deshalb liegen die ersten Schöpfungen auf haptischem
Gebiet, sind also rundplastisch. Hierdurch stellt sich Verfasser in Gegensatz zu
späteren Ausführungen Riegls, in denen dieser Autor wieder zu der Ansicht gelangt,
daß doch die Annäherung an das Flächenhafte, das Relief den Ausgangspunkt der
Kunst bilde. Zur Illustration dient die Kritik einiger Beispiele Riegls, welchen dieser
»Räumlichkeit« abspricht, während Verfasser sie als Schöpfungen der Raumkunst
in Anspruch zu nehmen scheint. Es sind dies die Pyramide und der Tempel der
Ägypter, der griechische Tempel und das Pantheon. Die Methode Riegls erweist
sich dabei dem Verfasser als nicht ausreichend, dem Kunstvollen — auch nur der
Baukunst — vollauf gerecht zu werden. Sie bedarf einer Ergänzung: »das ist die
unentbehrliche Rechnung mit dem menschlichen Subjekt und seiner ganzen natür-
lichen Organisation«. (S. 29.) Diese behandelt Verfasser in einem nächsten Ab-
schnitt, aus welchem Gedankengang und Zweck der Darlegung genügend klar
herauszufinden — wie eingestanden werden muß — dem Referenten nicht recht mög-
lich war. Die Kunst ist die schöpferische Auseinandersetzung des Menschen mit der
Welt. Diese Auseinandersetzung »muß sich selbstverständlich nach dem Hausgesetz
seiner eigenen Organisation entwickeln .. . Sie beginnt sicher im wörtlichen Sinne
vom eigenen Leibe aus .. . Ort und Stellung der beteiligten Organe, der Grad ihrer
Beweglichkeit oder ihrer Abhängigkeit vom Rumpfe, die Bedingungen des Zu-
sammenwirkens der beiden Hände an den beiden Armen, der beiden Füße an den
beiden Beinen, der beiden Augen an der Vorderseite des Kopfes samt der inneren
Anlage des paarigen Sehapparates, alle diese Verhältnisse bestimmen nicht allein
unsere Orientierung, sondern auch unsere Auffassung und Hervorbringung, alle
Möglichkeiten und Äußerungsweisen unserer Wirksamkeit, wie die Ausdehnung und
die Grenzen unseres Wirkungskreises«. (S. 33.) Der menschliche Körper unter-
scheidet sich vom tierischen vornehmlich durch seine aufrechte Haltung. »Diese
Wachstumsachse (die Vertikalachse) fällt nicht wie beim Vierfüßler zusammen mit
der Richtung der Ortsbewegung, ermöglicht also eine Trennung des ruhigen Da-
stehens ... vom variablen Zustand des Gehens ...« »So gleicht der aufrechtstehende
Mann vielmehr dem Baume, nur daß sein Fuß nicht im Boden wurzelt und sein
Haupt nicht zur Krone von Gezweig in die Luftregion auseinandergeht« ... »Aber
diese aufrechte Haltung nimmt er mit bei der Bewegung von Ort zu Ort — immer
als Norm der Eigenart, die wohl ins Schwanken kommen und zeitweilig mit anderen
Haltungen und Lagen vertauscht werden kann, aber immer wieder eingenommen
wird und ihren Anspruch auf Alleingültigkeit fühlbar macht. Keine andere Haltung
befriedigt so vollauf...« »Im Liegenbleiben verzichtet der Mensch wiederum, zeit-
weilig wenigstens, auf einen Teil seiner Vorzüge, die das Stehen und Sitzen in auf-
rechter Haltung gewährt. Er verzichtet widerruflich vollends auf seine Herrschaft,
wenn er sich schlafen legt. Die Fortdauer dieses passiven Zustandes ist das Ende
seines Lebens, der Tod. So fühlt sich auch jeder Stehende überlegen im Vergleich
zum Liegenden. Und der Sitzende ist in seinem Verhältnis zwischen dem einen
und anderen ganz abhängig von der Höhe seines Sitzes, ob dies der Erdboden, die
zweck, Rohstoff und Technik durchsetzt«. Dieser »Entdeckung« mißt Verfasser große
Tragweite bei, meint jedoch, daß auf primitiven Stufen nicht von einer Zweckbewußt-
heit die Rede sein könne, auch würde das Material nicht immer widerspenstig sein;
ob es eine »positiv schöpferische Rolle« übernehmen könne, läßt er allerdings
dahingestellt.
Das Entstehen der Kunst leitet Verfasser in enger Anlehnung an Riegl ab und
gelangt durch eine Erörterung über psychologische Fragen zu dem Ergebnisse, daß
der Tastsinn es ist, welcher ursprünglich die Vorstellung von der Dreidimensionalität
der Körper vermittelt hat. Deshalb liegen die ersten Schöpfungen auf haptischem
Gebiet, sind also rundplastisch. Hierdurch stellt sich Verfasser in Gegensatz zu
späteren Ausführungen Riegls, in denen dieser Autor wieder zu der Ansicht gelangt,
daß doch die Annäherung an das Flächenhafte, das Relief den Ausgangspunkt der
Kunst bilde. Zur Illustration dient die Kritik einiger Beispiele Riegls, welchen dieser
»Räumlichkeit« abspricht, während Verfasser sie als Schöpfungen der Raumkunst
in Anspruch zu nehmen scheint. Es sind dies die Pyramide und der Tempel der
Ägypter, der griechische Tempel und das Pantheon. Die Methode Riegls erweist
sich dabei dem Verfasser als nicht ausreichend, dem Kunstvollen — auch nur der
Baukunst — vollauf gerecht zu werden. Sie bedarf einer Ergänzung: »das ist die
unentbehrliche Rechnung mit dem menschlichen Subjekt und seiner ganzen natür-
lichen Organisation«. (S. 29.) Diese behandelt Verfasser in einem nächsten Ab-
schnitt, aus welchem Gedankengang und Zweck der Darlegung genügend klar
herauszufinden — wie eingestanden werden muß — dem Referenten nicht recht mög-
lich war. Die Kunst ist die schöpferische Auseinandersetzung des Menschen mit der
Welt. Diese Auseinandersetzung »muß sich selbstverständlich nach dem Hausgesetz
seiner eigenen Organisation entwickeln .. . Sie beginnt sicher im wörtlichen Sinne
vom eigenen Leibe aus .. . Ort und Stellung der beteiligten Organe, der Grad ihrer
Beweglichkeit oder ihrer Abhängigkeit vom Rumpfe, die Bedingungen des Zu-
sammenwirkens der beiden Hände an den beiden Armen, der beiden Füße an den
beiden Beinen, der beiden Augen an der Vorderseite des Kopfes samt der inneren
Anlage des paarigen Sehapparates, alle diese Verhältnisse bestimmen nicht allein
unsere Orientierung, sondern auch unsere Auffassung und Hervorbringung, alle
Möglichkeiten und Äußerungsweisen unserer Wirksamkeit, wie die Ausdehnung und
die Grenzen unseres Wirkungskreises«. (S. 33.) Der menschliche Körper unter-
scheidet sich vom tierischen vornehmlich durch seine aufrechte Haltung. »Diese
Wachstumsachse (die Vertikalachse) fällt nicht wie beim Vierfüßler zusammen mit
der Richtung der Ortsbewegung, ermöglicht also eine Trennung des ruhigen Da-
stehens ... vom variablen Zustand des Gehens ...« »So gleicht der aufrechtstehende
Mann vielmehr dem Baume, nur daß sein Fuß nicht im Boden wurzelt und sein
Haupt nicht zur Krone von Gezweig in die Luftregion auseinandergeht« ... »Aber
diese aufrechte Haltung nimmt er mit bei der Bewegung von Ort zu Ort — immer
als Norm der Eigenart, die wohl ins Schwanken kommen und zeitweilig mit anderen
Haltungen und Lagen vertauscht werden kann, aber immer wieder eingenommen
wird und ihren Anspruch auf Alleingültigkeit fühlbar macht. Keine andere Haltung
befriedigt so vollauf...« »Im Liegenbleiben verzichtet der Mensch wiederum, zeit-
weilig wenigstens, auf einen Teil seiner Vorzüge, die das Stehen und Sitzen in auf-
rechter Haltung gewährt. Er verzichtet widerruflich vollends auf seine Herrschaft,
wenn er sich schlafen legt. Die Fortdauer dieses passiven Zustandes ist das Ende
seines Lebens, der Tod. So fühlt sich auch jeder Stehende überlegen im Vergleich
zum Liegenden. Und der Sitzende ist in seinem Verhältnis zwischen dem einen
und anderen ganz abhängig von der Höhe seines Sitzes, ob dies der Erdboden, die