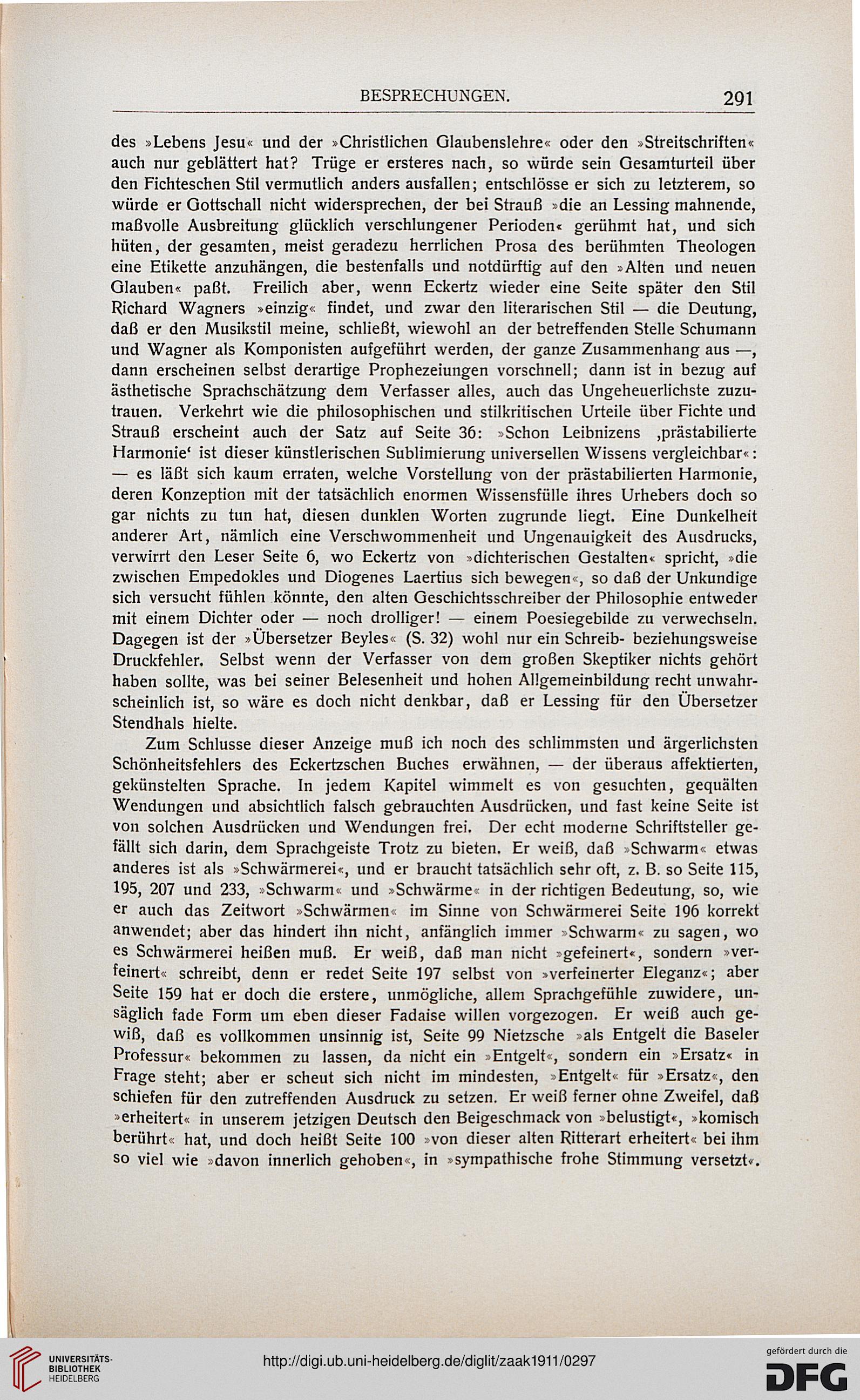BESPRECHUNGEN. 2Q1
des »Lebens Jesu« und der »Christlichen Glaubenslehre« oder den »Streitschriften«
auch nur geblättert hat? Trüge er ersteres nach, so würde sein Gesamturteil über
den Fichteschen Stil vermutlich anders ausfallen; entschlösse er sich zu letzterem, so
würde er Gottschall nicht widersprechen, der bei Strauß »die an Lessing mahnende,
maßvolle Ausbreitung glücklich verschlungener Perioden« gerühmt hat, und sich
hüten, der gesamten, meist geradezu herrlichen Prosa des berühmten Theologen
eine Etikette anzuhängen, die bestenfalls und notdürftig auf den »Alten und neuen
Glauben« paßt. Freilich aber, wenn Eckertz wieder eine Seite später den Stil
Richard Wagners »einzig« findet, und zwar den literarischen Stil — die Deutung,
daß er den Musikstil meine, schließt, wiewohl an der betreffenden Stelle Schumann
und Wagner als Komponisten aufgeführt werden, der ganze Zusammenhang aus —,
dann erscheinen selbst derartige Prophezeiungen vorschnell; dann ist in bezug auf
ästhetische Sprachschätzung dem Verfasser alles, auch das Ungeheuerlichste zuzu-
trauen. Verkehrt wie die philosophischen und stilkritischen Urteile über Fichte und
Strauß erscheint auch der Satz auf Seite 36: »Schon Leibnizens ,prästabilierte
Harmonie' ist dieser künstlerischen Sublimierung universellen Wissens vergleichbar«:
— es läßt sich kaum erraten, welche Vorstellung von der prästabilierten Harmonie,
deren Konzeption mit der tatsächlich enormen Wissensfülle ihres Urhebers doch so
gar nichts zu tun hat, diesen dunklen Worten zugrunde liegt. Eine Dunkelheit
anderer Art, nämlich eine Verschwommenheit und Ungenauigkeit des Ausdrucks,
verwirrt den Leser Seite 6, wo Eckertz von »dichterischen Gestalten« spricht, »die
zwischen Empedokles und Diogenes Laertius sich bewegen«, so daß der Unkundige
sich versucht fühlen könnte, den alten Geschichtsschreiber der Philosophie entweder
mit einem Dichter oder — noch drolliger! — einem Poesiegebilde zu verwechseln.
Dagegen ist der »Übersetzer Beyles« (S. 32) wohl nur ein Schreib- beziehungsweise
Druckfehler. Selbst wenn der Verfasser von dem großen Skeptiker nichts gehört
haben sollte, was bei seiner Belesenheit und hohen Allgemeinbildung recht unwahr-
scheinlich ist, so wäre es doch nicht denkbar, daß er Lessing für den Übersetzer
Stendhals hielte.
Zum Schlüsse dieser Anzeige muß ich noch des schlimmsten und ärgerlichsten
Schönheitsfehlers des Eckertzschen Buches erwähnen, — der überaus affektierten,
gekünstelten Sprache. In jedem Kapitel wimmelt es von gesuchten, gequälten
Wendungen und absichtlich falsch gebrauchten Ausdrücken, und fast keine Seite ist
von solchen Ausdrücken und Wendungen frei. Der echt moderne Schriftsteller ge-
fällt sich darin, dem Sprachgeiste Trotz zu bieten. Er weiß, daß »Schwärm« etwas
anderes ist als »Schwärmerei«, und er braucht tatsächlich sehr oft, z. B. so Seite 115,
195, 207 und 233, Schwärm« und »Schwärme in der richtigen Bedeutung, so, wie
er auch das Zeitwort »Schwärmen im Sinne von Schwärmerei Seite 196 korrekt
anwendet; aber das hindert ihn nicht, anfänglich immer Schwärm« zu sagen, wo
es Schwärmerei heißen muß. Er weiß, daß man nicht »gefeinert«, sondern »ver-
feinert« schreibt, denn er redet Seite 197 selbst von »verfeinerter Eleganz«; aber
Seite 159 hat er doch die erstere, unmögliche, allem Sprachgefühle zuwidere, un-
säglich fade Form um eben dieser Fadaise willen vorgezogen. Er weiß auch ge-
wiß, daß es vollkommen unsinnig ist, Seite 99 Nietzsche »als Entgelt die Baseler
Professur« bekommen zu lassen, da nicht ein »Entgelt«, sondern ein »Ersatz« in
Frage steht; aber er scheut sich nicht im mindesten, »Entgelt« für »Ersatz«, den
schiefen für den zutreffenden Ausdruck zu setzen. Er weiß ferner ohne Zweifel, daß
-»erheitert« in unserem jetzigen Deutsch den Beigeschmack von »belustigt«, »komisch
berührt« hat, und doch heißt Seite 100 »von dieser alten Ritterart erheitert« bei ihm
so viel wie »davon innerlich gehoben«, in »sympathische frohe Stimmung versetzt«.
des »Lebens Jesu« und der »Christlichen Glaubenslehre« oder den »Streitschriften«
auch nur geblättert hat? Trüge er ersteres nach, so würde sein Gesamturteil über
den Fichteschen Stil vermutlich anders ausfallen; entschlösse er sich zu letzterem, so
würde er Gottschall nicht widersprechen, der bei Strauß »die an Lessing mahnende,
maßvolle Ausbreitung glücklich verschlungener Perioden« gerühmt hat, und sich
hüten, der gesamten, meist geradezu herrlichen Prosa des berühmten Theologen
eine Etikette anzuhängen, die bestenfalls und notdürftig auf den »Alten und neuen
Glauben« paßt. Freilich aber, wenn Eckertz wieder eine Seite später den Stil
Richard Wagners »einzig« findet, und zwar den literarischen Stil — die Deutung,
daß er den Musikstil meine, schließt, wiewohl an der betreffenden Stelle Schumann
und Wagner als Komponisten aufgeführt werden, der ganze Zusammenhang aus —,
dann erscheinen selbst derartige Prophezeiungen vorschnell; dann ist in bezug auf
ästhetische Sprachschätzung dem Verfasser alles, auch das Ungeheuerlichste zuzu-
trauen. Verkehrt wie die philosophischen und stilkritischen Urteile über Fichte und
Strauß erscheint auch der Satz auf Seite 36: »Schon Leibnizens ,prästabilierte
Harmonie' ist dieser künstlerischen Sublimierung universellen Wissens vergleichbar«:
— es läßt sich kaum erraten, welche Vorstellung von der prästabilierten Harmonie,
deren Konzeption mit der tatsächlich enormen Wissensfülle ihres Urhebers doch so
gar nichts zu tun hat, diesen dunklen Worten zugrunde liegt. Eine Dunkelheit
anderer Art, nämlich eine Verschwommenheit und Ungenauigkeit des Ausdrucks,
verwirrt den Leser Seite 6, wo Eckertz von »dichterischen Gestalten« spricht, »die
zwischen Empedokles und Diogenes Laertius sich bewegen«, so daß der Unkundige
sich versucht fühlen könnte, den alten Geschichtsschreiber der Philosophie entweder
mit einem Dichter oder — noch drolliger! — einem Poesiegebilde zu verwechseln.
Dagegen ist der »Übersetzer Beyles« (S. 32) wohl nur ein Schreib- beziehungsweise
Druckfehler. Selbst wenn der Verfasser von dem großen Skeptiker nichts gehört
haben sollte, was bei seiner Belesenheit und hohen Allgemeinbildung recht unwahr-
scheinlich ist, so wäre es doch nicht denkbar, daß er Lessing für den Übersetzer
Stendhals hielte.
Zum Schlüsse dieser Anzeige muß ich noch des schlimmsten und ärgerlichsten
Schönheitsfehlers des Eckertzschen Buches erwähnen, — der überaus affektierten,
gekünstelten Sprache. In jedem Kapitel wimmelt es von gesuchten, gequälten
Wendungen und absichtlich falsch gebrauchten Ausdrücken, und fast keine Seite ist
von solchen Ausdrücken und Wendungen frei. Der echt moderne Schriftsteller ge-
fällt sich darin, dem Sprachgeiste Trotz zu bieten. Er weiß, daß »Schwärm« etwas
anderes ist als »Schwärmerei«, und er braucht tatsächlich sehr oft, z. B. so Seite 115,
195, 207 und 233, Schwärm« und »Schwärme in der richtigen Bedeutung, so, wie
er auch das Zeitwort »Schwärmen im Sinne von Schwärmerei Seite 196 korrekt
anwendet; aber das hindert ihn nicht, anfänglich immer Schwärm« zu sagen, wo
es Schwärmerei heißen muß. Er weiß, daß man nicht »gefeinert«, sondern »ver-
feinert« schreibt, denn er redet Seite 197 selbst von »verfeinerter Eleganz«; aber
Seite 159 hat er doch die erstere, unmögliche, allem Sprachgefühle zuwidere, un-
säglich fade Form um eben dieser Fadaise willen vorgezogen. Er weiß auch ge-
wiß, daß es vollkommen unsinnig ist, Seite 99 Nietzsche »als Entgelt die Baseler
Professur« bekommen zu lassen, da nicht ein »Entgelt«, sondern ein »Ersatz« in
Frage steht; aber er scheut sich nicht im mindesten, »Entgelt« für »Ersatz«, den
schiefen für den zutreffenden Ausdruck zu setzen. Er weiß ferner ohne Zweifel, daß
-»erheitert« in unserem jetzigen Deutsch den Beigeschmack von »belustigt«, »komisch
berührt« hat, und doch heißt Seite 100 »von dieser alten Ritterart erheitert« bei ihm
so viel wie »davon innerlich gehoben«, in »sympathische frohe Stimmung versetzt«.