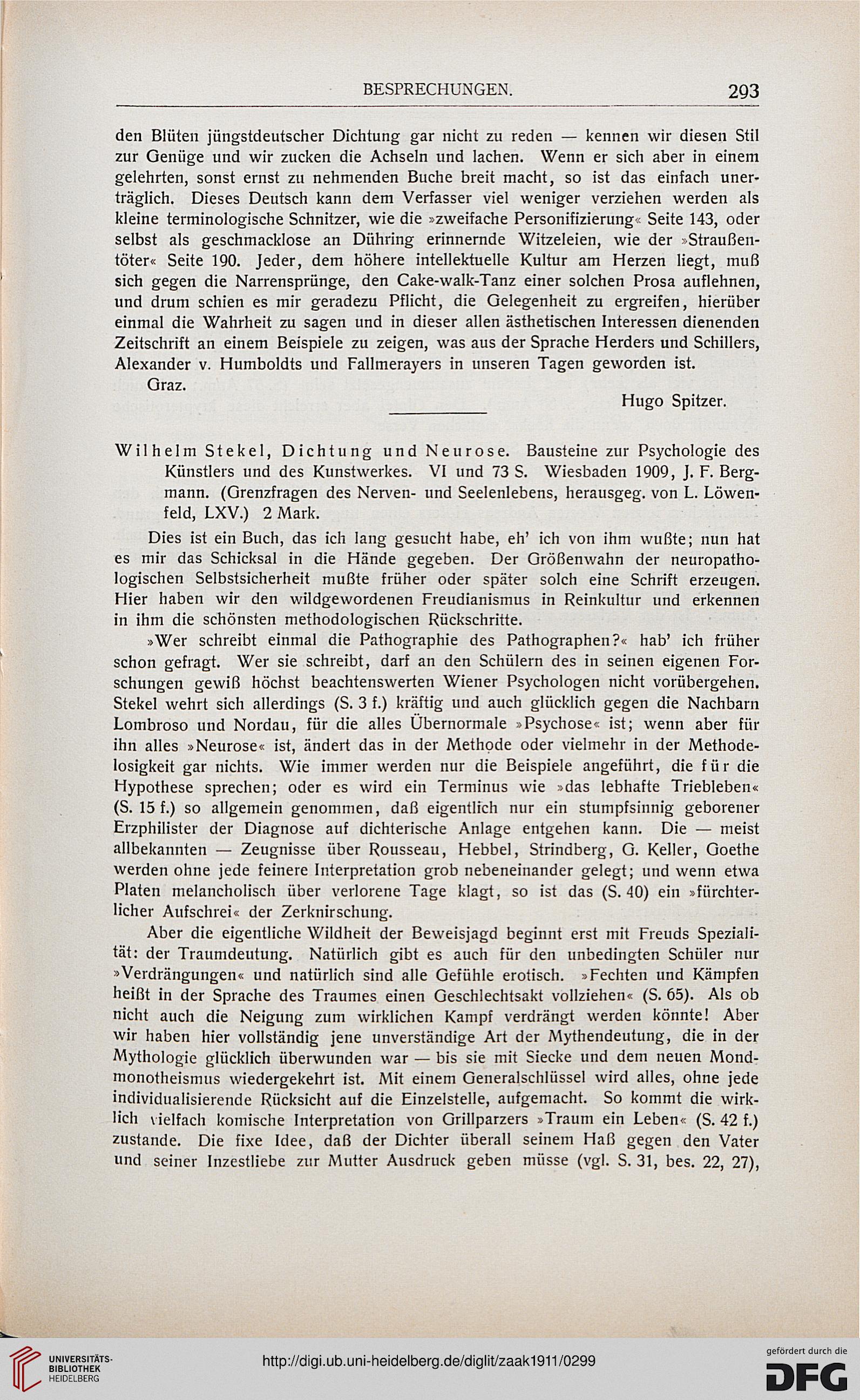BESPRECHUNGEN. 2Q3
den Blüten jüngstdeutscher Dichtung gar nicht zu reden — kennen wir diesen Stil
zur Genüge und wir zucken die Achseln und lachen. Wenn er sich aber in einem
gelehrten, sonst ernst zu nehmenden Buche breit macht, so ist das einfach uner-
träglich. Dieses Deutsch kann dem Verfasser viel weniger verziehen werden als
kleine terminologische Schnitzer, wie die »zweifache Personifizierung Seite 143, oder
selbst als geschmacklose an Dühring erinnernde Witzeleien, wie der »Straußen-
töter« Seite 190. Jeder, dem höhere intellektuelle Kultur am Herzen liegt, muß
sich gegen die Narrensprünge, den Cake-walk-Tanz einer solchen Prosa auflehnen,
und drum schien es mir geradezu Pflicht, die Gelegenheit zu ergreifen, hierüber
einmal die Wahrheit zu sagen und in dieser allen ästhetischen Interessen dienenden
Zeitschrift an einem Beispiele zu zeigen, was aus der Sprache Herders und Schillers,
Alexander v. Humboldts und Fallmerayers in unseren Tagen geworden ist.
Graz.
Hugo Spitzer.
Wilhelm Stekel, Dichtung und Neurose. Bausteine zur Psychologie des
Künstlers und des Kunstwerkes. VI und 73 S. Wiesbaden 1909, J. F. Berg-
mann. (Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, herausgeg. von L. Löwen-
feld, LXV.) 2 Mark.
Dies ist ein Buch, das ich lang gesucht habe, eh' ich von ihm wußte; nun hat
es mir das Schicksal in die Hände gegeben. Der Größenwahn der neuropatho-
logischen Selbstsicherheit mußte früher oder später solch eine Schrift erzeugen.
Hier haben wir den wildgewordenen Freudianismus in Reinkultur und erkennen
in ihm die schönsten methodologischen Rückschritte.
»Wer schreibt einmal die Pathographie des Pathographen?« hab' ich früher
schon gefragt. Wer sie schreibt, darf an den Schülern des in seinen eigenen For-
schungen gewiß höchst beachtenswerten Wiener Psychologen nicht vorübergehen.
Stekel wehrt sich allerdings (S. 3 f.) kräftig und auch glücklich gegen die Nachbarn
Lombroso und Nordau, für die alles Übernormale »Psychose« ist; wenn aber für
ihn alles »Neurose« ist, ändert das in der Methode oder vielmehr in der Methode-
losigkeit gar nichts. Wie immer werden nur die Beispiele angeführt, die für die
Hypothese sprechen; oder es wird ein Terminus wie »das lebhafte Triebleben«
(S. 15 f.) so allgemein genommen, daß eigentlich nur ein stumpfsinnig geborener
Erzphilister der Diagnose auf dichterische Anlage entgehen kann. Die — meist
allbekannten — Zeugnisse über Rousseau, Hebbel, Strindberg, G. Keller, Goethe
werden ohne jede feinere Interpretation grob nebeneinander gelegt; und wenn etwa
Platen melancholisch über verlorene Tage klagt, so ist das (S. 40) ein »fürchter-
licher Aufschrei« der Zerknirschung.
Aber die eigentliche Wildheit der Beweisjagd beginnt erst mit Freuds Speziali-
tät: der Traumdeutung. Natürlich gibt es auch für den unbedingten Schüler nur
»Verdrängungen« und natürlich sind alle Gefühle erotisch. »Fechten und Kämpfen
heißt in der Sprache des Traumes einen Geschlechtsakt vollziehen« (S. 65). Als ob
nicht auch die Neigung zum wirklichen Kampf verdrängt werden könnte! Aber
wir haben hier vollständig jene unverständige Art der Mythendeutung, die in der
Mythologie glücklich überwunden war — bis sie mit Siecke und dem neuen Mond-
monotheismus wiedergekehrt ist. Mit einem Generalschlüssel wird alles, ohne jede
individualisierende Rücksicht auf die Einzelstelle, aufgemacht. So kommt die wirk-
lich vielfach komische Interpretation von Grillparzers »Traum ein Leben« (S. 42 f.)
zustande. Die fixe Idee, daß der Dichter überall seinem Haß gegen den Vater
und seiner Inzestliebe zur Mutter Ausdruck geben müsse (vgl. S. 31, bes. 22, 27),
den Blüten jüngstdeutscher Dichtung gar nicht zu reden — kennen wir diesen Stil
zur Genüge und wir zucken die Achseln und lachen. Wenn er sich aber in einem
gelehrten, sonst ernst zu nehmenden Buche breit macht, so ist das einfach uner-
träglich. Dieses Deutsch kann dem Verfasser viel weniger verziehen werden als
kleine terminologische Schnitzer, wie die »zweifache Personifizierung Seite 143, oder
selbst als geschmacklose an Dühring erinnernde Witzeleien, wie der »Straußen-
töter« Seite 190. Jeder, dem höhere intellektuelle Kultur am Herzen liegt, muß
sich gegen die Narrensprünge, den Cake-walk-Tanz einer solchen Prosa auflehnen,
und drum schien es mir geradezu Pflicht, die Gelegenheit zu ergreifen, hierüber
einmal die Wahrheit zu sagen und in dieser allen ästhetischen Interessen dienenden
Zeitschrift an einem Beispiele zu zeigen, was aus der Sprache Herders und Schillers,
Alexander v. Humboldts und Fallmerayers in unseren Tagen geworden ist.
Graz.
Hugo Spitzer.
Wilhelm Stekel, Dichtung und Neurose. Bausteine zur Psychologie des
Künstlers und des Kunstwerkes. VI und 73 S. Wiesbaden 1909, J. F. Berg-
mann. (Grenzfragen des Nerven- und Seelenlebens, herausgeg. von L. Löwen-
feld, LXV.) 2 Mark.
Dies ist ein Buch, das ich lang gesucht habe, eh' ich von ihm wußte; nun hat
es mir das Schicksal in die Hände gegeben. Der Größenwahn der neuropatho-
logischen Selbstsicherheit mußte früher oder später solch eine Schrift erzeugen.
Hier haben wir den wildgewordenen Freudianismus in Reinkultur und erkennen
in ihm die schönsten methodologischen Rückschritte.
»Wer schreibt einmal die Pathographie des Pathographen?« hab' ich früher
schon gefragt. Wer sie schreibt, darf an den Schülern des in seinen eigenen For-
schungen gewiß höchst beachtenswerten Wiener Psychologen nicht vorübergehen.
Stekel wehrt sich allerdings (S. 3 f.) kräftig und auch glücklich gegen die Nachbarn
Lombroso und Nordau, für die alles Übernormale »Psychose« ist; wenn aber für
ihn alles »Neurose« ist, ändert das in der Methode oder vielmehr in der Methode-
losigkeit gar nichts. Wie immer werden nur die Beispiele angeführt, die für die
Hypothese sprechen; oder es wird ein Terminus wie »das lebhafte Triebleben«
(S. 15 f.) so allgemein genommen, daß eigentlich nur ein stumpfsinnig geborener
Erzphilister der Diagnose auf dichterische Anlage entgehen kann. Die — meist
allbekannten — Zeugnisse über Rousseau, Hebbel, Strindberg, G. Keller, Goethe
werden ohne jede feinere Interpretation grob nebeneinander gelegt; und wenn etwa
Platen melancholisch über verlorene Tage klagt, so ist das (S. 40) ein »fürchter-
licher Aufschrei« der Zerknirschung.
Aber die eigentliche Wildheit der Beweisjagd beginnt erst mit Freuds Speziali-
tät: der Traumdeutung. Natürlich gibt es auch für den unbedingten Schüler nur
»Verdrängungen« und natürlich sind alle Gefühle erotisch. »Fechten und Kämpfen
heißt in der Sprache des Traumes einen Geschlechtsakt vollziehen« (S. 65). Als ob
nicht auch die Neigung zum wirklichen Kampf verdrängt werden könnte! Aber
wir haben hier vollständig jene unverständige Art der Mythendeutung, die in der
Mythologie glücklich überwunden war — bis sie mit Siecke und dem neuen Mond-
monotheismus wiedergekehrt ist. Mit einem Generalschlüssel wird alles, ohne jede
individualisierende Rücksicht auf die Einzelstelle, aufgemacht. So kommt die wirk-
lich vielfach komische Interpretation von Grillparzers »Traum ein Leben« (S. 42 f.)
zustande. Die fixe Idee, daß der Dichter überall seinem Haß gegen den Vater
und seiner Inzestliebe zur Mutter Ausdruck geben müsse (vgl. S. 31, bes. 22, 27),