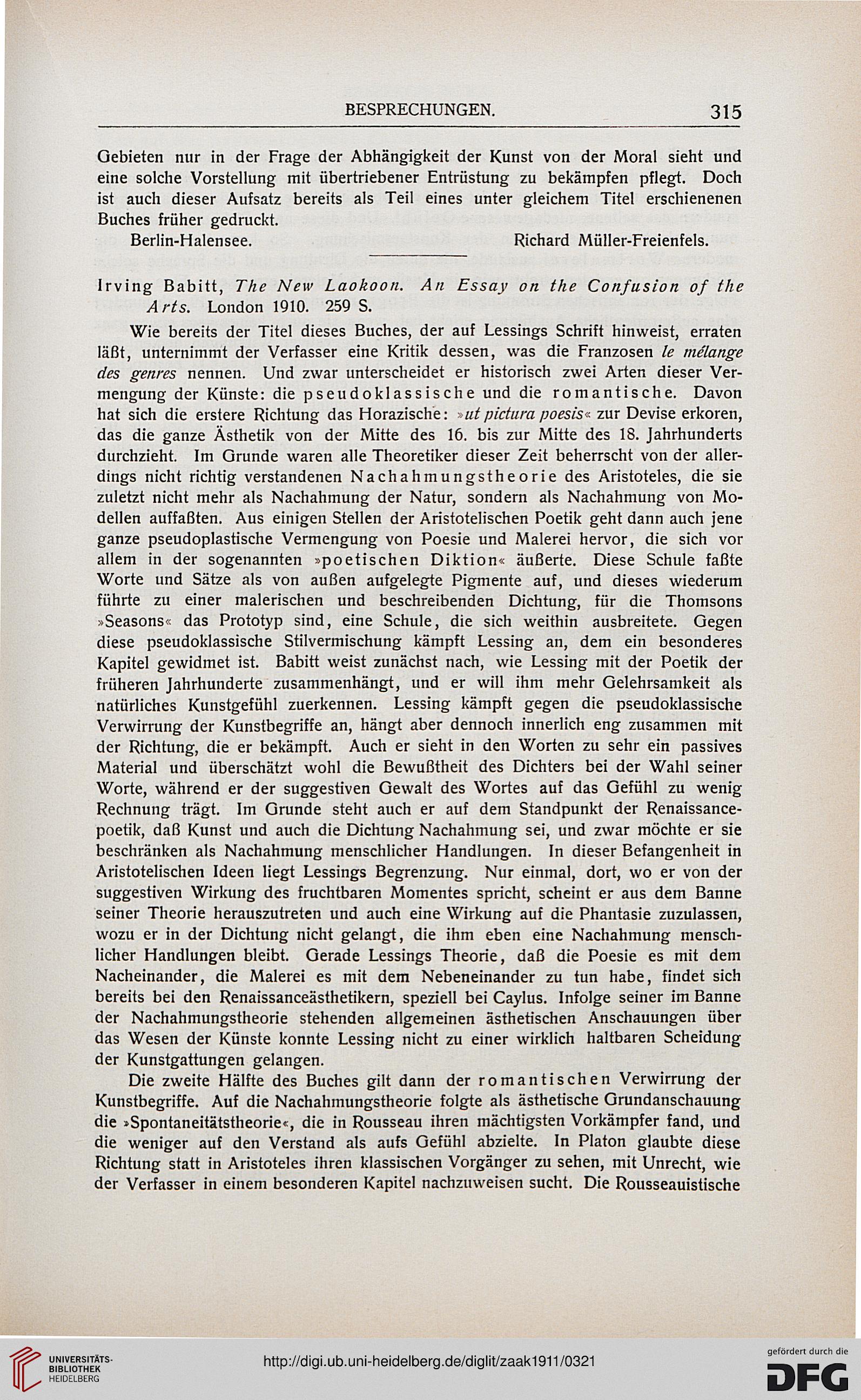BESPRECHUNGEN. 315
Gebieten nur in der Frage der Abhängigkeit der Kunst von der Moral sieht und
eine solche Vorstellung mit übertriebener Entrüstung zu bekämpfen pflegt. Doch
ist auch dieser Aufsatz bereits als Teil eines unter gleichem Titel erschienenen
Buches früher gedruckt.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Irving Babitt, The New Laokoon. An Essay on the Confusion of the
Arts. London 1910. 259 S.
Wie bereits der Titel dieses Buches, der auf Lessings Schrift hinweist, erraten
läßt, unternimmt der Verfasser eine Kritik dessen, was die Franzosen le nielange
des genres nennen. Und zwar unterscheidet er historisch zwei Arten dieser Ver-
mengung der Künste: die pseudoklassische und die romantische. Davon
hat sich die erstere Richtung das Horazische: »utpictura poesis* zur Devise erkoren,
das die ganze Ästhetik von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
durchzieht. Im Grunde waren alle Theoretiker dieser Zeit beherrscht von der aller-
dings nicht richtig verstandenen Nachahmungstheorie des Aristoteles, die sie
zuletzt nicht mehr als Nachahmung der Natur, sondern als Nachahmung von Mo-
dellen auffaßten. Aus einigen Stellen der Aristotelischen Poetik geht dann auch jene
ganze pseudoplastische Vermengung von Poesie und Malerei hervor, die sich vor
allem in der sogenannten »poetischen Diktion« äußerte. Diese Schule faßte
Worte und Sätze als von außen aufgelegte Pigmente auf, und dieses wiederum
führte zu einer malerischen und beschreibenden Dichtung, für die Thomsons
»Seasons« das Prototyp sind, eine Schule, die sich weithin ausbreitete. Gegen
diese pseudoklassische Stilvermischung kämpft Lessing an, dem ein besonderes
Kapitel gewidmet ist. Babitt weist zunächst nach, wie Lessing mit der Poetik der
früheren Jahrhunderte zusammenhängt, und er will ihm mehr Gelehrsamkeit als
natürliches Kunstgefühl zuerkennen. Lessing kämpft gegen die pseudoklassische
Verwirrung der Kunstbegriffe an, hängt aber dennoch innerlich eng zusammen mit
der Richtung, die er bekämpft. Auch er sieht in den Worten zu sehr ein passives
Material und überschätzt wohl die Bewußtheit des Dichters bei der Wahl seiner
Worte, während er der suggestiven Gewalt des Wortes auf das Gefühl zu wenig
Rechnung trägt. Im Grunde steht auch er auf dem Standpunkt der Renaissance-
poetik, daß Kunst und auch die Dichtung Nachahmung sei, und zwar möchte er sie
beschränken als Nachahmung menschlicher Handlungen. In dieser Befangenheit in
Aristotelischen Ideen liegt Lessings Begrenzung. Nur einmal, dort, wo er von der
suggestiven Wirkung des fruchtbaren Momentes spricht, scheint er aus dem Banne
seiner Theorie herauszutreten und auch eine Wirkung auf die Phantasie zuzulassen,
wozu er in der Dichtung nicht gelangt, die ihm eben eine Nachahmung mensch-
licher Handlungen bleibt. Gerade Lessings Theorie, daß die Poesie es mit dem
Nacheinander, die Malerei es mit dem Nebeneinander zu tun habe, findet sich
bereits bei den Renaissanceästhetikern, speziell bei Caylus. Infolge seiner im Banne
der Nachahmungstheorie stehenden allgemeinen ästhetischen Anschauungen über
das Wesen der Künste konnte Lessing nicht zu einer wirklich haltbaren Scheidung
der Kunstgattungen gelangen.
Die zweite Hälfte des Buches gilt dann der romantischen Verwirrung der
Kunstbegriffe. Auf die Nachahmungstheorie folgte als ästhetische Grundanschauung
die »Spontaneitätstheorie«, die in Rousseau ihren mächtigsten Vorkämpfer fand, und
die weniger auf den Verstand als aufs Gefühl abzielte. In Piaton glaubte diese
Richtung statt in Aristoteles ihren klassischen Vorgänger zu sehen, mit Unrecht, wie
der Verfasser in einem besonderen Kapitel nachzuweisen sucht. Die Rousseauistische
Gebieten nur in der Frage der Abhängigkeit der Kunst von der Moral sieht und
eine solche Vorstellung mit übertriebener Entrüstung zu bekämpfen pflegt. Doch
ist auch dieser Aufsatz bereits als Teil eines unter gleichem Titel erschienenen
Buches früher gedruckt.
Berlin-Halensee. Richard Müller-Freienfels.
Irving Babitt, The New Laokoon. An Essay on the Confusion of the
Arts. London 1910. 259 S.
Wie bereits der Titel dieses Buches, der auf Lessings Schrift hinweist, erraten
läßt, unternimmt der Verfasser eine Kritik dessen, was die Franzosen le nielange
des genres nennen. Und zwar unterscheidet er historisch zwei Arten dieser Ver-
mengung der Künste: die pseudoklassische und die romantische. Davon
hat sich die erstere Richtung das Horazische: »utpictura poesis* zur Devise erkoren,
das die ganze Ästhetik von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts
durchzieht. Im Grunde waren alle Theoretiker dieser Zeit beherrscht von der aller-
dings nicht richtig verstandenen Nachahmungstheorie des Aristoteles, die sie
zuletzt nicht mehr als Nachahmung der Natur, sondern als Nachahmung von Mo-
dellen auffaßten. Aus einigen Stellen der Aristotelischen Poetik geht dann auch jene
ganze pseudoplastische Vermengung von Poesie und Malerei hervor, die sich vor
allem in der sogenannten »poetischen Diktion« äußerte. Diese Schule faßte
Worte und Sätze als von außen aufgelegte Pigmente auf, und dieses wiederum
führte zu einer malerischen und beschreibenden Dichtung, für die Thomsons
»Seasons« das Prototyp sind, eine Schule, die sich weithin ausbreitete. Gegen
diese pseudoklassische Stilvermischung kämpft Lessing an, dem ein besonderes
Kapitel gewidmet ist. Babitt weist zunächst nach, wie Lessing mit der Poetik der
früheren Jahrhunderte zusammenhängt, und er will ihm mehr Gelehrsamkeit als
natürliches Kunstgefühl zuerkennen. Lessing kämpft gegen die pseudoklassische
Verwirrung der Kunstbegriffe an, hängt aber dennoch innerlich eng zusammen mit
der Richtung, die er bekämpft. Auch er sieht in den Worten zu sehr ein passives
Material und überschätzt wohl die Bewußtheit des Dichters bei der Wahl seiner
Worte, während er der suggestiven Gewalt des Wortes auf das Gefühl zu wenig
Rechnung trägt. Im Grunde steht auch er auf dem Standpunkt der Renaissance-
poetik, daß Kunst und auch die Dichtung Nachahmung sei, und zwar möchte er sie
beschränken als Nachahmung menschlicher Handlungen. In dieser Befangenheit in
Aristotelischen Ideen liegt Lessings Begrenzung. Nur einmal, dort, wo er von der
suggestiven Wirkung des fruchtbaren Momentes spricht, scheint er aus dem Banne
seiner Theorie herauszutreten und auch eine Wirkung auf die Phantasie zuzulassen,
wozu er in der Dichtung nicht gelangt, die ihm eben eine Nachahmung mensch-
licher Handlungen bleibt. Gerade Lessings Theorie, daß die Poesie es mit dem
Nacheinander, die Malerei es mit dem Nebeneinander zu tun habe, findet sich
bereits bei den Renaissanceästhetikern, speziell bei Caylus. Infolge seiner im Banne
der Nachahmungstheorie stehenden allgemeinen ästhetischen Anschauungen über
das Wesen der Künste konnte Lessing nicht zu einer wirklich haltbaren Scheidung
der Kunstgattungen gelangen.
Die zweite Hälfte des Buches gilt dann der romantischen Verwirrung der
Kunstbegriffe. Auf die Nachahmungstheorie folgte als ästhetische Grundanschauung
die »Spontaneitätstheorie«, die in Rousseau ihren mächtigsten Vorkämpfer fand, und
die weniger auf den Verstand als aufs Gefühl abzielte. In Piaton glaubte diese
Richtung statt in Aristoteles ihren klassischen Vorgänger zu sehen, mit Unrecht, wie
der Verfasser in einem besonderen Kapitel nachzuweisen sucht. Die Rousseauistische